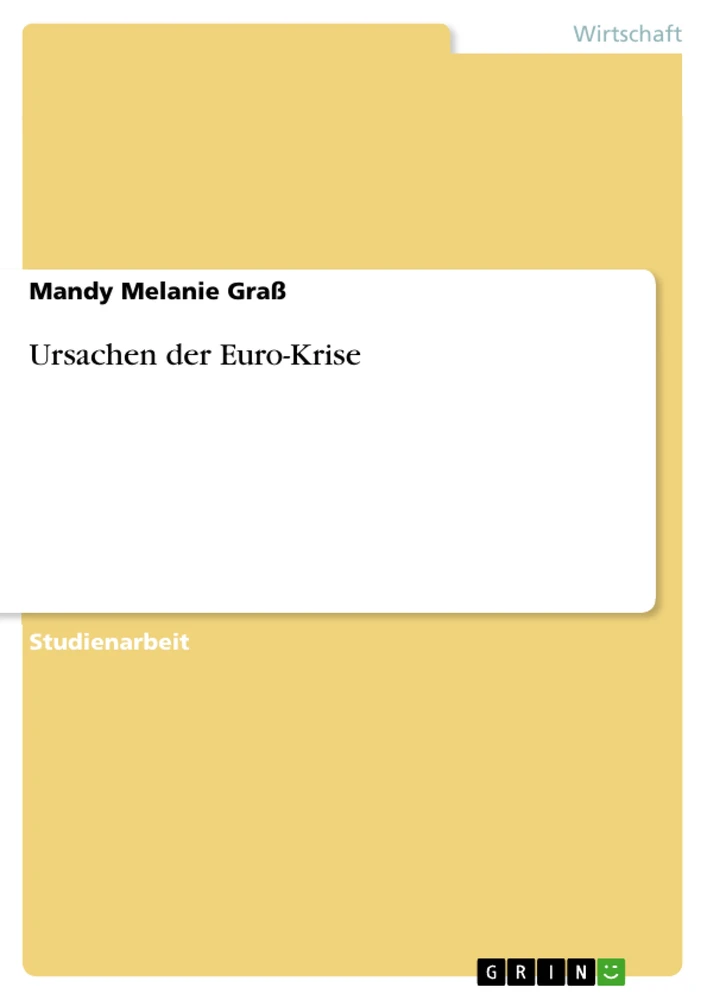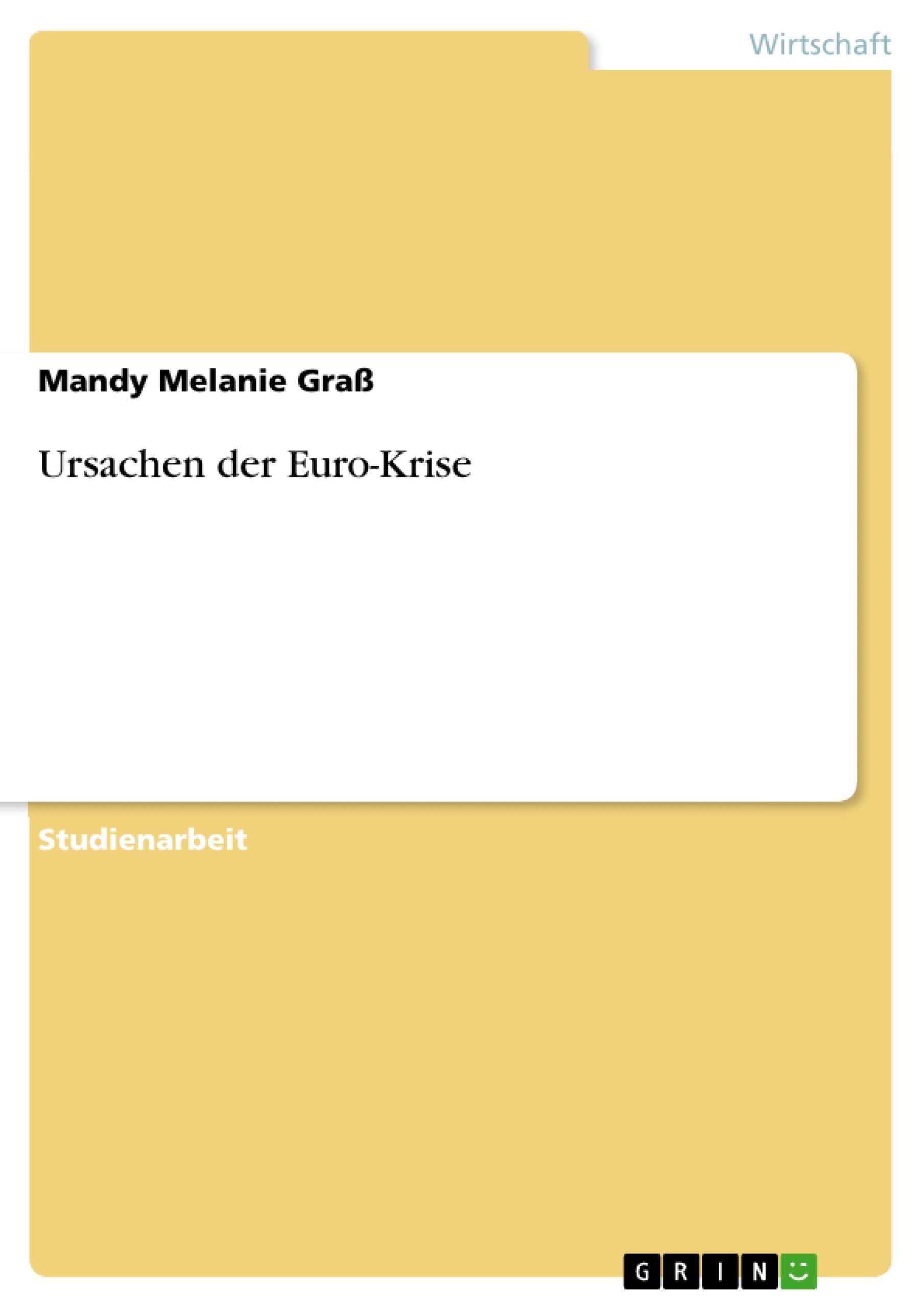Die Idee des Euros schien genial: Eine einheitliche Währung für eine Gemeinschaft, die nach Frieden, Demokratie und dem gemeinsamen Wohlstand strebt. Die Handelsschranken und Zölle sind offen, Bürger brauchen beim Betreten eines anderen Landes kein Geld mehr zu wechseln, Importeuren ist nun klar, welche Kosten am Ende auf sie zukommen und Exporteure können sich sicher sein, dass die versprochene Zahlung auch denselben Wert hat. Kritiker warnen vor weltweiten Schwierigkeiten und dass es Europa an Institutionen fehle, die diese Währung praktikabel machen würden, aber ebenso wurde von Staats- und Regierungschefs ignoriert, dass eine Währungsunion Vorteile wie auch Kosten beinhaltet und dass eine europäische Währung viel schwächer ist, als ein einheitlicher europäischer Markt. Nach der Einführung 2002 wächst die Wirtschaft im Hinblick auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP), ebenso wie Import und Export. Dadurch wird die europäische Einheit gestärkt.
Doch zehn Jahre nach der Einführung des Euros scheinen die Warnungen näher gerückt zu sein: Spaniens boomende Wirtschaft verzeichnet fast ein Viertel der arbeitsfähigen Bürger als arbeitslos, Griechenland ist so hoch verschuldet, dass es im Februar 2012 das zweite Rettungspaket mit bis zu 130 Milliarden Euro erhält, Irland versucht mit allen Mitteln den Konkurs abzuwenden und schlüpft schließlich als erster Staat unter den Euro-Rettungsschirm. Die Inflation steigt 2008 so stark an, dass viele eine Geldentwertung und das Ende des Euros befürchten. Der Euro-Traum verwandelt sich zum Albtraum vieler Menschen und die Nachrichtenflut über die Eurokrise und die Staatsverschuldungen scheint kein Ende zu nehmen. Viele Menschen mutmaßen über die Ursache: Liegt es etwa an der Immobilienkrise in den USA, dem Stabilitätspakt, der weniger stabil war als gewollt? Oder vielleicht sogar an der Einführung des Euros?
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der Hauptursachen der Eurokrise 2009. Dazu wird in erster Linie erläutert, was eine Krise überhaupt ist, welche Konvergenzen die Euro-Länder einzuhalten haben und was die Statistiken, vor allem in den Ländern Griechenland, Spanien und Deutschland, im Hinblick auf Defizite, Verschuldungen, Arbeitslosigkeit sowie Bruttoinlandsprodukt verzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Europäische Währungsunion
- Wirtschaftskrisen
- Definition von Krisen
- Arten von Wirtschaftskrisen
- Die aktuelle Eurokrise
- Hilfsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank
- Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
- Der Europäischer Stabilisierungsmechanismus (ESM)
- Das Anleihenkaufprogramm
- Ursache der Eurokrise 2009 bis heute
- Aufnahme der GIIPSZ-Staaten in die Währungsunion
- Außenwirtschaftliche Schieflage der Euro-Staaten
- Fehlentwicklung und verpasste Strukturformen
- Finanzkrise und expansive Fiskalpolitik
- Erwartungen und Verhaltensanomalien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ursachen der aktuellen Eurokrise und untersucht die verschiedenen Faktoren, die zu dieser Krise beigetragen haben. Die Untersuchung umfasst sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete empirische Daten und Analysen.
- Die Rolle der Europäischen Währungsunion
- Die verschiedenen Arten von Wirtschaftskrisen
- Die Aufnahme der GIIPSZ-Staaten in die Währungsunion
- Die Außenwirtschaftliche Schieflage der Euro-Staaten
- Die Folgen der Finanzkrise und expansiven Fiskalpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt das Thema der Eurokrise vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Europäischen Währungsunion und von Wirtschaftskrisen. Es beinhaltet Definitionen, Arten von Wirtschaftskrisen und die Rolle der Europäischen Zentralbank.
- Ursache der Eurokrise 2009 bis heute: Dieses Kapitel untersucht die wichtigsten Ursachen der Eurokrise. Es analysiert die Aufnahme der GIIPSZ-Staaten in die Währungsunion, die außenwirtschaftliche Schieflage, Fehlentwicklungen und verpasste Strukturformen, die Auswirkungen der Finanzkrise und die Rolle der expansiven Fiskalpolitik.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Eurokrise, Europäische Währungsunion, Wirtschaftskrisen, GIIPSZ-Staaten, Finanzkrise, expansive Fiskalpolitik, Außenwirtschaftliche Schieflage, Fehlentwicklungen, Strukturformen, Europäische Zentralbank.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptursachen der Eurokrise 2009?
Zu den Ursachen zählen die außenwirtschaftliche Schieflage der Euro-Staaten, Fehlentwicklungen in der Fiskalpolitik, verpasste Strukturreformen und die Folgen der globalen Finanzkrise.
Was bedeutet der Begriff „GIIPSZ-Staaten“?
GIIPSZ ist ein Akronym für Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien und Zypern, die Länder, die besonders stark von der Euro- und Schuldenkrise betroffen waren.
Welche Rolle spielte die Europäische Zentralbank (EZB)?
Die EZB intervenierte durch Hilfsmaßnahmen wie Anleihenkaufprogramme und die Unterstützung von Stabilisierungsmechanismen (EFSF/ESM), um den Euro zu stützen.
Was ist der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM)?
Der ESM ist ein permanenter Rettungsschirm, der Euro-Ländern bei Finanzierungsschwierigkeiten unter strengen Auflagen Kredite gewährt, um die Stabilität der Währungsunion zu sichern.
War die Einführung des Euro selbst eine Ursache der Krise?
Kritiker argumentieren, dass die Währungsunion ohne eine gemeinsame Fiskalunion und ausreichende Kontrollinstanzen strukturelle Instabilitäten geschaffen hat.
- Quote paper
- Mandy Melanie Graß (Author), 2012, Ursachen der Euro-Krise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207813