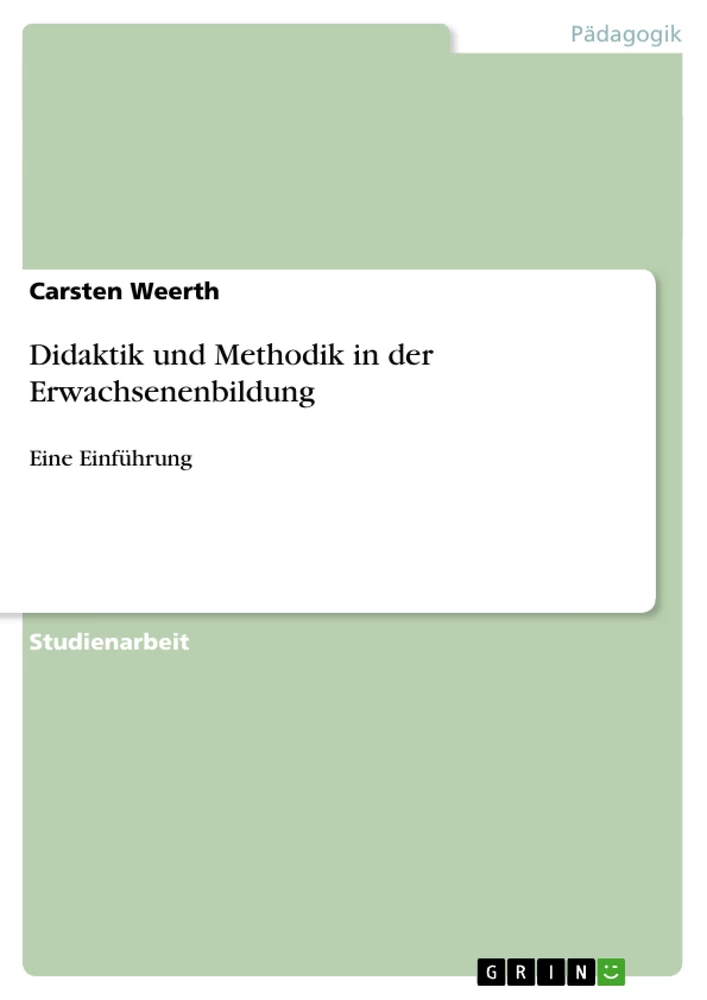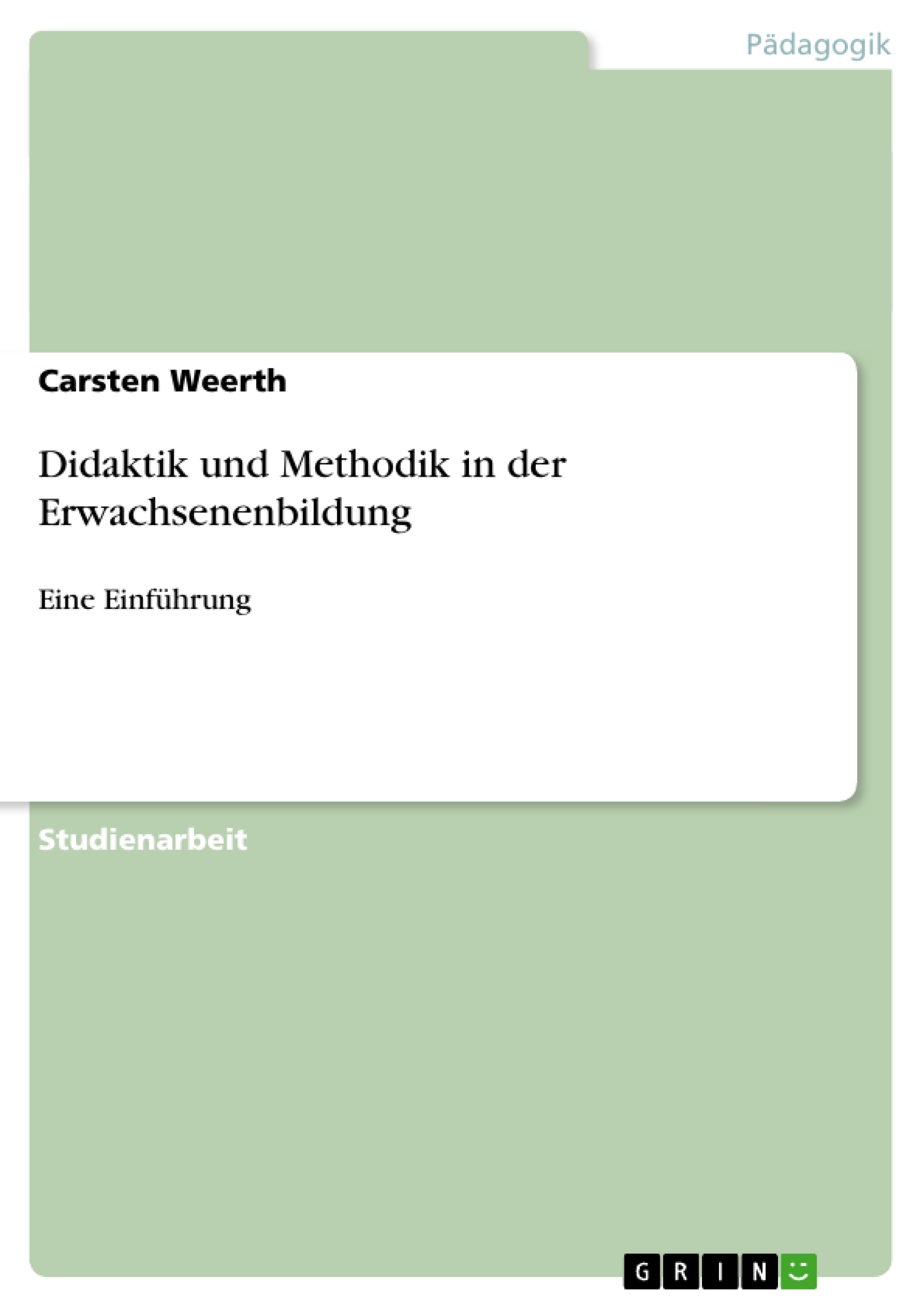Einsendearbeiten im Fernstudiengang "Erwachsenenbildung"
Inhaltsverzeichnis
Einsendeaufgabe 1 – Ständige Wortbeiträge – Möglichkeiten der Intervention
Einsendeaufgabe 2 – Unterschied „Didaktik“ und „Lernkultur“
Einsendeaufgabe 3 – Lernprozesse auf unterschiedlichen Komplexitätsstufen
Einsendeaufgabe 4 – Medien für den Daleschen Erfahrungskegel
Literaturverzeichnis
Einsendeaufgabe 1 – Ständige Wortbeiträge – Möglichkeiten der Intervention (zu EB 0510)
Eines der Postulate zur Tehmen-Zentrierten Interaktion (TZI) von Ruth Cohn besagt, dass „Störungen angemessenen Raum“ zu geben sei (von Felden, 2008, S. 71). Insofern ist es für Kursleiter (in der Folge KL) von Bedeutung, Prozesse wie positive Interaktionen in Gruppen aber auch dauerhafte Störungen zunächst wahrzunehmen. Doch was sind überhaupt Störungen? „Allgemein kann eine Störung beschrieben werden als Situationen in der ein Gruppenmitglied, eine Teilgruppe oder die Seminarleitung sich gestört fühlt, also den Eindruck hat, dass die Lern- oder Gruppenprozess aus der Balance gekommen ist, von einem erwünschten Zustand abweicht und das gemeinsame Vorhaben blockiert oder behindert wird“ (von Felden, 2008, S. 109).
Ständige Wortbeiträge und Monologe dürften zu ständigen Störungen zählen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass Menschen ihre „Wahrheit“ und „Wahrnehmung“ (ihre „Wirklichkeit“) selbst konstruieren (sog. Konstruktivismus) und was als störend wahrgenommen wird, ist letztlich vom KL und der Gruppe abhängig – eine Störung ist somit eine Deutung, „ein Konstrukt von einzelnen oder mehreren“ (von Felden, 2008, S. 109). Beispiele für Störer im Unterricht sind in der Literatur v.a. für Schüler und Schulen bekannt, z.B. „Peter stört “ (Henningsen, 1984 zit. nach Fach A4 in Arnold/Petzold, 2009, S. 12) und „Tobias stört “ (Boysen, 2008).
Gründe für Störungen können vielfältig sein (Fach C38 in Arnold/Petzold, 2009, S. 80 f. mit Bezugnahmen auf Dreikurs, 1995 und Grell, 1995):
- „Organisch-konstitutionelle Bereiche“ (Motivationsstörungen),
- „Umweltbedingungen“ (ungünstiges Umfeld, Elternhaus, Familiensituation),
- „Rahmenbedingungen“ des Unterrichts (Über-/Unterforderung, Langeweile),
- „Sozialisatorischer Entwicklungsaufgaben“ (Identitätslernen),
- „Peer-group-Verhalten“ (Druck aus der Gruppe, Gruppendynamik), aber auch
- „Rivalitäten“ (unter Geschwistern oder Konkurrenten).
Und nun konkret zum angesprochenen Fall des Dauermonologs in der Erwachsenenbildung. Der aufmerksame KL bekommt durch das Verhalten des Teilnehmers (in der Folge T) einen Hinweis auf Probleme des T. Allerdings besteht die Schwierigkeit darin, festzustellen, ob T über- oder unterfordert ist, gelangweilt ist, ob er nur ein Imponiergehabe auslebt oder was letztlich genau hinter seinem Verhalten steht.
Watzlawick stellte fest: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick u.a., 1982 zit. nach von Felden, 2008, S. 53). Insofern stellt ein Dauermonolog (aber auch Schweigen) eine Kommunikation dar, mit der der T etwas mitteilt – hier eine Selbstoffenbarung (nach Schulz von Thun, 1981 zit. nach von Felden, 2008 S. 56).
Das zweite Axiom von Watzlawick u.a. lautete dann auch: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den ersten bestimmt und von daher eine Metakommunikation ist“ (Watzlawick u.a., 1982 zit. nach von Felden, 2008, S. 53). Beim Dauerredner steht weniger der Inhalt, als mehr die Beziehung im Vordergrund.
Grundlegende Bedürfnisse von Gruppenmitgliedern sind: Kontakt, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Einflussnahme, Kompetenzverbesserung und Abwechslung (von Felden, 2008, S. 113).
In einer Gruppe und der Kommunikation in Gruppen gibt es verschiedene „Rollen“ (Antons, 1976 zit. nach von Felden, 2008, S. 47): „Aufgabenrollen“, „Erhaltungs- und Aufbaurollen“ sowie „Negativrollen“. Auf den Dauerredner treffen verschiedene Aspekte der Negativrolle zu: Selbstgeständnisse, Rivalisieren (ggf. mit anderen Gruppenmitgliedern), Suche nach Sympathie, Suche nach Aufmerksamkeit und Beachtung (Antons, 1976 zit. nach von Felden, 2008, S. 47).
Der KL hat u.a. die Aufgabe, den Kurs zu lenken und zu moderieren. Sofern er nicht dozenten-, sondern teilnehmerzentriert arbeitet, wird er das Ziel verfolgen, allen T Raum für Beiträge zu geben; wenn Dauerredner auftreten, wird das Seminar gefährdet. Als Interaktion ist es möglich, dass sich die Gruppe eigene Regeln zu Beginn der nächsten Sitzung gibt (z.B. Redezeit begrenzen auf max. drei Minuten).
In der Arbeit mit störenden Schülern hat es sich bewährt, diesen besondere Aufgaben zu geben (z.B. Rolle des Beobachters, Rolle des Kritikers) – diese Schüler werden dann besonders gefordert und in einer Sonderrolle gewürdigt – auch dieses Vorgehen könnte sich als lohnender Ansatz erweisen.
Die Metakommunikation ist das „Reden über das Reden“ und über die Kommunikation.
Metakommunikation ist „häufig ein Ausweg aus einer Kommunikationsstörung“ (von Felden, 2008, S. 117). Daher ist ein möglicher Ausweg, mit dem Dauerredner unter vier Augen zu sprechen und an ihn zu appellieren, weniger lange Wortbeiträge zu machen. Oder das Dilemma öffentlich im Rahmen von Feedback nach den bekannten Feedback-Regeln (von Felden, 2008, S. 119 f.) zu erarbeiten. Wie so häufig in der Erwachsenenbildung – es gibt keine Rezeptologien, nur verschiedene Wege, die der professionell handelnde Erwachsenenbildner wertschätzend und achtsam gehen kann. Ob diese dann zum gewünschten Erfolg führen, hängt auch von den T und den Rahmenbedingen, sowie den gewählten Worten des KL und der T ab.
Einsendeaufgabe 2 – Unterschied „Didaktik“ und „Lernkultur“ (zu EB 0520)
Zur Einleitung zunächst eine kurze Definition der Didaktik:
„ Didaktik “ ist Griechisch und steht sowohl für das Verb „lehren, unterrichten, belehren" – wobei es im Aktiv und im Passiv verwendet werden kann (also auch als „lernen, belehrt, unterrichtet“), als auch für die Substantive „Lehre, Belehren, Unterricht, Unterweisung“ (Peterßen in Roth, 1980, S. 97 und Heursen in Lenzen, 1989, S. 307).
Es handelt sich um die „Lehrkunst“ (von Felden, 2008, S. 10 und Siebert, 2012, S. 4) oder Wissenschaft vom „lernwirksamen Lehren bzw. Unterrichten“ (Arnold in Arnold/Nolda/Nuissl, 2010, S. 64). „Der Didaktikbegriff wird hier [zunächst] an die Perspektive des Lehrenden gebunden“ (von Felden, 2008, S. 10).
Didaktik ist nach einer anderen Definition „die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens“ (Jank/Meyer, 2008, S. 14).
Didaktik wird darüber hinaus unterschieden in Makro- und Mikrodidaktik:
Makrodidaktik (die vorwiegend vom hauptberuflichen pädagogischen Personal durchgeführt wird) beschäftigt sich mit dem „didaktische[n] Profil einer Bildungseinrichtung, also das Leitbild, das Bildungsverständnis, die Schwerpunktthemen, die bevorzugten Zielgruppen, [...] die Programmplanung und die Marketingstrategien“ (Siebert, 2012, S. V).
Mikrodidaktik beschäftigt sich mit der tatsächlichen Planung und Durchführung von einzelnen Bildungsveranstaltungen (Siebert, 2012, S. V), z.B. den „Großformen“ Vortrag, Seminar, Lehrgang, Training, Workshop, Projekt, Exkursion, Studienreise, Outdoor-Training (Höffer-Mehlmer, 2009a, S. 6 ff.).
Die Didaktik beschäftigt sich in Makro- und Mikrodidaktik mit den Fragen:
- Was soll gelehrt werden?
- Wer ist Adressat des Unterrichtsangebots?
- Wie ist die Lernumgebung gestaltet (sog. Lernökologie)?
- Wie genau soll der Unterricht gestaltet werden (Einstieg/Hauptteil/Schluss)?
- Welche Lehrform wird eingesetzt (Frontalunterricht, Gruppenarbeit, Gruppengespräch, usw.)?
- Wie bekommt die Bildungseinrichtung großen Zulauf und Zuspruch?
- Welche Medien setze ich als Dozent wie praktisch ein?
Diese Didaktik und Methodik kann sowohl Dozentenzentriert als auch Teilnehmerorientiert und Teilnehmerzentriert eingesetzt und angewendet werden.
Die Didaktik ist nicht neu: die Lehre von der Lehre hatte in der „Aufklärung des 17. Jahrhunderts“ ihre Ursprünge, u.a. mit Verfechtern wie „Wolfgang Ratke (1571-1635) und Johann Amos Comenius (1595-1670), die das planvolle Lehren und Lernen als erste in einen pädagogischen Bedeutungszusammenhang stellten“ (Heursen in Lenzen, 1989, S. 308). Nach anderen Quellen wurde Comenius 1592 geboren (übereinstimmend Jank/Meyer, 2008, S. 11 und von Felden, 2008, S. 10).
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet die Einsendeaufgabe 1 – Ständige Wortbeiträge – Möglichkeiten der Intervention (zu EB 0510)?
Diese Aufgabe befasst sich mit dem Umgang mit ständigen Wortbeiträgen und Monologen in Gruppen, basierend auf den Prinzipien der Themen-Zentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn. Sie diskutiert die Wahrnehmung und Deutung von Störungen, mögliche Ursachen für störendes Verhalten, die Kommunikationsaspekte nach Watzlawick und Rollen in Gruppen. Abschließend werden Interventionsmöglichkeiten für Kursleiter (KL) zur Bewältigung von Dauermonologen in der Erwachsenenbildung erörtert.
Was versteht man unter Störungen im Kontext von Gruppeninteraktionen?
Eine Störung wird definiert als eine Situation, in der sich ein Gruppenmitglied, eine Teilgruppe oder die Seminarleitung gestört fühlt und den Eindruck hat, dass der Lern- oder Gruppenprozess aus der Balance geraten ist und das gemeinsame Vorhaben blockiert oder behindert wird. Wichtig ist, dass die Wahrnehmung einer Störung subjektiv ist.
Welche Gründe kann es für Störungen, wie z.B. Dauermonologe, geben?
Die Gründe für Störungen sind vielfältig und können organisch-konstitutionelle Bereiche, Umweltbedingungen, Rahmenbedingungen des Unterrichts, sozialisatorische Entwicklungsaufgaben, Peer-group-Verhalten oder Rivalitäten umfassen. Im Fall von Dauermonologen ist es entscheidend, die Ursache für das Verhalten des Teilnehmers (T) zu ermitteln, z.B. Über- oder Unterforderung, Langeweile oder Imponiergehabe.
Welche Rolle spielen die Axiome von Watzlawick bei der Analyse von Dauermonologen?
Nach Watzlawick kann man nicht nicht kommunizieren, was bedeutet, dass auch ein Dauermonolog (oder Schweigen) eine Form der Kommunikation darstellt, mit der der Teilnehmer etwas mitteilt. Das zweite Axiom besagt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt hat, wobei der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt. Bei einem Dauerredner steht somit weniger der Inhalt als mehr die Beziehung im Vordergrund.
Welche grundlegenden Bedürfnisse haben Gruppenmitglieder?
Zu den grundlegenden Bedürfnissen von Gruppenmitgliedern gehören Kontakt, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Einflussnahme, Kompetenzverbesserung und Abwechslung.
Wie kann der Kursleiter (KL) auf Dauermonologe reagieren?
Der KL hat die Aufgabe, den Kurs zu lenken und zu moderieren, um allen Teilnehmern Raum für Beiträge zu geben. Mögliche Interventionen umfassen die Etablierung von Gruppenregeln zur Begrenzung der Redezeit, die Zuweisung spezieller Aufgaben an den störenden Teilnehmer (z.B. Beobachterrolle) oder die Metakommunikation, also das Gespräch über die Kommunikation, entweder unter vier Augen oder im Rahmen von Feedback in der Gruppe.
Was beinhaltet die Einsendeaufgabe 2 – Unterschied „Didaktik“ und „Lernkultur“ (zu EB 0520)?
Diese Aufgabe behandelt den Unterschied zwischen Didaktik und Lernkultur. Zunächst wird Didaktik definiert, ihre Ursprünge in der Aufklärung des 17. Jahrhunderts erläutert und zwischen Makro- und Mikrodidaktik unterschieden. Es werden die zentralen Fragen der Didaktik beleuchtet und die Bedeutung der wissenschaftlichen Reflexion über Lehr- und Lernzusammenhänge hervorgehoben.
Was ist Didaktik?
Didaktik ist die Lehre vom lernwirksamen Lehren bzw. Unterrichten, also die Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Sie wird auch als "Lehrkunst" bezeichnet. Sie beschäftigt sich mit der Frage, was gelehrt werden soll, wer die Adressaten sind, wie die Lernumgebung gestaltet wird und welche Lehrmethoden eingesetzt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Makro- und Mikrodidaktik?
Makrodidaktik beschäftigt sich mit dem didaktischen Profil einer Bildungseinrichtung, also mit dem Leitbild, dem Bildungsverständnis, den Schwerpunktthemen, den Zielgruppen, der Programmplanung und den Marketingstrategien. Mikrodidaktik hingegen beschäftigt sich mit der konkreten Planung und Durchführung einzelner Bildungsveranstaltungen, wie z.B. Vorträge, Seminare, Workshops oder Exkursionen.
Welche Fragen beantwortet die Didaktik?
Die Didaktik beantwortet Fragen wie: Was soll gelehrt werden? Wer ist Adressat des Unterrichtsangebots? Wie ist die Lernumgebung gestaltet (Lernökologie)? Wie genau soll der Unterricht gestaltet werden (Einstieg/Hauptteil/Schluss)? Welche Lehrform wird eingesetzt? Wie bekommt die Bildungseinrichtung Zulauf? Welche Medien werden eingesetzt?
Wo liegen die Ursprünge der Didaktik?
Die Ursprünge der Didaktik liegen in der Aufklärung des 17. Jahrhunderts, insbesondere bei Pädagogen wie Wolfgang Ratke und Johann Amos Comenius, die das planvolle Lehren und Lernen als erste in einen pädagogischen Bedeutungszusammenhang stellten.
- Citation du texte
- Dr. Carsten Weerth (Auteur), 2012, Didaktik und Methodik in der Erwachsenenbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207508