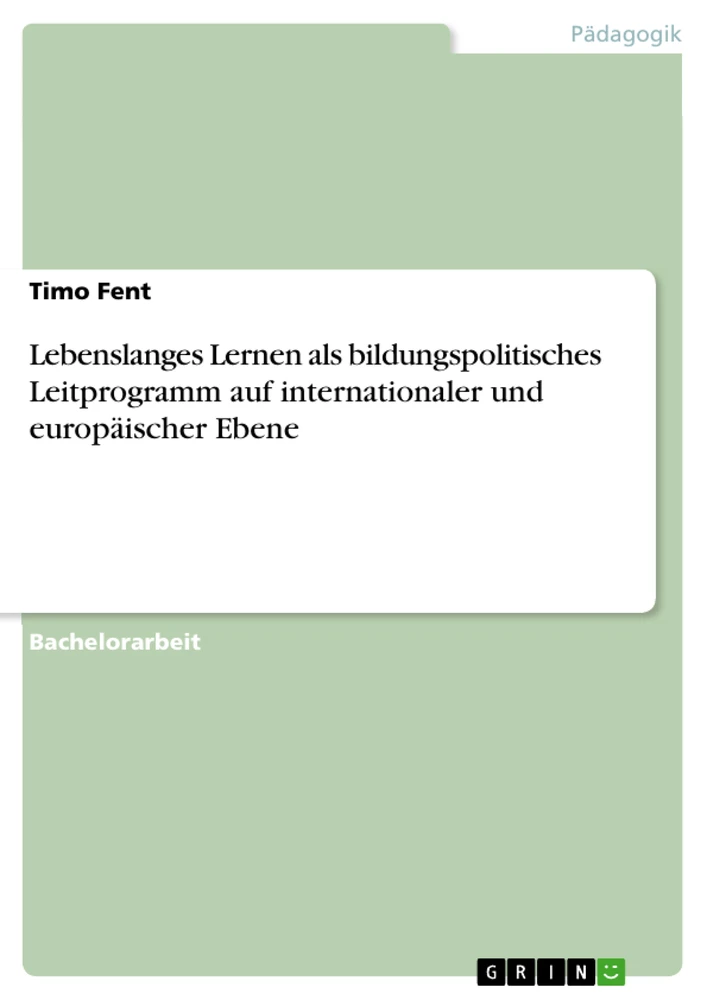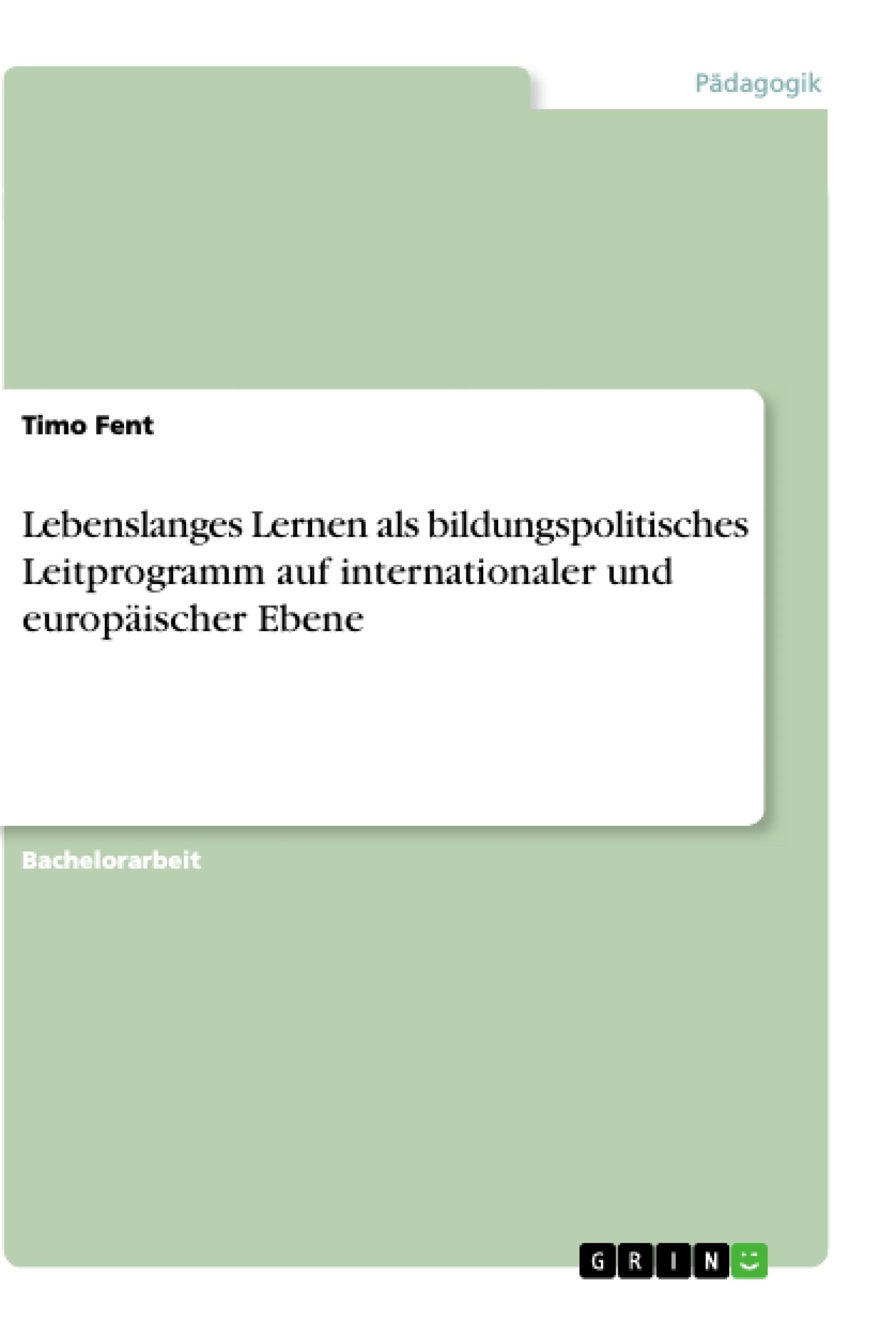...In den letzten Jahrzehnten hat sich Lebenslanges Lernen nicht nur zu der elementarsten pädagogischen Leitidee in Europa entwickelt, nach der „Bildung umfassend und als lebenslanger Prozess gesehen werden muss, damit die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit (…) verwirklicht werden kann“ (Gerlach 2000, S. 89), sondern ist gleichzeitig zum Ober- und Schlüsselbegriff der bildungspolitischen Reformbemühungen der Europäischen Union (EU) geworden (vgl. Óhidy 2011, S. 11). Es ist in den bildungspolitischen Beschlüssen und amtlichen Verlautbarungen der EU mittlerweile als zentrale Leitidee fest verankert und damit essentieller Bestandteil der europäischen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik (vgl. ebd., S. 12). Entsprechend der „Lissabon-Strategie“ des Europäischen Rates (2000), die das Ziel verfolgt, die EU – ursprünglich bis 2010 – zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, und des von der Europäischen Kommission formulierten Memorandums (2000), welches Lebenslanges Lernen als ein „Schlüsselelement stärker demokratisch ausgerichteter beschäftigungs- und sozialpolitischer Strategien“ (Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung/Chisholm 2005, S. 1) darstellt sowie ein Verständnis des Begriffes „Lebenslanges Lernen“ dokumentiert, „das unterschiedliche Lernformen – formal, nicht-formal und informell – einschließt, neue Lernumwelten in Betracht zieht und sich auf die gesamte Lebensspanne erstreckt“ (Herzberg 2008, S. 8), intendiert die EU, ihre Mitgliedstaaten zur Umsetzung ihres „Lifelong-Learning-Konzepts“ im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips anzuregen und sie dabei zu unterstützen (vgl. Óhidy 2011, S. 14). Während der deutsche Bildungsrat 1970 „ständige Weiterbildung“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 51) noch so verstand, „daß das organisierte Lernen auf spätere Phasen des Lebens ausgedehnt wird, und daß sich die Bildungsmentalität weitgehend ändert“ (ebd.), jedoch „keineswegs“ (ebd.) in dem Sinne, „daß das Lernen zum beherrschenden Lebensinhalt werden soll“ (ebd.), ist letzteres gegenwärtig u.a. nach der Feststellung von Ludwig durchaus der Fall: „Heute wird Lernen zum beherrschenden Lebensinhalt definiert“ (Ludwig 2009, S. 2). Dies spiegelt sich auch in nationalen Programmen und Fördermaßnahmen zur Umsetzung Lebenslangen Lernens in der Bundesrepublik Deutschland – so etwa „Lernen im Lebenslauf“ (vgl. BMBF 2011, o. S.) – wider (vgl. hierzu Kap. 4 dieser Bachelorarbeit)....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Annäherungen an das Lebenslange Lernen
- 1.1 Versuch einer Begriffsbestimmung
- 1.2 Hinwendung zum Lebenslangen Lernen und Ausweitung lebenslanger Lernprozesse Gesellschaftliche Hintergründe
- 2. Die Entwicklung des bildungspolitischen Konzepts des Lebenslangen Lernens auf internationaler Ebene
- 2.1 Erste programmatische Ansätze von Europarat, OECD und UNESCO in den 1970er Jahren
- 2.2 1990er Jahre: Die Renaissance Lebenslangen Lernens in der europäischen und internationalen Bildungspolitik – Erneute Vorschläge von OECD und UNESCO
- 3. Die Etablierung Lebenslangen Lernens als bildungspolitisches Leitziel und -programm in Europa
- 3.1 Lissabon-Vereinbarung des Europäischen Rates (2000) und Memorandum über Lebenslanges Lernen (2000)
- 3.2 EU-Bildungsprogramm für Lebenslanges Lernen (2007-2013)
- 3.2.1 Comenius
- 3.2.2 Erasmus
- 3.2.3 Leonardo da Vinci
- 3.2.4 Grundtvig
- 3.2.5 Querschnittsprogramm und Jean Monnet
- 3.2.6 Zwischenbilanz und Ausblick: Neue Programmgeneration 2014 – 2020
- 4. Umsetzung Lebenslangen Lernens im EU-Mitgliedstaat Deutschland
- 5. Chancen und Risiken Lebenslangen Lernens im europäischen Kontext
- 6. Fazit und Ausblick mit einer kritischen Würdigung des bildungspolitischen Programms und der Entwicklung des Lebenslangen Lernens in der EU
- Literatur-/Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Programmatik des Lebenslangen Lernens im europäischen Kontext. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Konzepts, von seinen Anfängen in den 1970er Jahren bis zur Etablierung als bildungspolitisches Leitziel in Europa. Darüber hinaus analysiert sie die Umsetzung des Lebenslangen Lernens in Deutschland und diskutiert Chancen und Risiken des Konzepts im europäischen Kontext.
- Die Entwicklung des Lebenslangen Lernens von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart
- Die Etablierung des Lebenslangen Lernens als bildungspolitisches Leitziel in Europa
- Die Umsetzung des Lebenslangen Lernens in Deutschland
- Chancen und Risiken des Lebenslangen Lernens im europäischen Kontext
- Eine kritische Würdigung des Konzepts des Lebenslangen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die Relevanz des Lebenslangen Lernens in der heutigen Gesellschaft. Sie erläutert die historische Entwicklung des Konzepts und die Bedeutung des bildungspolitischen Diskurses für dessen Etablierung.
- Kapitel 1 nähert sich dem Lebenslangen Lernen an und versucht eine Begriffsbestimmung. Es beleuchtet die verschiedenen Facetten des Begriffs und seine Bedeutung im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung.
- Kapitel 2 behandelt die Entwicklung des bildungspolitischen Konzepts des Lebenslangen Lernens auf internationaler Ebene. Es analysiert die ersten programmatischen Ansätze von Europarat, OECD und UNESCO in den 1970er Jahren sowie die Renaissance des Konzepts in den 1990er Jahren.
- Kapitel 3 fokussiert die Etablierung des Lebenslangen Lernens als bildungspolitisches Leitziel und -programm in Europa. Es analysiert die Lissabon-Vereinbarung des Europäischen Rates und das Memorandum über Lebenslanges Lernen sowie das EU-Bildungsprogramm für Lebenslanges Lernen.
- Kapitel 4 beschreibt die Umsetzung des Lebenslangen Lernens im EU-Mitgliedstaat Deutschland und beleuchtet verschiedene Programme und Fördermaßnahmen.
- Kapitel 5 untersucht Chancen und Risiken des Lebenslangen Lernens im europäischen Kontext und analysiert die Potenziale und Herausforderungen des Konzepts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept des Lebenslangen Lernens, einem zentralen Element der europäischen Bildungspolitik. Sie untersucht die historischen Entwicklungen, die Etablierung des Konzepts als Leitziel, die Umsetzung in Deutschland sowie die Chancen und Risiken des Lebenslangen Lernens im europäischen Kontext. Wichtige Themen sind die gesellschaftlichen Hintergründe, die bildungspolitische Programmatik, die verschiedenen Programme der EU und die kritische Würdigung des Konzepts.
- Quote paper
- Timo Fent (Author), 2012, Lebenslanges Lernen als bildungspolitisches Leitprogramm auf internationaler und europäischer Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207465