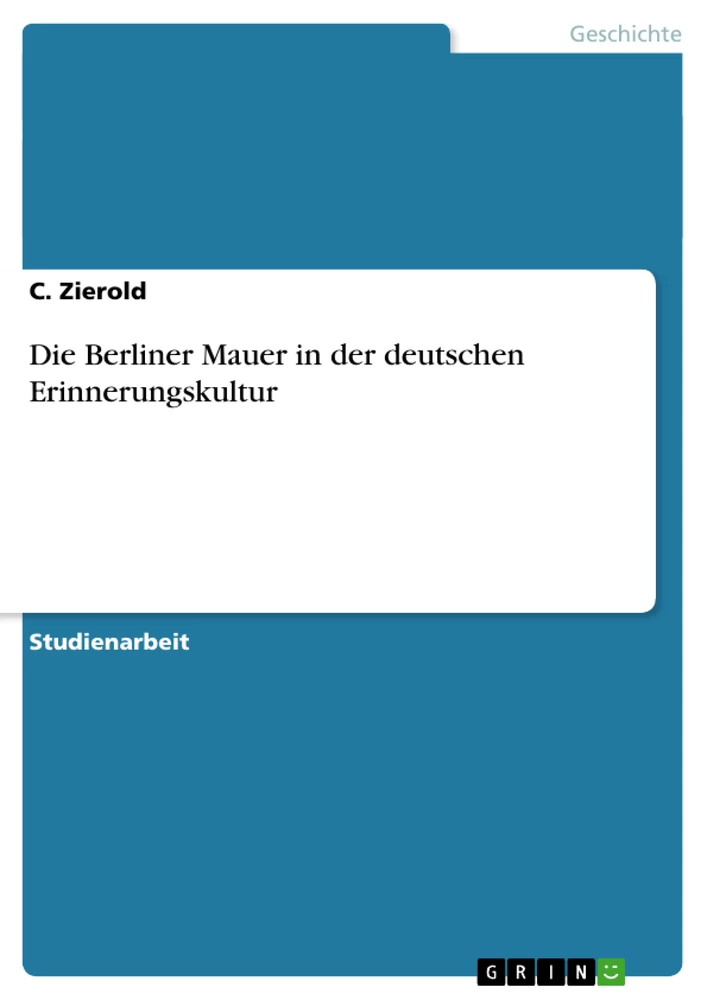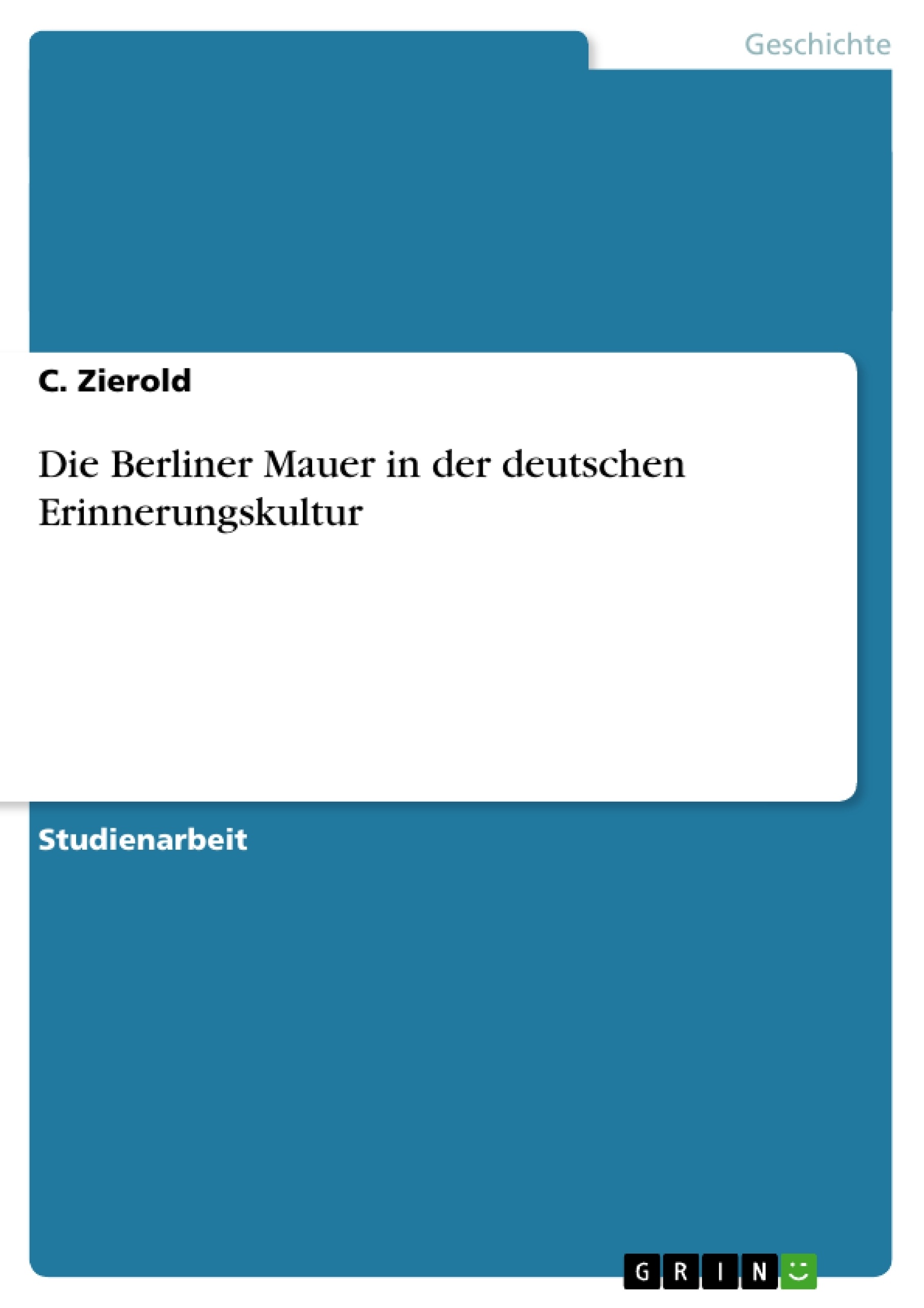Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Mauern seit jeher auf allen Teilen der Welt gebaut wurden. So wurde mit dem Bau der Chinesischen Mauer vermutlich bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. begonnen. Doch auch in der näheren Vergangenheit lassen sich Beispiele für derartige (geschichtsträchtige) Bauwerke finden. Auch wenn Größe und Aussehen der neuzeitlichen Mauerwerke deutlich von den antiken Vertretern abweichen, weisen sie doch in ihrer ursächlichen Funktion erhebliche Parallelitäten auf. So dienen sie ebenso dem Schutz vor vermeidlich fremden Menschen sowie deren Ideen und Weltanschauungen. Letzteres trifft vor allem für ein weiteres "prominentes" Beispiel zu, dass in diesem "Kanon der Mauern" gewissermaßen eine Sonderstellung einnimmt: die Berliner Mauer.
Sowohl ihr Bau am 13. August 1961 als auch ihr Fall am 9. November 1989 sind entscheidende Zäsuren der deutschen Geschichte. Doch auch aus internationalem Blickwinkel gibt es kaum ein Bauwerk, dass die Welt so nachhaltig prägte wie der Berliner Grenzwall. Schließlich war die Berliner Mauer "Ausdruck der Spaltung der Welt, [denn] "eine solche globale Konfrontation zweier verfeindeter politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Machtblöcke hat[te] es in diesem Ausmaß nie zuvor gegeben" . Unstrittig ist deshalb die Einschätzung der Mauer als nationaler -ja sogar globaler - Erinnerungsort.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Geschichte der Berliner Mauer zu beschreiben und dabei ihren "Wert" als Erinnerungs- bzw. Gedächtnisort nachzuvollziehen. Somit soll erörtert werden, woran genau erinnert bzw. wie dies umgesetzt wird? Zunächst wird dabei noch einmal auf den 13. August 1961 sowie die Ereignisse unmittelbar zuvor Bezug genommen. Im Anschluss soll auf die viel diskutierte "Mauer in den Köpfen" näher beleuchtet werden. Die in der Mauererinnerung einen besonderen Platz einnehmenden sogenannten "Maueropfer" sind Thema des darauffolgenden Abschnitts. Anschließend wird auf die Gegebenheiten des Mauerfalls im Herbst 1989 eingegangen sowie der Umgang mit der Mauer nach ihrem Fall beschrieben; bevor im sechsten Gliederungspunkt die Diskussionen um die verschiedenen Gedenkstätten, die schließlich in das "Gesamtkonzept Berliner Mauer" mündeten, thematisiert werden. Hierbei soll neben den gesellschaftlichen Aspekten auch die politische Instrumentalisierung, die im Jahre 2001 ihren Höhepunkt fand, angesprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Die Mauern der Welt
- Berlin und der 13. August 1961
- Der "antifaschistische Schutzwall"
- Ansichten aus West und Ost
- Von Mauerspringern und Maueropfern
- Der Mauerfall und die "Mauer in den Köpfen"
- Mauerrelikte und Gedenkstätten
- Schluss: Mauern sind nicht für ewig gebaut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Berliner Mauer und analysiert ihren Wert als Erinnerungs- und Gedächtnisort. Sie untersucht, woran im Zusammenhang mit der Mauer erinnert wird und wie diese Erinnerung in der Gesellschaft verankert ist.
- Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 und die Ereignisse unmittelbar davor
- Die Bedeutung der "Mauer in den Köpfen" für die deutsche Erinnerungskultur
- Das Schicksal von Mauerspringern und Maueropfern
- Der Mauerfall im Herbst 1989 und der Umgang mit der Mauer nach ihrem Fall
- Die Entwicklung von Gedenkstätten und das "Gesamtkonzept Berliner Mauer"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Mauern der Welt: Diese Einleitung stellt die Berliner Mauer in den Kontext anderer historischer Mauern und betont ihre besondere Bedeutung als globales Symbol der Trennung und Spaltung.
- Berlin und der 13. August 1961: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte des Mauerbaus und untersucht den Symbolgehalt des Datums für die deutsche Erinnerungskultur. Es beleuchtet die Ereignisse, die zum Mauerbau führten und die verschiedenen Perspektiven auf Ulbrichts berühmte Aussage, dass "niemand die Absicht hat, eine Mauer zu errichten."
- Der "antifaschistische Schutzwall": Dieses Kapitel untersucht die Ideologie und Propaganda der DDR im Hinblick auf die Mauer und die damit verbundenen Begründungen.
- Ansichten aus West und Ost: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Mauer in West- und Ostdeutschland, inklusive der Reaktionen auf den Mauerbau und die unterschiedlichen Deutungen des Symbols.
- Von Mauerspringern und Maueropfern: Dieses Kapitel behandelt das Schicksal von Menschen, die versuchten, die Mauer zu überqueren, und die Rolle der Maueropfer in der deutschen Erinnerungskultur.
- Der Mauerfall und die "Mauer in den Köpfen": Dieses Kapitel schildert die Ereignisse rund um den Mauerfall im Herbst 1989 und untersucht die Bedeutung der "Mauer in den Köpfen" für die deutsche Gesellschaft nach der Wiedervereinigung.
- Mauerrelikte und Gedenkstätten: Dieses Kapitel thematisiert den Umgang mit der Mauer nach ihrem Fall und diskutiert die Entwicklung von Gedenkstätten und die politische Instrumentalisierung der Mauer.
Schlüsselwörter
Die Berliner Mauer, Erinnerungskultur, deutsche Teilung, Kalter Krieg, Maueropfer, Mauerfall, Gedenkstätten, "Mauer in den Köpfen", Propaganda, Ideologie, politische Instrumentalisierung, Geschichtsforschung.
- Quote paper
- C. Zierold (Author), 2012, Die Berliner Mauer in der deutschen Erinnerungskultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207447