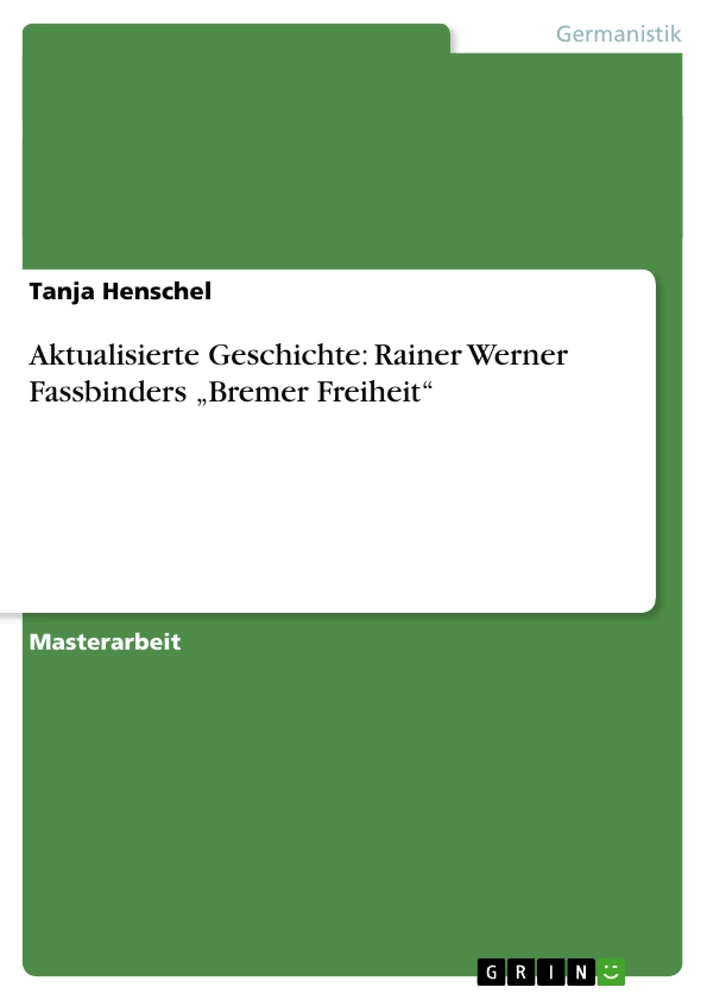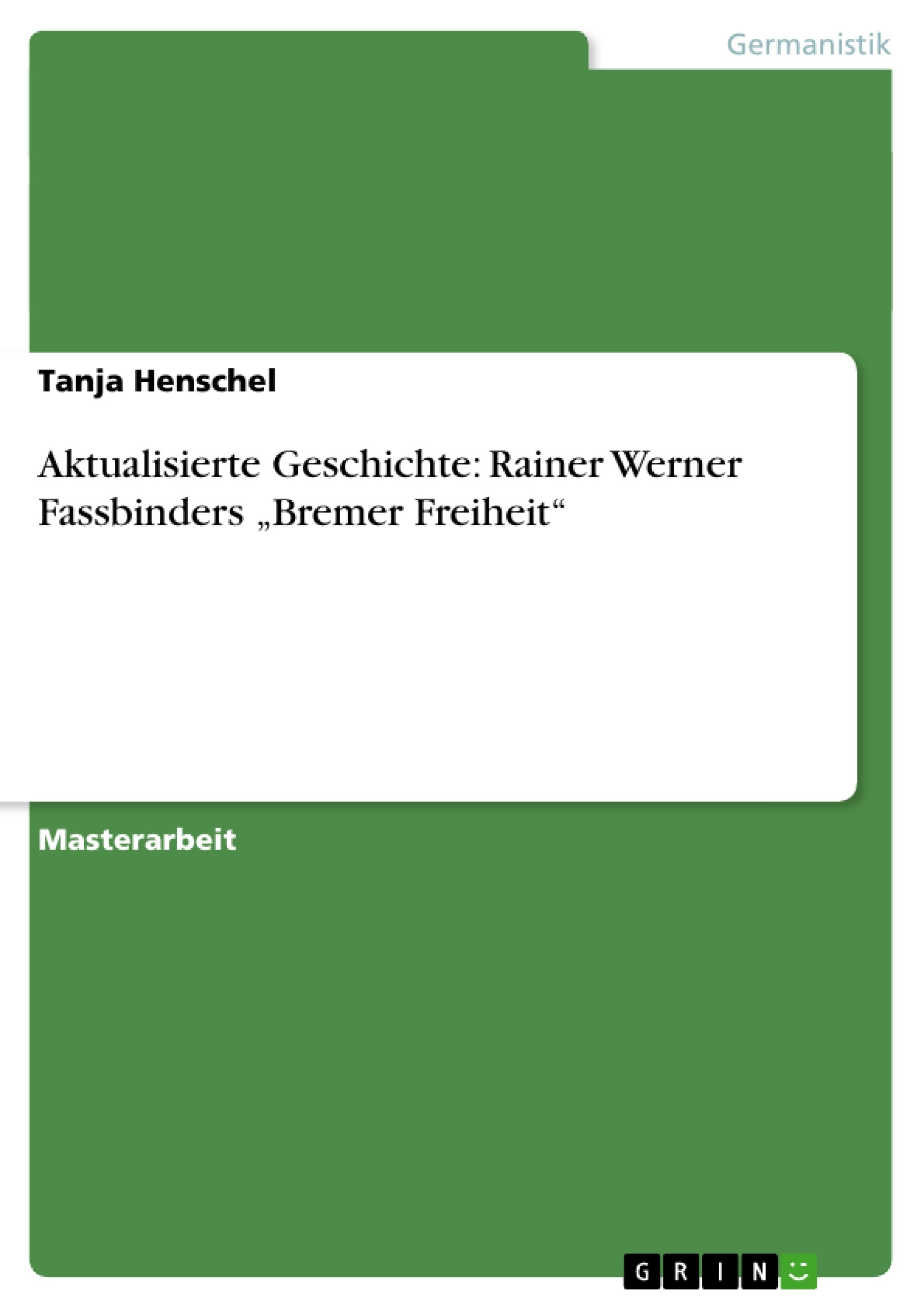Als „Engel von Bremen“ war sie allgemein in der Hansestadt bekannt: Die historische Person Gesche Gottfried wurde wegen ihrer vielen familiären Schicksalsschläge bedauert und um ihre Stärke und Standhaftigkeit bewundert. Hinter der Fassade einer sittsamen und gepflegten Bürgersfrau verbarg sich jedoch eine notorische Giftmörderin, eine Frau der Verstellung und Täuschung, die ihre engsten Verwandten und Freunde tötete. Diesen historischen Fall nimmt der Schriftsteller und Filmemacher R. W. Fassbinder in seinem Drama Bremer Freiheit wieder auf und entwirft einen „effektsicheren Bilderbogen“, eine „holzschnittartige Moritat.“ Durch die Anordnung der kurzen und schlaglichtartigen Szenen wird das Drama auf das Nötigste an Inhalt reduziert, was den Blick auf die regelgeleitete und rituelle Giftverabreichung der Protagonistin lenkt. Die Morde stellen ihren Befreiungsakt aus einer sie unterdrückenden, kleinbürgerlichen und biederen Gesellschaft dar, der sich in einem schmalen Handlungsspielraum vollzieht. Die Eingangsworte sind die Befehlsformeln, die Geesches Unfreiheit veranschaulichen und die Geschlechterrollen kontrastieren. In der folgenden Arbeit soll die Motivlage für die Mordserie geklärt und die Rolle der Frau in der Gesellschaft betrachtet werden. An Geesches Beispiel zeigen sich die Folgen der gesellschaftlichen und familiären Unterdrückung. Sie sind der Auslöser für ihre Taten im Namen der Freiheit. In diesem Zusammenhang soll beantwortet werden, inwiefern man durch Mord überhaupt Freiheit erlangen kann, und ob sich Geesche nicht sowohl vor als auch nach ihren Taten in Unfreiheit befindet. In der folgenden textanalytischen Argumentation wird deshalb zuerst eine Dramenanalyse durchgeführt, um einen Handlungsüberblick zu garantieren und eine fundierte Grundlage für die weitere Textarbeit zu schaffen. Daran schließt sich der Vergleich zwischen historischem und literarischem Fall an, dem die eingehendere Thematisierung der Gattungsfrage des Stückes folgt. Ein kurzer Seitenblick auf die verschiedenen literarischen Adaptionen des Giftmordfalles zeigt die Abgrenzung zu Fassbinders Bremer Freiheit und seine zeitgemäße Interpretation. Nun findet eine nähere Auseinandersetzung mit der Motivlage für die Taten der Protagonistin statt. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Freiheitsbegriff, in dessen Namen Geesche ihr Umfeld vergiftet. Abschließend wird die Gattungsfrage, mit Rückgriff auf den Untertitel des Dramas, wieder aufgegriffen und ein kurzes Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bremer Freiheit: Dramenanalyse
- Handlungsverlauf
- Schauplatz und Zeit: die Darstellung des offenen Raum-Zeitgefüges
- Struktur und Aufbau: die szenische Entwicklung der Mordgeschichte
- Figurenkonstellation: die Negativdarstellung von Geesche Gottfrieds Umfeld
- Auswirkungen des „antiteaters“: der Protokollcharakter in Bremer Freiheit
- Geesche Gottfried: der historische Fall und seine literarische Adaption
- Parallelen und Bezüge zum historischen Fall
- Bremer Freiheit: Anklänge an das Volksstück
- Der Fall Gesche Margarethe Gottfried im Wandel seiner literarischen Gestaltung
- Fassbinders Methode: der historische Fall - eine literarische Sozialdiagnose?
- Bremer Freiheit? - Weg in die Unabhängigkeit, Weg in das Verbrechen
- Fassbinders „bürgerliches Trauerspiel“ als aktualisierte Geschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Rainer Werner Fassbinders Drama „Bremer Freiheit“ und untersucht die Motivlage für die Mordserie der Protagonistin Geesche Gottfried. Der Fokus liegt dabei auf den Folgen der gesellschaftlichen und familiären Unterdrückung, die Geesche zu ihren Taten im Namen der Freiheit treiben. Die Arbeit hinterfragt, inwiefern Mord tatsächlich Freiheit bedeuten kann und ob Geesche sich sowohl vor als auch nach ihren Taten in Unfreiheit befindet.
- Die Folgen gesellschaftlicher und familiärer Unterdrückung für Geesche Gottfried
- Die Darstellung von Freiheit und Unfreiheit im Drama
- Die Beziehung zwischen Geesches Taten und ihrem Streben nach Freiheit
- Die Kritik an bürgerlichen Missständen in „Bremer Freiheit“
- Die Rolle der Protagonistin als Opfer und Täterin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund des Dramas „Bremer Freiheit“ vor und führt den Leser in die Thematik der gesellschaftlichen und familiären Unterdrückung der Protagonistin Geesche Gottfried ein. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Geesches Mordserie als Befreiungsakt oder als Ausdruck ihrer Unfreiheit zu verstehen ist.
Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Dramenanalyse, die sich auf die Motivlage von Geesche Gottfried, den Protokollcharakter des Dramas und die Figurenkonstellation konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Geesches Abgrenzung von ihrem Umfeld und der Nachvollziehbarkeit ihrer Motive.
Das dritte Kapitel setzt sich mit dem historischen Fall von Gesche Gottfried auseinander und beleuchtet Parallelen und Bezüge zwischen der historischen Person und der literarischen Figur. Es wird die Gattung des Volksstücks im Kontext von „Bremer Freiheit“ diskutiert und die verschiedenen literarischen Adaptionen des Giftmordfalls betrachtet.
Das vierte Kapitel untersucht Fassbinders Methode, den historischen Fall als eine literarische Sozialdiagnose zu nutzen. Es analysiert Geesches Weg in die Unabhängigkeit und in das Verbrechen sowie die Bedeutung von Fassbinders „bürgerlichem Trauerspiel“ als aktualisierte Geschichte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: „Bremer Freiheit“, „Gesche Gottfried“, „Mord“, „Freiheit“, „Unfreiheit“, „gesellschaftliche Unterdrückung“, „familiäre Unterdrückung“, „Volksstück“, „Sozialdiagnose“.
- Citar trabajo
- Tanja Henschel (Autor), 2012, Aktualisierte Geschichte: Rainer Werner Fassbinders „Bremer Freiheit“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207312