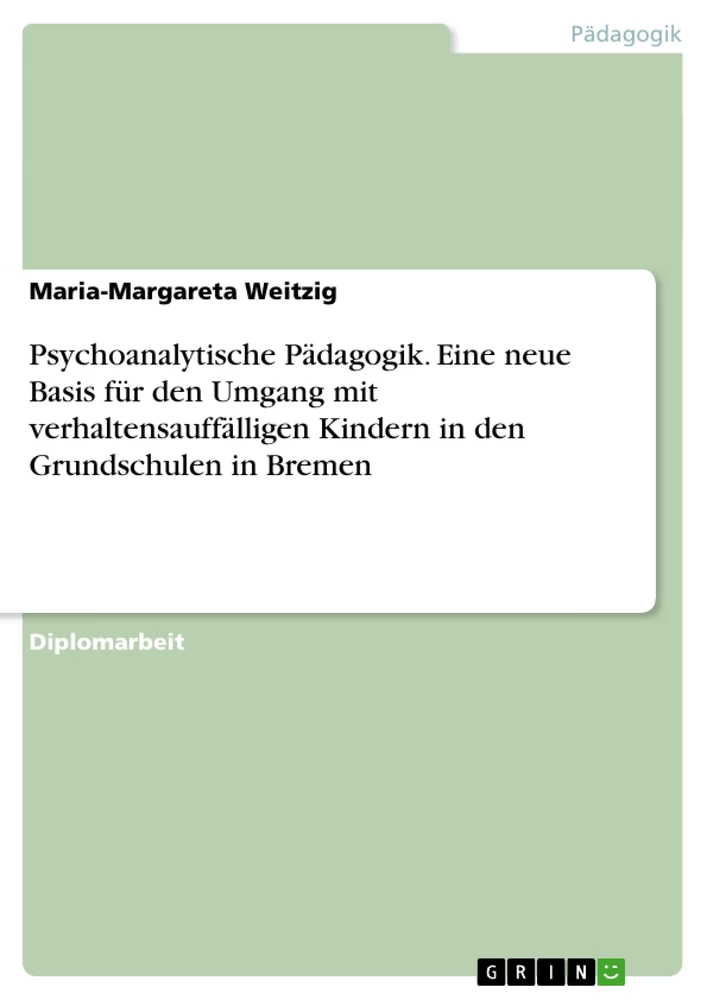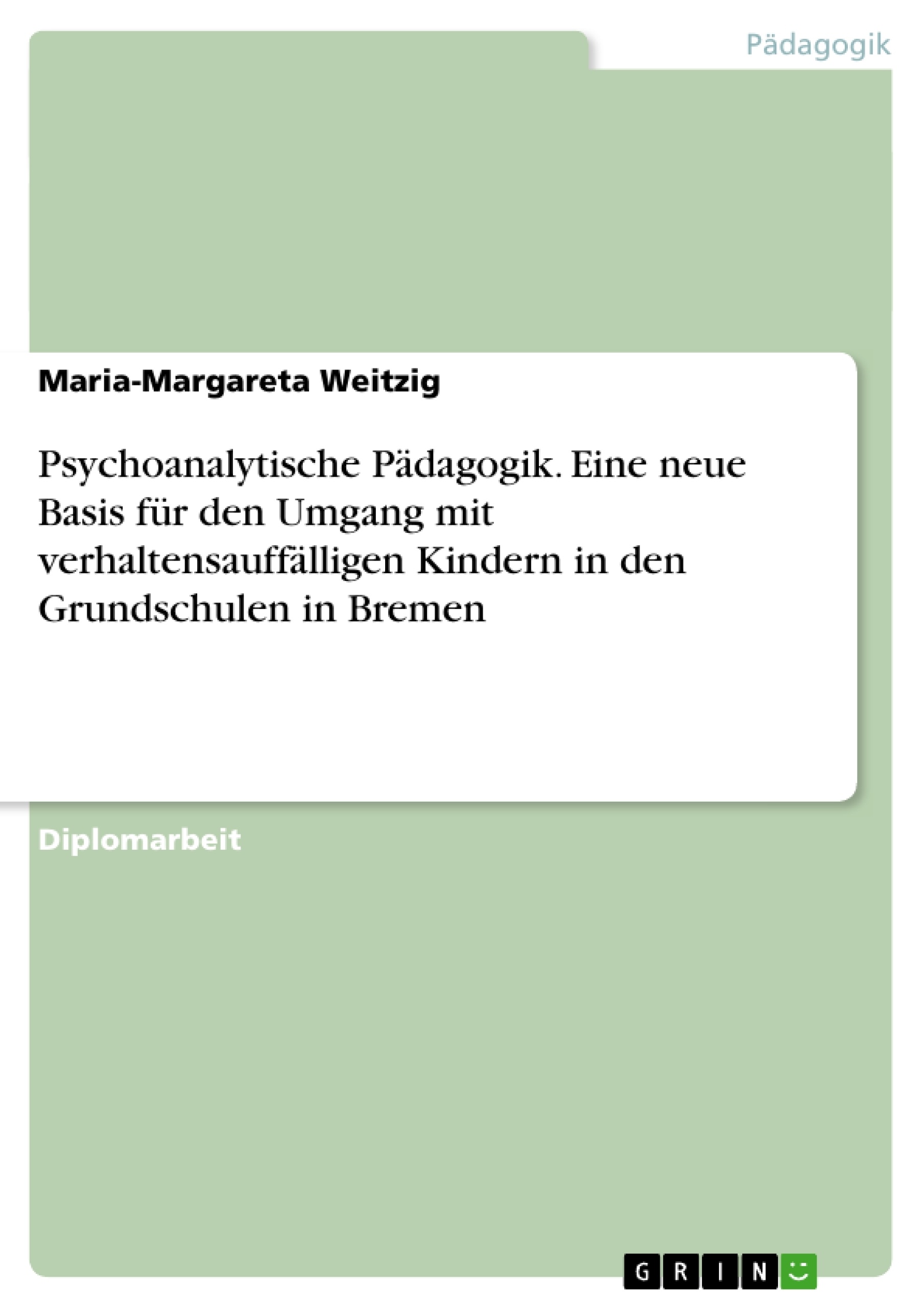Die Arbeit greift eine aktuelle Diskussion auf. Hat die PISA-Debatte für die Veränderung von Lern- und Lehrprozessen in Schulen sensibilisiert, so wird hier die Frage nach einer Verbesserung der Betreuung von SchülerInnen gestellt, die nur unter grossen „Problemen“ und Schwierigkeiten die Regelschule besuchen können. Dabei stehen für die Autorin weniger organisatorische oder bildungspolitische Konzepte der Verbesserung von Lehre im Vordergrund, sondern wie die konkrete pädagogische Arbeit und Beziehung der Lehrenden mit den SchülerInnen durch eine professionelle Arbeit sinnvoll gefördert werden kann.
Die Autorin beschäftigt sich mit der Bedeutung von Konzepten psychoanalytischer Pädagogik für die Betreuung, Förderung und Erziehung verhaltensauffälliger und entwicklungsgestörter Kinder insbesonders in schulischen Arrangements. Ausgangspunkt der Betrachtung ist dabei, dass Soziale Arbeit ihren Auftrag nur über zielgerichtetes, fachliches, reflexives und selbstreflexives Handeln erfüllen kann, und dass pädagogisches Handeln nur dann erfolgreich sein kann wenn der Pädagoge über ein fundiertes Wissen über seinen „Gegenstand“, im Anwendungsfall dieser Arbeit also über Wissen über die Kinder, ihre Biographien und Lerngeschichten, mit denen er/sie es zu tun hat, verfügt. Ein zweiter Ausgangspunkt sind Zweifel daran, dass Schulen und andere Pädagogische Institutionen über ein solches handlungsbezogenes Wissen verfügen und zu zielorientiertem Handeln in der Lage sind. Prämisse und Setzung von Margareta Weitzig ist, dass die psychoanalytische Pädagogik und psychoanalytisch gebildetes Denken eine Basis für Verstehensprozesse bietet und zielgerichtetes „gegenstandsbezogenes“ pädagogisches Handeln anzuleiten vermag.
Nach der Einleitung in der die Fragestellung entfaltet und begründet wird, setzt sich Margareta Weitzig in vier Kapiteln mit theoretischen Grundlagen und Begründungszusammenhängen auseinander, analysiert in einem weiteren Kapitel die Tragfähigkeit und Fruchtbarkeit ihres Ansatzes über ein exemplarisches Fallbeispiel zum Umgang mit auffälligem Verhalten in dem theoretischer Anspruch und Begründungszusammenhänge, kozeptionelle Umsetzung und Realisierung zusammengebracht werden. Schliesslich wird in einer Schlussbetrachtung der Ertrag der Arbeit reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sonderpädagogik
- Das neue Bremer Schulgesetz in Hinblick auf Sonderpädagogische Förderung
- Geänderte Anforderungen an Schule
- Schule als Institution
- Kurzer Abriss der Psychoanalyse
- Entwicklung
- Gemeinsame Grundüberzeugungen der verschiedenen Schulrichtungen
- Theoretische Grundbegriffe und Verfahren der Psychoanalyse als Therapie
- Die analytische Situation
- Indikation
- Ausbildung der Analytiker
- Psychoanalytische Pädagogik
- Definition
- Geschichte und Entwicklung der Psychoanalytischen Pädagogik
- Standortfrage
- Veränderungserfordernisse an die integrative Pädagogik
- Ausbildung der Lehrer
- Die Schüler- Lehrer Beziehung
- Supervision
- Exemplarisches Fallbeispiel zum Umgang mit auffälligem Verhalten
- Betreuung des Schülers Murat
- Schuleintritt als Konfliktsituation in der Sozialisation der Kinder von türkischen Migranten
- Einbeziehung des familiären Umfeldes
- Symptomverständnis
- Beziehungsgestaltung
- Gewalt und Aggression
- Vorgehen
- Handlungskompetenz
- Teamarbeit
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Psychoanalyse für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern in Grundschulen in Bremen zu beleuchten. Sie argumentiert, dass ein psychoanalytisches Verständnis die Grundlage für eine andere Form pädagogischen Handelns bietet, die über ein rein kognitives Modell hinausgeht. Die Arbeit will aufzeigen, wie ein analytischer Prozess durch die Entdeckung der „Botschaft“ hinter Auffälligkeiten zu sinnvollen Veränderungen und Entwicklungen führen kann.
- Das neue Bremer Schulgesetz und die Anforderungen an die Integrationspädagogik
- Die Bedeutung des psychoanalytischen Ansatzes für das Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten
- Die Rolle der Beziehungsgestaltung in der psychoanalytischen Pädagogik
- Die Notwendigkeit der Supervision für Lehrkräfte im Umgang mit schwierigen Situationen
- Die Umsetzung der psychoanalytischen Pädagogik anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Problemstand, der sich aus dem Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern in Schulen ergibt. Die Notwendigkeit eines vertieften Gegenstandsverständnisses in der Integrationspädagogik wird hervorgehoben.
Das Kapitel „Sonderpädagogik“ beleuchtet das neue Bremer Schulgesetz und die veränderten Anforderungen an Schulen im Hinblick auf die Integration von Kindern mit Förderbedarf.
Der Abschnitt „Psychoanalyse“ bietet einen Überblick über die Entwicklung und die zentralen theoretischen Grundbegriffe der Psychoanalyse.
Das Kapitel „Psychoanalytische Pädagogik“ definiert den Begriff und beschreibt die Geschichte und Entwicklung des Ansatzes. Die Standortfrage der Psychoanalytischen Pädagogik im Kontext der Integrationspädagogik wird behandelt.
Das Kapitel „Veränderungserfordernisse an die integrative Pädagogik“ fokussiert auf die Ausbildung der Lehrer, die Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung und die Notwendigkeit von Supervision.
Das Kapitel „Exemplarisches Fallbeispiel zum Umgang mit auffälligem Verhalten“ präsentiert ein konkretes Fallbeispiel, in dem verschiedene Aspekte der psychoanalytischen Pädagogik im Kontext der Betreuung eines Schülers dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Psychoanalytische Pädagogik, Integrationspädagogik, Verhaltensauffälligkeiten, Lernbehinderung, Schüler-Lehrer-Beziehung, Supervision, Fallbeispiel, Bremer Schulgesetz, Entwicklungsgefährdung, soziales Umfeld, Familienstrukturen, Migrationshintergrund.
- Quote paper
- Maria-Margareta Weitzig (Author), 2002, Psychoanalytische Pädagogik. Eine neue Basis für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern in den Grundschulen in Bremen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20725