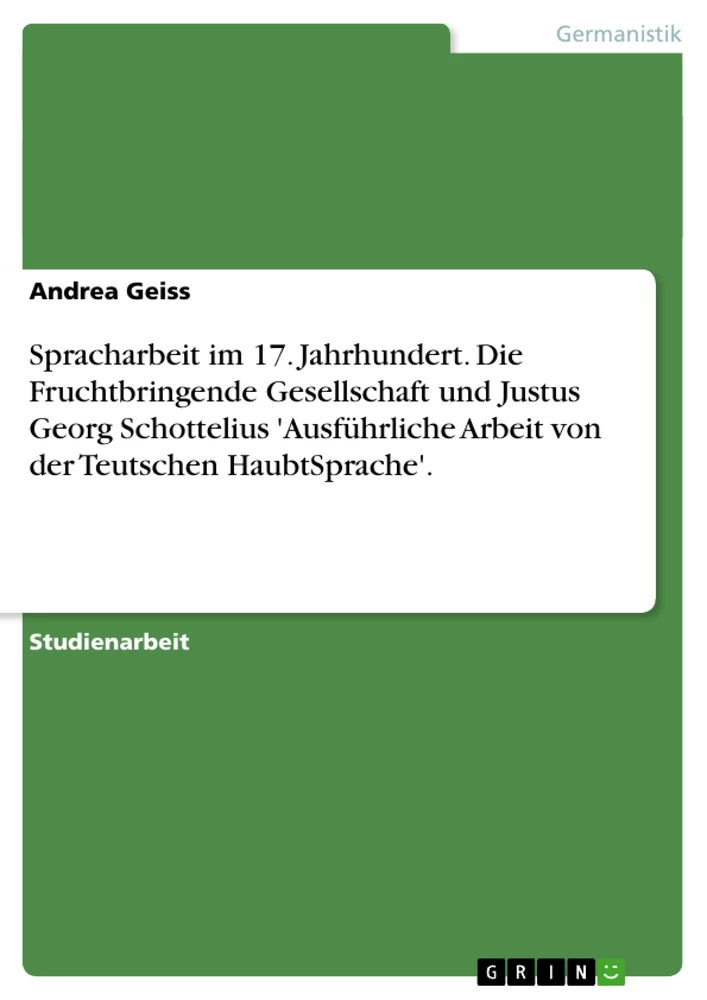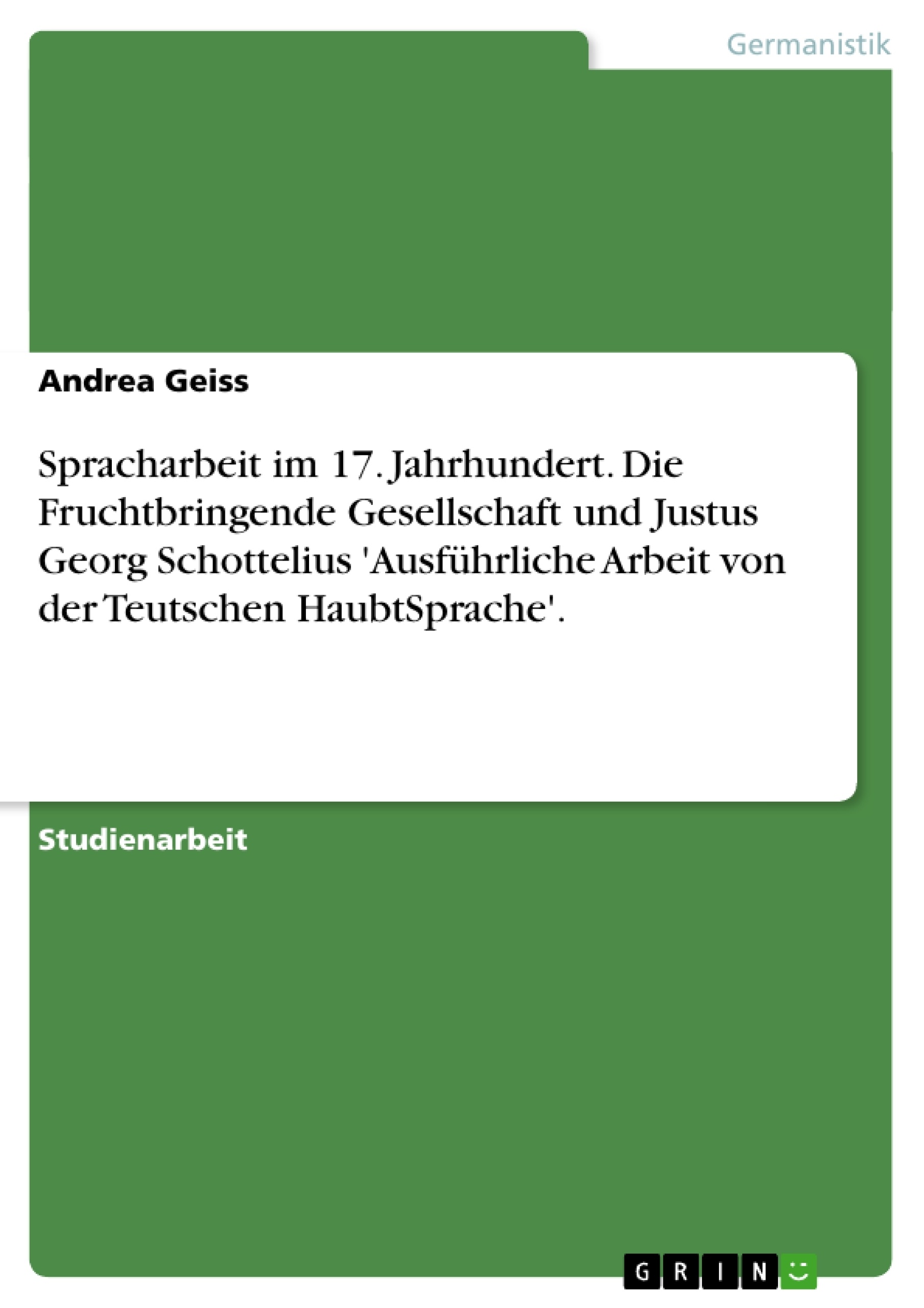[...] Diese Ansichten sind
heute überholt. Die neuere Literaturforschung relativierte die überspitzten
Darstellungen und erkannte die vorrangige Zielsetzung der Gesellschaft in dem
Versuch, deutsche Kultur, Literatur und Sprache im Vergleich zu anderen (damals in
diesen Bereichen überlegenen) europäischen Länden zu stärken. Diese Aufgabe
haben ihre Mitglieder auf äußerst vielfältige Weise zu bewältigen versucht. Die
vorliegende Arbeit möchte die unterschiedlichen Wege aufzeigen, die die
Fruchtbringende Gesellschaft im Rahmen der ‚Spracharbeit’ gegangen ist.
Jedes der drei Oberhäupter der Gesellschaft prägte ihr Wesen sehr stark. Das erste
Oberhaupt und Gründungsmitglied Fürst Ludwig zu Anhalt-Köthen legte größten
Wert auf die konfessionelle und ständische Offenheit der Vereinigung. Nach seinem
Tod im Jahre 1650 wandelte sich die Struktur der Gesellschaft unter dem Oberhaupt
Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar mehr in Richtung eines Ritterordens. Ihre
Bedeutung in literarischen und poetologischen Belangen nahm ab. Deshalb
konzentriert sich diese Hausarbeit auf die Struktur und die konkrete ‚Spracharbeit’
der Fruchtbringenden Gesellschaft unter Fürst Ludwig, also von 1617-1650.
Die Fruchtbringende Gesellschaft selbst hat keine programmatischen Schriften, etwa
Grammatiken oder Poetiken, herausgegeben. (Wenn man von dem Hauptwerk von
Christian Gueintz: „Teutscher Sprachle hre Entwurf“ (1641) absieht. In gewisser
Weise kann es als Gemeinschaftswerk der Fruchtbringenden Gesellschaft gelten, da
es von Fürst Ludwig in Auftrag gegeben wurde und wie üblich vor dem Druck durch
die Hände vieler Mitglieder ging.) In sprachtheoretischer Hinsicht produktiv waren
vor allem gelehrte Mitglieder bürgerlicher Herkunft. Zu nennen sind hier etwa
Augustus Buchner, der bereits erwähnte Christian Gueintz, Georg Philipp
Harsdörffer und Justus Georg Schottelius.
Auf den Letztgenannten will diese Arbeit ebenfalls eingehen. An seiner
‚Ausführlichen Arbeit von der Teutschen HaubtSprache’ lassen sich die typischen
Legitimations-strategien der Spracharbeiter für die Verwendung der deutschen
Sprache aufzeigen. Stimmen Schottelius’ Ansichten auch nicht in allen Details mit
jenen der Fruchtbringenden Gesellschaft überein, so kann sein Hauptwerk in seiner
Argumentation trotzdem als exemplarisch gelten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorrangstellung von Latein und Französisch
- Gründung der Fruchtbringenden Gesellschaft nach europäischen Vorbildern
- Offenheit in religiöser und ständischer Hinsicht
- Keine generelle Verteufelung von Fremdwörtern
- Die Übersetzungsarbeit
- Die Leistungen der Fruchtbringenden Gesellschaft
- Justus Georg Schottelius
- Rhetorische Prägung der 'Ausführlichen Arbeit'
- Hohes Alter der deutschen Sprache
- 'Natürlichkeit der deutschen Sprache
- Stammwörter
- Analogisten Anomalisten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die "Spracharbeit" der Fruchtbringenden Gesellschaft, insbesondere unter dem ersten Oberhaupt, Fürst Ludwig zu Anhalt-Köthen (1617-1650). Im Fokus steht die Bemühung, die deutsche Sprache und Kultur im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zu stärken. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Wege, die die Gesellschaft zur Förderung der deutschen Sprache beschritt, und setzt diese in Bezug zu den zeitgenössischen Sprachnormen und -debatten.
- Die Vorrangstellung von Latein und Französisch im 17. Jahrhundert und die Herausforderungen für die deutsche Sprache
- Die Gründung und die Ziele der Fruchtbringenden Gesellschaft
- Die "Spracharbeit" der Gesellschaft: Sprachreform, Lexikographie, Übersetzung
- Die Rolle von Justus Georg Schottelius und seiner "Ausführlichen Arbeit von der Teutschen HaubtSprache" in der Sprachdebatte des 17. Jahrhunderts
- Die Bedeutung der Fruchtbringenden Gesellschaft für die deutsche Sprachgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über den Kontext der "Spracharbeit" der Fruchtbringenden Gesellschaft im 17. Jahrhundert. Dabei wird die Vorrangstellung von Latein und Französisch im Bereich der Verwaltung, Kultur und Wirtschaft in Deutschland betont. Diese Sprachen repräsentierten die Kultur- und Oberschicht und stellten die deutsche Sprache vor Herausforderungen.
Die Arbeit stellt dann die Gründung der Fruchtbringenden Gesellschaft vor und untersucht ihre Ziele und Methoden der Sprachförderung. Die Gesellschaft setzte sich für eine stärkere Anerkennung der deutschen Sprache und Kultur im europäischen Vergleich ein und versuchte, die deutsche Sprache durch Sprachreform, Lexikographie und Übersetzung zu stärken.
Im Anschluss wird die Arbeit von Justus Georg Schottelius und seiner "Ausführlichen Arbeit von der Teutschen HaubtSprache" beleuchtet. Schottelius' Werk wird als ein Beispiel für die Legitimationsstrategien der Spracharbeiter des 17. Jahrhunderts betrachtet, die die deutsche Sprache als eigenständige und gleichwertige Sprache gegenüber anderen europäischen Sprachen zu etablieren suchten.
Die Arbeit gipfelt in einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einer Bewertung der Bedeutung der Fruchtbringenden Gesellschaft für die deutsche Sprachgeschichte.
Schlüsselwörter
Die Fruchtbringende Gesellschaft, deutsche Sprache, Spracharbeit, Sprachreform, Lexikographie, Übersetzung, Justus Georg Schottelius, "Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache", Latein, Französisch, Kulturpatriotismus, 17. Jahrhundert.
- Quote paper
- Andrea Geiss (Author), 2003, Spracharbeit im 17. Jahrhundert. Die Fruchtbringende Gesellschaft und Justus Georg Schottelius 'Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache'., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20712