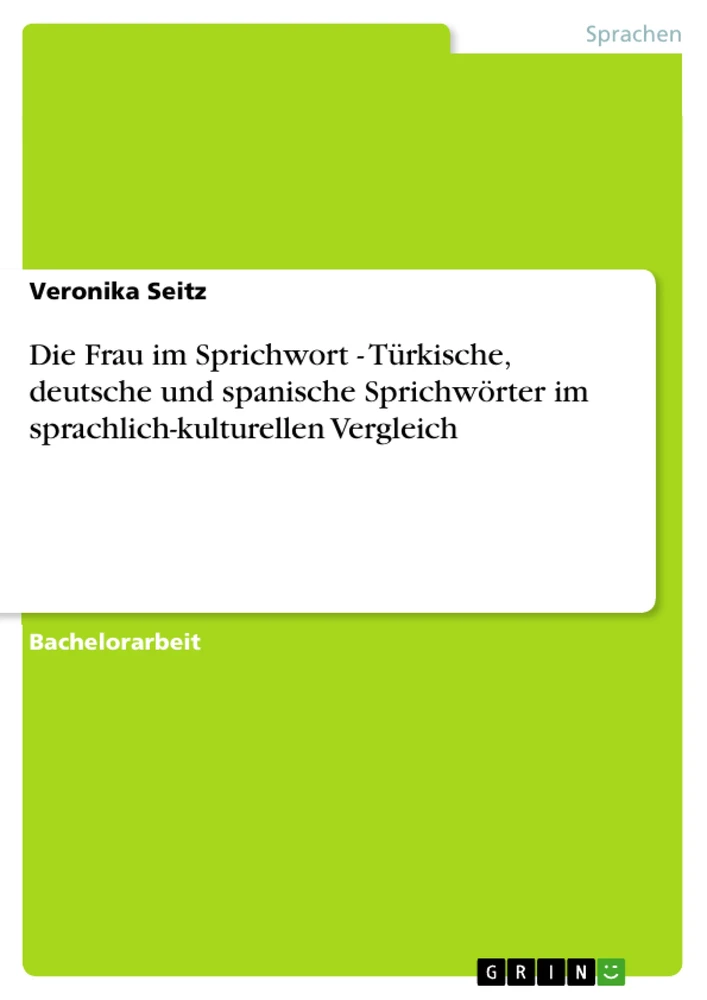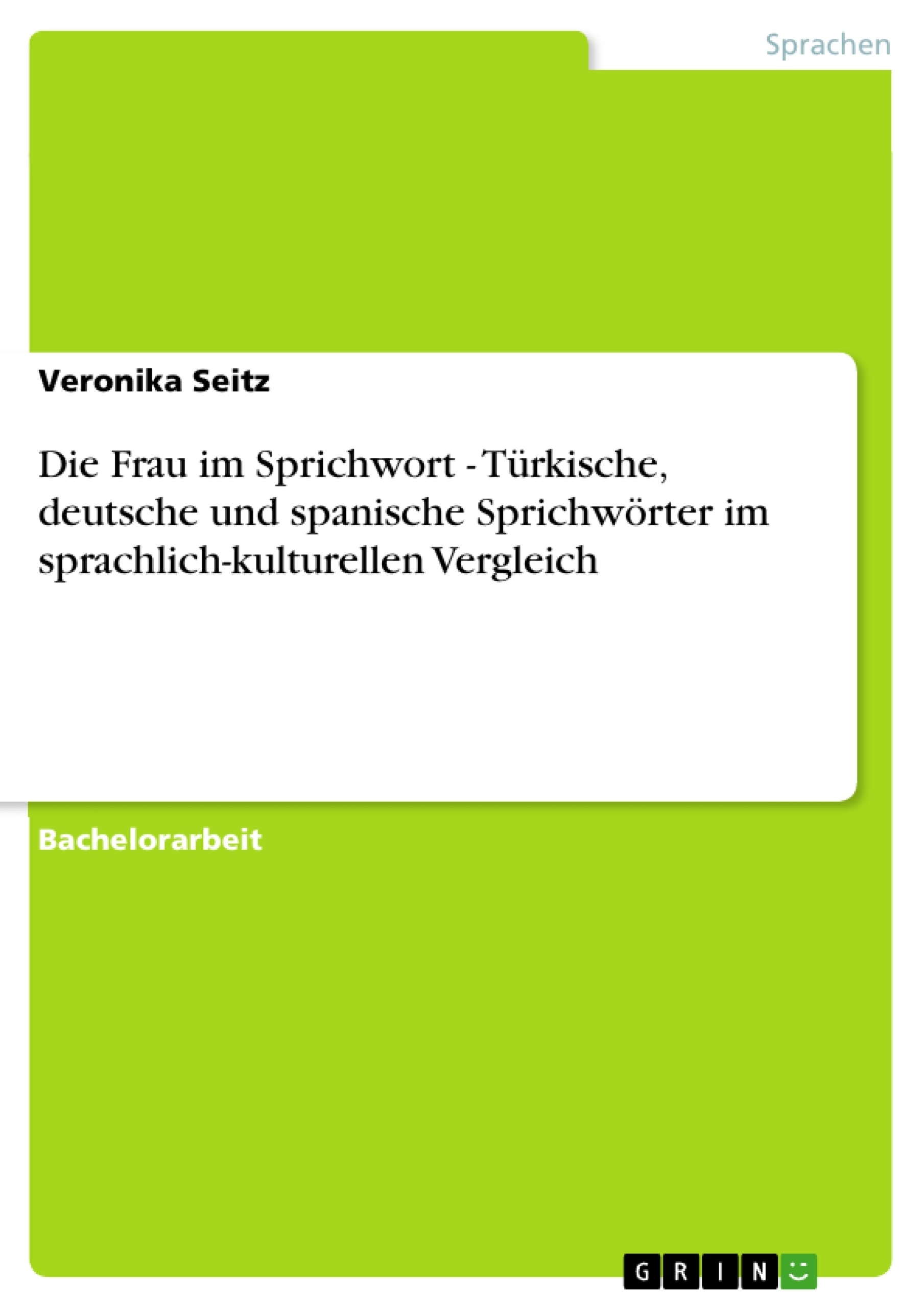Im Sprachgebrauch vom Mittelalter bis in die Blütezeit des Sprichworts im 15. und 16. Jahrhundert gibt es geschlechterspezifische Sprichwörter mehrheitlich für Frauen. Sie weisen (pädagogische) Regelhaftigkeit auf und porträtieren Eigenschaften und typisches Verhalten der Frau Wie relevant sind diese aus vergangenen Jahrhunderten stammenden Lebensregeln heute noch?
Formale Grundlagen der Arbeit am sprachlich-kulturellen Vergleich sind eine präzise Definition des Terminus Sprichwort, sein Forschungskontext und eine sinnvolle Klassifikation für den notwendigen Forschungskorpus.
Die Arbeit sucht Antworten auf die Fragen: Inwiefern beeinflussen sich Sprache und Kultur gegenseitig? Was sagt der Sprachgebrauch aus über die Kultur eines Landes? Was können Sprichwörter zu einem bestimmten Thema über die Kultur eines Landes aussagen? Können sie etwas aussagen? Welche Parallelen und Unterschiede ergeben sich bei einem Vergleich hinsichtlich ihrer Struktur, ihrer spezifischen Thematik und ihrer Metaphorik? Was für ein Frauenbild lässt sich auf der Grundlage der ausgewählten Sprichwörter erstellen? Diese Fragen werden im folgenden sprachlich-kulturellen Vergleich der türkischen, spanischen und deutschen Sprichwörter über Frauen untersucht. Die primär linguistische Arbeit besteht aus den beiden Hauptteilen Theorie und Empirie.
Der Begriffsklärung des Wortfelds Sprichwort und einem Einblick in den derzeitigen Stand der Forschung folgt eine typologische Einordnung der drei Sprachen und, wie Sexus bzw. Geschlechterstereotypen in den drei Sprachen dargestellt werden. Welche Sprichworttraditionen weisen die drei Länder auf? (Inwieweit) Kann man von der Sprache bzw. den Sprichwörtern im Besonderen auf die Kultur eines Landes schließen?
Im zweiten Teil erfolgt die Klassifizierung der Sprichwörter im erarbeiteten Forschungkorpus und die Analyse der türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörter hinsichtlich Struktur, Thematik und verwendeter Bilder.
Bereits in den fünfziger Jahren regte der finnische Parömiologe Matti Kuusi zu dem Vergleich der Phraseologismen sehr unterschiedlicher Sprachen an: „Es wäre vermutlich fruchtbarer, den Schatz der Redensarten zweier voneinander entfernter Völker zu vergleichen als geringe und mehrdeutige Charakterunterschiede zwischen den Redensarten zweier Nachbarvölker finden zu wollen.“ (Kuusi 1957: 51) Mit dem Vergleich türkischer, deutscher und spanischer Sprichwörter möchte ich dieser Anregung nachkommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Aspekte
- 2.1. Idiomatizität - Phraseologie - Parömiologie
- 2.2. Definition des Terminus Sprichwort
- 2.3. Stand der Forschung
- 2.4. Aspekte der drei Sprachen
- 2.4.1. Typologische Einordnung
- 2.4.2. „Frau“ in der Sprache: Sexus und Geschlechterstereotypen
- 2.4.2.1. Türkisch - Sprache ohne grammatisches Geschlecht
- 2.4.2.2. Problematik des generischen Maskulinums im Deutschen
- 2.4.2.3. Sexus und Geschlechterstereotypen im Spanischen
- 2.4.3. Sprichwortsammlungen und Überlieferung der Sprichwörter
- 2.4.3.1. Sprichworttradition im Türkischen
- 2.4.3.2. Deutsche Sprichworttradition
- 2.4.3.3. Das spanische Sprichwort im (geschichtlichen) Gebrauch
- 2.4.3.4. Problem der Ahistorizität der Sammlungen
- 2.5. Wechselwirkung von Sprache und Kultur
- 3. Empirischer Teil: Frauen in den Sprichwörtern
- 3.1. Prämissen
- 3.2. Methode zur Klassifizierung: Matti Kuusi type system of proverbs
- 3.3. Erläuterung des Forschungs-Korpus
- 3.4. Analyse der Sprichwörter
- 3.4.1. Analyse der türkischen Sprichwörter
- 3.4.1.1. Strukturelle Analyse
- 3.4.1.2. Thematische Analyse
- 3.4.1.3. Analyse der Bilder (Images)
- 3.4.2. Analyse der deutschen Sprichwörter
- 3.4.2.1. Strukturelle Analyse
- 3.4.2.2. Thematische Analyse
- 3.4.2.3. Analyse der Bilder (Images)
- 3.4.3. Analyse der spanischen Sprichwörter
- 3.4.3.1. Strukturelle Analyse
- 3.4.3.2. Thematische Analyse
- 3.4.3.3. Analyse der Bilder (Images)
- 3.5. Vergleich oder Kontrast: Ergebnisse der Analyse
- 4. Fazit
- 5. Quellenverzeichnis
- 6. Anhang (Forschungskorpus)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die sprachliche Darstellung von Frauen in türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörtern. Ziel ist ein sprachlich-kultureller Vergleich, der die unterschiedlichen Frauenbilder in den jeweiligen Kulturen aufzeigt. Die Arbeit analysiert die Sprichwörter strukturell, thematisch und hinsichtlich ihrer Bildlichkeit.
- Definition und Abgrenzung des Sprichwortbegriffs
- Typologische Einordnung und Vergleich der drei Sprachen (Türkisch, Deutsch, Spanisch)
- Analyse der Geschlechterstereotypen in den Sprichwörtern
- Vergleich der Sprichworttraditionen in den drei Ländern
- Auswirkungen von Sprache und Kultur auf die Darstellung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Relevanz von Sprichwörtern über Frauen als "Frauenspiegel des Volksmunds" in der heutigen Zeit. Sie beschreibt die formalen und inhaltlichen Probleme des sprachlich-kulturellen Vergleichs und skizziert die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beinhaltet die Definition zentraler Begriffe wie Idiomatik, Phraseologie und Parömiologie, sowie einen Überblick über den Forschungsstand und die typologische Einordnung der drei untersuchten Sprachen. Im empirischen Teil erfolgt die Analyse des Forschungskorpus, bestehend aus türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörtern zum Thema Frauen.
2. Theoretische Aspekte: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Analyse. Es definiert und grenzt die zentralen Fachbegriffe Idiomatik, Phraseologie und Parömiologie ab und klärt den Begriff des Sprichwortes. Es bietet einen Überblick über den Stand der Forschung und beleuchtet sprachliche und kulturelle Unterschiede im Umgang mit Sexus und Geschlechterstereotypen in den drei untersuchten Sprachen. Weiterhin beschreibt es die Sprichworttraditionen der drei Länder und die verwendeten Sprichwortsammlungen, wobei die Problematik der Ahistorizität dieser Sammlungen thematisiert wird. Abschließend wird die Wechselwirkung von Sprache und Kultur und die Möglichkeit, aus Sprichwörtern auf die Kultur eines Landes zu schließen, diskutiert.
3. Empirischer Teil: Frauen in den Sprichwörtern: Dieser Teil der Arbeit erläutert die Methodik der Klassifizierung der Sprichwörter und stellt den erstellten Forschungskorpus vor. Es folgt die Analyse der türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörter anhand von Struktur, Thematik und Bildlichkeit. Der Vergleich der Ergebnisse soll schließlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Frauenbilder in den drei Kulturen herausarbeiten. Die Arbeit orientiert sich an dem Ansatz von Matti Kuusi, der den Vergleich von Phraseologismen verschiedener Sprachen empfiehlt.
Schlüsselwörter
Sprichwörter, Frauenbild, Sprachlicher Vergleich, Türkisch, Deutsch, Spanisch, Kultur, Geschlechterstereotypen, Idiomatik, Phraseologie, Parömiologie, Matti Kuusi, Strukturanalyse, Thematische Analyse, Bildanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Sprachliche Darstellung von Frauen in türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörtern
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die sprachliche Darstellung von Frauen in Sprichwörtern des Türkischen, Deutschen und Spanischen. Sie führt einen sprachlich-kulturellen Vergleich durch, um die unterschiedlichen Frauenbilder in diesen Kulturen aufzuzeigen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert die Sprichwörter strukturell, thematisch und hinsichtlich ihrer Bildlichkeit. Die Methodik der Klassifizierung der Sprichwörter orientiert sich an dem Ansatz von Matti Kuusi, der den Vergleich von Phraseologismen verschiedener Sprachen empfiehlt.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Sprichwörter aus dem Türkischen, Deutschen und Spanischen.
Welche Aspekte der Sprichwörter werden analysiert?
Die Analyse umfasst die strukturelle, thematische und bildliche Ebene der Sprichwörter.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Definition und Abgrenzung zentraler Fachbegriffe wie Idiomatik, Phraseologie und Parömiologie. Sie berücksichtigt den aktuellen Forschungsstand und beleuchtet sprachliche und kulturelle Unterschiede im Umgang mit Sexus und Geschlechterstereotypen in den drei untersuchten Sprachen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst die Definition zentraler Begriffe, einen Überblick über den Forschungsstand und die typologische Einordnung der drei Sprachen. Der empirische Teil beinhaltet die Analyse des Forschungskorpus (türkische, deutsche und spanische Sprichwörter zum Thema Frauen).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist ein sprachlich-kultureller Vergleich, der die unterschiedlichen Frauenbilder in den jeweiligen Kulturen aufzeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprichwörter, Frauenbild, Sprachlicher Vergleich, Türkisch, Deutsch, Spanisch, Kultur, Geschlechterstereotypen, Idiomatik, Phraseologie, Parömiologie, Matti Kuusi, Strukturanalyse, Thematische Analyse, Bildanalyse.
Wie wird der Forschungskorpus beschrieben?
Der Forschungskorpus besteht aus türkischen, deutschen und spanischen Sprichwörtern zum Thema Frauen. Die Arbeit erläutert im empirischen Teil detailliert die Methodik der Erstellung und Auswahl des Korpus.
Welche Probleme werden in der Arbeit thematisiert?
Die Arbeit thematisiert die Problematik der Ahistorizität von Sprichwortsammlungen und die Herausforderungen des sprachlich-kulturellen Vergleichs.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Fazit der Arbeit zusammengefasst und beziehen sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Frauenbilder in den drei untersuchten Kulturen, basierend auf der Analyse der Sprichwörter.
- Quote paper
- Veronika Seitz (Author), 2008, Die Frau im Sprichwort - Türkische, deutsche und spanische Sprichwörter im sprachlich-kulturellen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207089