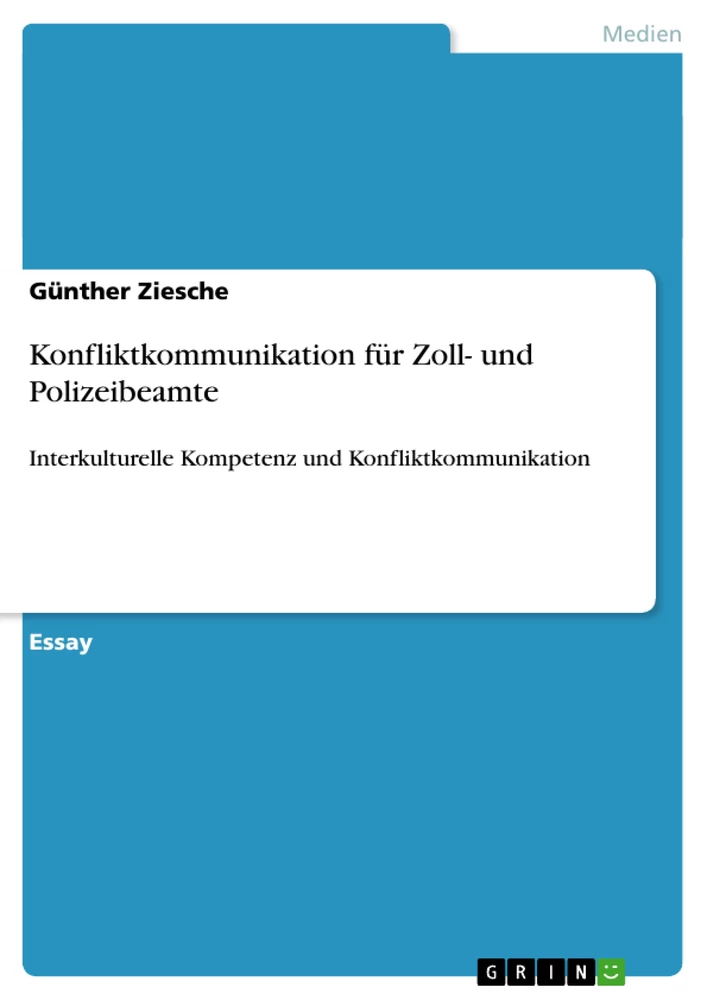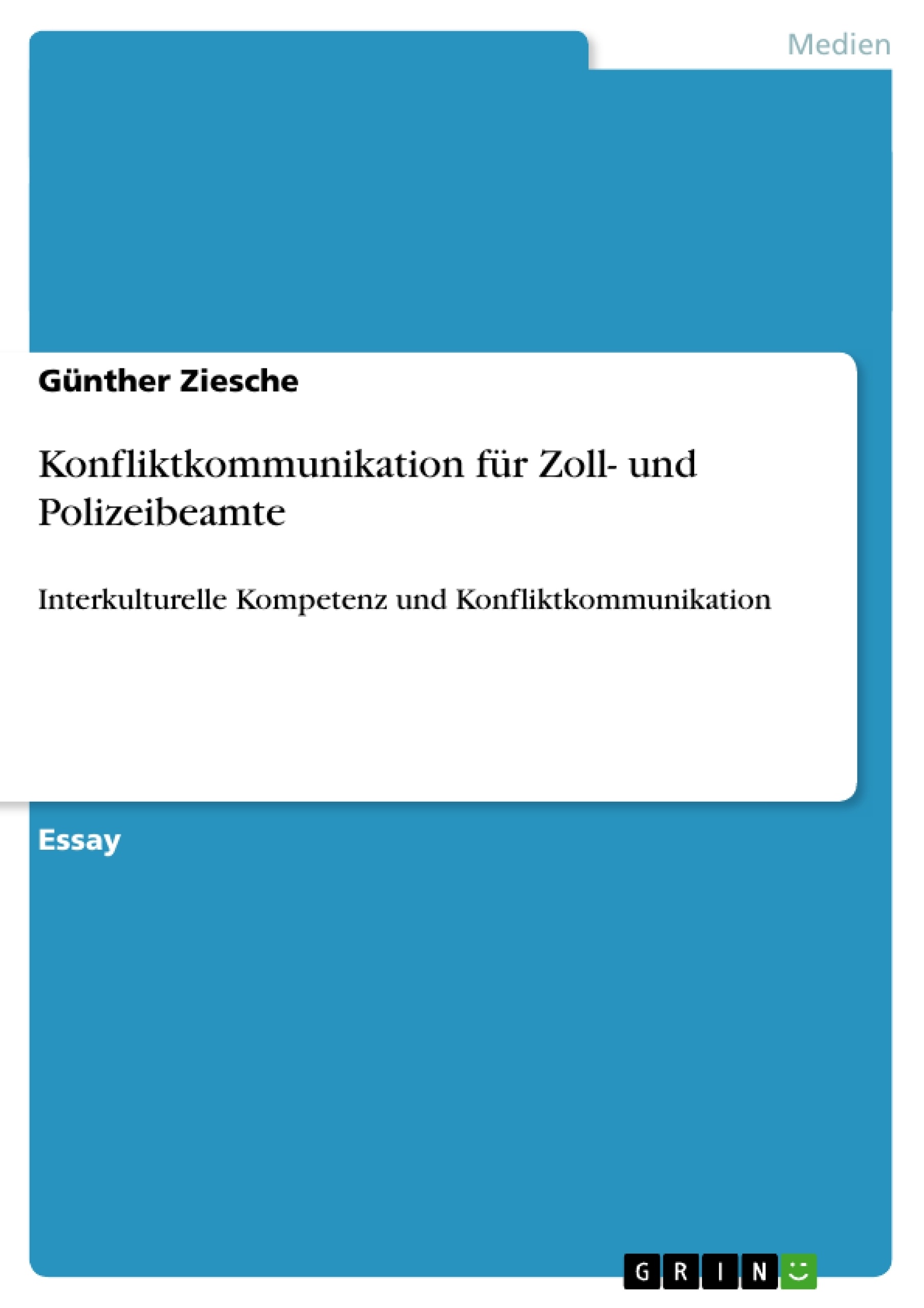Marion C., 21 Jahre alt, ist Zollbeamtin und an einem internationalen Flughafen in Süddeutschland eingesetzt. Sie ist zuständig für Gepäckkontrollen im Reiseverkehr. Die Reisenden kommen aus allen Kontinenten und aus jeder gesellschaftlichen Schichtung. Besonders häufig wird der Flughafen von Fluglinien aus der Türkei und arabischen Ländern angeflogen. Marion C. will einen Reisenden, der soeben mit einem Flieger aus Ankara angekommen ist, einer Gepäckkontrolle unterziehen. Hierzu hält sie ihn an und leitet die Maßnahme mit den Worten ein: „Grüß Gott, deutsche Zollkontrolle! Bitte melden Sie alle mitgebrachten Waren an!“ Der so angesprochene Mohammed H. reagiert auf die Kontrollmaßnahme brüsk. Er sieht Marion C. an und erwidert laut: „Ich möchte nicht von einer Frau kontrolliert werden! Außerdem möchte ich, dass Sie mich mit ´Guten Tag´ begrüßen“.
Der Reisende Mohammed H. ist 35 Jahre alt und ledig. Er ist in der Türkei geboren, lebt aber seit seinem 10 Lebensjahr in Deutschland. Er hat keine feste Arbeit, hilft von Zeit zu Zeit im Handyladen seines Onkels aus. Er ist weder in seinem Geburtsland noch in Deutschland fest verwurzelt. Mohammed H. ist Moslem und lebt seinen Glauben nach strengen religiösen Gesetzen.
Mohammed H. reist viel mit dem Flugzeug. Die Familie ist ihm sehr wichtig. Er unternimmt deshalb häufige Besuche in Tschechien, Österreich und im Elsass. Mohammed H. hat das subjektive Gefühl öfter und intensiver kontrolliert zu werden als Mitreisende, die vom äußeren Erscheinungsbild her dem westlichen Kulturkreis zuzurechnen sind.
Marion C. stammt aus einem Dorf in der Oberpfalz mit überwiegend katholischer Prägung. Ihre Ausbildung in der Bundeszollverwaltung hat Sie erst vor drei Monaten beendet. Ihr Selbstwertgefühl definiert sie überwiegend über ihren Beruf. Obwohl Sie noch über wenig Erfahrung im Umgang mit internationalem Publikum besitzt, hat sie bereits mehrere größere Aufgriffe vorzuweisen: Zwei Fälle von Goldschmuggel sowie einen nicht unerheblichen Drogenfund. Bei allen eingeleiteten Strafverfahren waren die Beschuldigten Muslime.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Beschreiben der Situation als „kritisches Ereignis“
- 1.1 Ereignis und beteiligte Personen
- 1.2 Vorgeschichte und Einflüsse auf das „kritische Ereignis“
- 2. Werte
- 2.1 Rolle von Wertevorstellungen
- 2.2 Sichtbarwerden kultureller Skripte
- 2.2.1 Geringe Machtinstanz vs. Große Machtinstanz
- 2.2.2 Unsicherheitsvermeidung gering vs. starker Unsicherheitsvermeidung
- 2.2.3 Universalismus vs. Partikularismus
- 3. Rollen und Perspektivenwechsel - Fremdkultur und Argumentation
- 4. Interventionsmöglichkeiten – Lösungsoptionen
- 4.1 Problem - Was ist verkehrt/falsch?
- 4.1.1 Symptome
- 4.1.2 Tatsachen, die einer erwünschten Situation gegenüberstehen
- 4.2 Analyse
- 4.2.1 Diagnose des Problems und seine Ursachen
- 4.2.2 Was fehlt?
- 4.2.3 Hindernisse für eine Problemlösung
- 4.3 Vorgehen
- 4.3.1 Strategien und Rezepte
- 4.3.2 Theoretische Abhilfen
- 4.3.3 Ideen zur Problemlösung
- 4.4 Ideen zur Durchführung
- 4.4.1 Mögliche Vorgehensweisen
- 4.4.2 Schritte zur Problemlösung
- 4.1 Problem - Was ist verkehrt/falsch?
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht einen konkreten Konflikt zwischen einer deutschen Zollbeamtin und einem türkischstämmigen Reisenden am Flughafen. Ziel ist es, die interkulturellen Aspekte dieses „kritischen Ereignisses“ zu analysieren und mögliche Interventionsstrategien aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung interkultureller Kompetenz in der Konfliktkommunikation für Zoll- und Polizeibeamte.
- Interkulturelle Unterschiede in der Kommunikation
- Einfluss von Werten und kulturellen Skripten auf das Konfliktgeschehen
- Analyse von Machtstrukturen und Unsicherheitsvermeidung
- Rollenübernahme und Perspektivenwechsel im interkulturellen Kontext
- Entwicklung von Lösungsoptionen für interkulturelle Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Beschreiben der Situation als „kritisches Ereignis“: Dieses Kapitel beschreibt den Konflikt zwischen der Zollbeamtin Marion C. und dem Reisenden Mohammed H. Es stellt den konkreten Vorfall detailliert dar, inklusive der beteiligten Personen, deren jeweiliger Hintergrund und die unmittelbare Konfliktsituation. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Reaktion beider Akteure auf die Gepäckkontrolle, die den Ausgangspunkt für die folgende Analyse bildet.
2. Werte: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Werten und Weltanschauungen im Konflikt. Es vergleicht die Wertevorstellungen der westlichen Kultur (vertreten durch Marion C.) mit denen der islamischen Kultur (vertreten durch Mohammed H.). Der Einfluss des jüdisch-christlichen Rechts im deutschen Strafrecht und die Unterschiede zu den islamischen Werten werden herausgestellt, um die unterschiedlichen Handlungsweisen der Protagonisten zu erklären. Der Abschnitt über kulturelle Skripte vertieft diese Analyse, indem er die Dimensionen Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung und Universalismus/Partikularismus beleuchtet.
3. Rollen und Perspektivenwechsel - Fremdkultur und Argumentation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Perspektivenwechsel und der Notwendigkeit, die Sichtweise des kulturellen Gegenübers einzunehmen. Es wird verdeutlicht, wie wichtig es ist, die kulturellen Hintergründe und Motive des anderen zu verstehen, um den Konflikt zu lösen. Anhand von Beispielen werden die unterschiedlichen Denkweisen und Wahrnehmungen von Marion C. und Mohammed H. veranschaulicht.
4. Interventionsmöglichkeiten – Lösungsoptionen: In diesem Kapitel werden mögliche Wege zur Konfliktlösung aufgezeigt. Es wird analysiert, welche Faktoren zum Konflikt beigetragen haben und welche Strategien zur Deeskalation und Problemlösung eingesetzt werden könnten. Der Abschnitt gliedert sich in die Beschreibung des Problems, seine Analyse und die Darstellung von Vorgehensweisen und Lösungsansätzen. Die jeweiligen Symptome und die hinderlichen Tatsachen werden ebenfalls detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Konfliktkommunikation, Zollwesen, Polizeiarbeit, Werte, kulturelle Skripte, Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Universalismus, Partikularismus, Konfliktlösung, Deeskalation, Kommunikationsstile, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse eines interkulturellen Konflikts am Flughafen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert einen konkreten Konflikt zwischen einer deutschen Zollbeamtin und einem türkischstämmigen Reisenden am Flughafen. Ziel ist die Untersuchung der interkulturellen Aspekte dieses "kritischen Ereignisses" und die Entwicklung möglicher Interventionsstrategien. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung interkultureller Kompetenz in der Konfliktkommunikation für Zoll- und Polizeibeamte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Beschreibung des kritischen Ereignisses (Konflikt zwischen Zollbeamtin und Reisenden); 2. Analyse der beteiligten Werte und kulturellen Skripte; 3. Perspektivenwechsel und Fremdkultur; 4. Interventionsmöglichkeiten und Lösungsoptionen; 5. Zusammenfassung.
Wie wird der Konflikt im ersten Kapitel beschrieben?
Kapitel 1 beschreibt detailliert den Konflikt zwischen der Zollbeamtin Marion C. und dem Reisenden Mohammed H., inklusive der beteiligten Personen, deren Hintergrund und der unmittelbaren Konfliktsituation. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Reaktionen beider Akteure auf die Gepäckkontrolle.
Welche Rolle spielen Werte und kulturelle Skripte?
Kapitel 2 untersucht die Rolle von Werten und Weltanschauungen im Konflikt. Es vergleicht die Wertevorstellungen der westlichen Kultur (Marion C.) mit denen der islamischen Kultur (Mohammed H.). Der Einfluss des jüdisch-christlichen Rechts und die Unterschiede zu islamischen Werten werden beleuchtet, um die unterschiedlichen Handlungsweisen zu erklären. Kulturelle Skripte werden anhand der Dimensionen Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung und Universalismus/Partikularismus analysiert.
Wie wichtig ist der Perspektivenwechsel?
Kapitel 3 betont die Wichtigkeit des Perspektivenwechsels und des Verständnisses der kulturellen Hintergründe und Motive des Gegenübers zur Konfliktlösung. Es veranschaulicht die unterschiedlichen Denkweisen und Wahrnehmungen von Marion C. und Mohammed H.
Welche Lösungsoptionen werden aufgezeigt?
Kapitel 4 zeigt mögliche Wege zur Konfliktlösung auf. Es analysiert die Konfliktursachen und präsentiert Strategien zur Deeskalation und Problemlösung. Es beschreibt das Problem, analysiert es, und stellt Vorgehensweisen und Lösungsansätze vor. Symptome und hinderliche Tatsachen werden detailliert untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kompetenz, Konfliktkommunikation, Zollwesen, Polizeiarbeit, Werte, kulturelle Skripte, Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Universalismus, Partikularismus, Konfliktlösung, Deeskalation, Kommunikationsstile, Kulturvergleich.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die interkulturellen Aspekte des Konflikts zu analysieren und mögliche Interventionsstrategien aufzuzeigen. Sie beleuchtet die Bedeutung interkultureller Kompetenz in der Konfliktkommunikation für Zoll- und Polizeibeamte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Interkulturelle Unterschiede in der Kommunikation, Einfluss von Werten und kulturellen Skripten, Analyse von Machtstrukturen und Unsicherheitsvermeidung, Rollenübernahme und Perspektivenwechsel, Entwicklung von Lösungsoptionen für interkulturelle Konflikte.
- Citar trabajo
- Günther Ziesche (Autor), 2010, Konfliktkommunikation für Zoll- und Polizeibeamte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207001