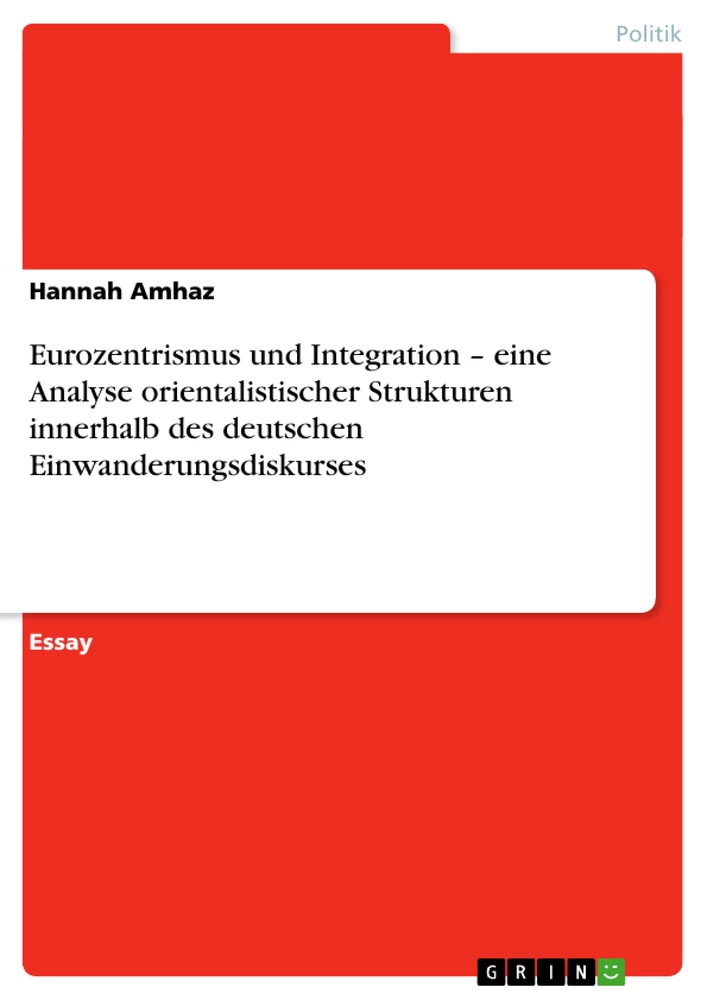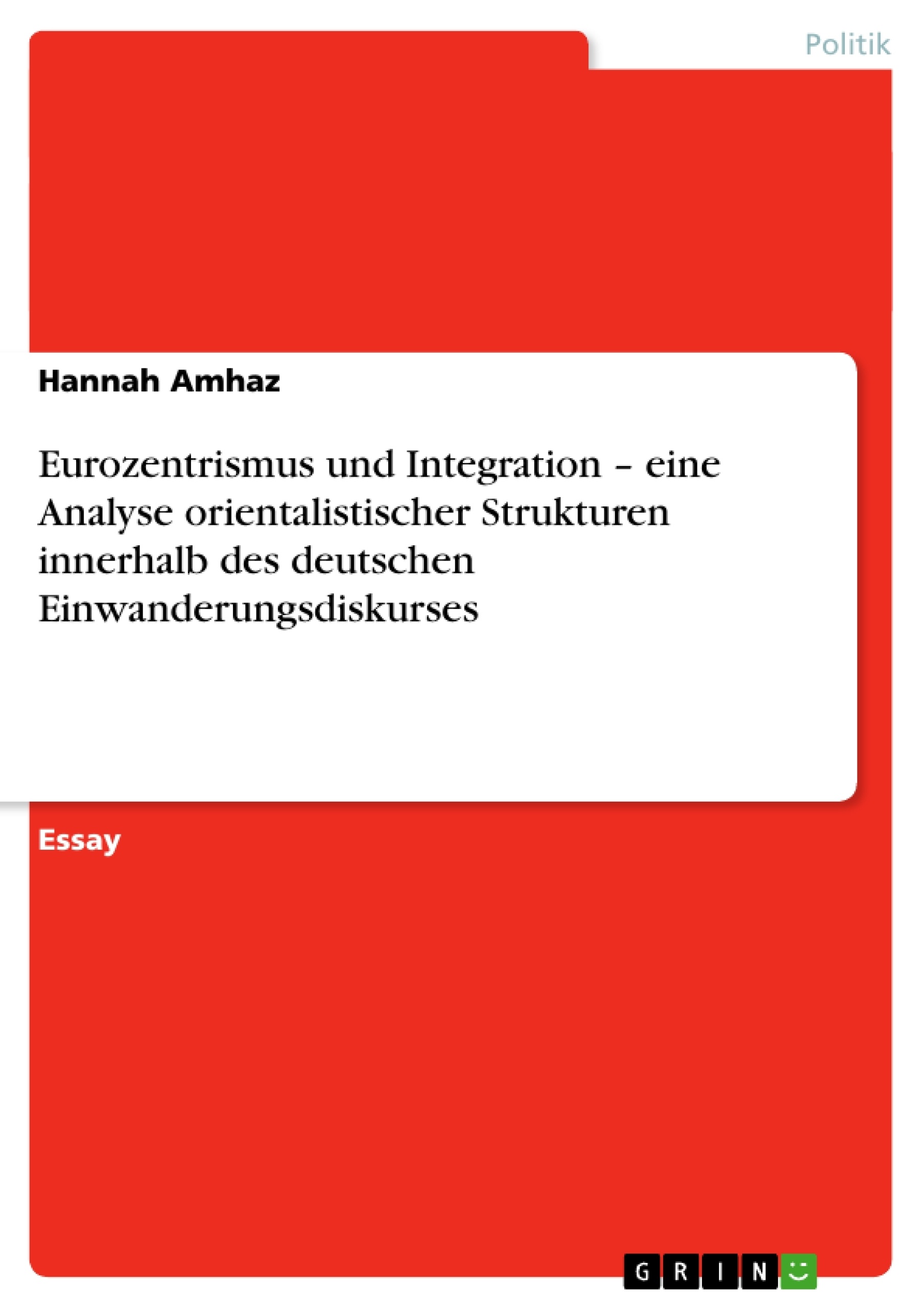Auf der Suche nach Informationen über die „Welt des Islam“ und seine Lehre stößt man im Heiligen Römischen Reich des frühen 17. Jahrhunderts auf Werke wie die des Salomon Schweigger . Seine deutschsprachige Übersetzung des Korans erschien 1616 unter dem Titel AL CORANUS MAHOMETICUS, Das ist: Der Türcken Alcoran / Religion und Aberglauben , dessen Notwendigkeit der Autor damit begründet, dass man den Feind kennen müsse, um ihn besiegen zu können, wobei seine Übersetzung kaum mit dem Original übereinstimmt. Niemanden versetzt das in Erstaunen, denn von einem christlichen Gelehrten jener Zeit wird keine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Islam erwartet. Leider sind das Feindbild „Islam“ und der orientalistische Diskurs über die arabischen Länder, ihre Kulturen und Religionen keine Phänomene des 17. Jahrhunderts, sondern prägende Bestandteile unserer Zeit. Wenn auch oder vielleicht gerade weil die Auswahl an Informationsmaterial über den Islam und „den Orient“ scheinbar bis ins Unendliche reicht, konnten sich orientalistische Denkstrukturen durchgängig halten und sind heute ein wichtiger Bestandteil der deutschen Politik.
Inhaltsverzeichnis
- Saids Kritik an orientalistischen Denkmustern
- Der orientalistische Einwanderungsdiskurs Deutschlands
- Abwesenheit einer historischen und kultur-bezogenen Kontextualisierung
- Diskussion über „den islamischen Terror\" ohne Bezug auf Saids Orientalismus-Kritik
- legitimierte „Islamisierung“ „muslimischen“ Community
- fehlende Beachtung der Folgen des Kolonialismus
- Polarisierung mittels emotional begründeter Bedrohungsszenarien
- Die Ursachen dieser Denkmuster
- Auswirkungen orientalistischer Denkmuster auf die Integrationspolitik
- Imaginäre Homogenisierung des Westens und seines Wertesystems
- Interessensgeleitete Ideologie des Ausschlusses
- Anspruch auf Assimilierung der Eingewanderten
- Kulturelle Kriminalisierung und symbolische Abgrenzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen orientalistischer Denkstrukturen auf die deutsche Integrationspolitik. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln dieses Diskurses und analysiert dessen Manifestationen im Umgang mit muslimischer Einwanderung. Der Fokus liegt auf der Offenlegung grundlegender Probleme der Integrationspolitik und der Darstellung ihrer Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und politischen Diskurs.
- Orientalismus und sein Einfluss auf den Einwanderungsdiskurs
- Kritische Analyse der deutschen Integrationspolitik
- Identifizierung von problematischen Denkmustern und deren Ursachen
- Auswirkungen orientalistischer Strukturen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung
- Die Rolle von Medien und „Experten“ im Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Saids Kritik an orientalistischen Denkmustern: Dieses Kapitel führt in die Thematik des Orientalismus ein, wie er von Edward Said geprägt wurde. Es beschreibt den im Westen geführten Diskurs über den Orient, der durch eine zweckgebundene Trennung zwischen Orient und Okzident gekennzeichnet ist und aus dem Wunsch nach Identitätsbildung und Machtinteressen entstanden ist. Der Islam wird in diesem Diskurs oft als monolithische und dem Westen entgegengesetzte Kraft dargestellt.
Der orientalistische Einwanderungsdiskurs Deutschlands: Dieses Kapitel analysiert, wie orientalistische Feindbilder die Ablehnung außereuropäischer Einwanderung, insbesondere muslimischer Einwanderung, seit dem Ende des Kalten Krieges verstärkt begründen. Es werden zentrale Merkmale dieses Diskurses herausgearbeitet, wie die Abwesenheit historischer Kontextualisierung, die Gleichsetzung des Islams mit bestimmten negativen Verhaltensweisen und die Vernachlässigung kolonialer und geopolitischer Hintergründe. Der Diskurs wird als ein Prozess der Polarisierung und der Konstruktion von unvereinbaren Gegensätzen dargestellt.
Die Ursachen dieser Denkmuster: Hier werden die Ursachen der im vorherigen Kapitel beschriebenen Denkstrukturen im Kontext von Saids Orientalismuskritik analysiert. Es werden Aspekte wie die Durchsetzung eines Hegemoniekonzepts der deutschen Leitkultur, der Wunsch nach gesellschaftlicher Homogenität und Sicherheit sowie die Legitimierung von Ausgrenzung und Diskriminierung als politische Leitkonzepte erörtert.
Auswirkungen orientalistischer Denkmuster auf die Integrationspolitik: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der beschriebenen Denkstrukturen auf die deutsche Integrationspolitik beleuchtet. Es werden Themen wie die imaginäre Homogenisierung des Westens, die interessensgeleitete Ideologie des Ausschlusses, der Anspruch auf Assimilierung und die kulturelle Kriminalisierung von Minderheiten diskutiert. Der Text beschreibt ein „Wahrheitsregime“ und die damit verbundene Legitimierung von Generalverdacht, Überwachung und Einschränkungen der Freiheitsrechte.
Schlüsselwörter
Orientalismus, Integrationspolitik, Einwanderungsdiskurs, Islam, Deutschland, Feindbilder, Medien, Identität, Macht, Kolonialismus, Assimilation, Ausgrenzung, Diskriminierung, Leitkultur.
Häufig gestellte Fragen zu: Auswirkungen orientalistischer Denkstrukturen auf die deutsche Integrationspolitik
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen orientalistischer Denkstrukturen auf die deutsche Integrationspolitik. Sie analysiert, wie diese Denkstrukturen den Umgang mit muslimischer Einwanderung prägen und welche Probleme sie für die Integrationspolitik mit sich bringen.
Welche Aspekte des Orientalismus werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf Edward Saids Kritik am Orientalismus und untersucht, wie dieser Diskurs die Wahrnehmung des "Orients" und des Islam im Westen beeinflusst. Es wird gezeigt, wie der Orientalismus zur Konstruktion von Feindbildern und zur Legitimierung von Ausgrenzung und Diskriminierung beiträgt.
Wie manifestiert sich der Orientalismus im deutschen Einwanderungsdiskurs?
Der Text analysiert, wie orientalistische Feindbilder die Ablehnung außereuropäischer, insbesondere muslimischer Einwanderung, verstärken. Es werden Merkmale wie das Fehlen historischer Kontextualisierung, die Gleichsetzung des Islams mit negativen Verhaltensweisen und die Vernachlässigung kolonialer Hintergründe thematisiert. Der Diskurs wird als polarisierend und konstruierend von unvereinbaren Gegensätzen beschrieben.
Welche Ursachen für die orientalistischen Denkmuster werden genannt?
Die Arbeit erörtert Ursachen wie die Durchsetzung eines Hegemoniekonzepts der deutschen Leitkultur, den Wunsch nach gesellschaftlicher Homogenität und Sicherheit, sowie die Legitimierung von Ausgrenzung und Diskriminierung als politische Leitkonzepte.
Welche Auswirkungen haben diese Denkmuster auf die Integrationspolitik?
Die Auswirkungen betreffen die imaginäre Homogenisierung des Westens, eine interessensgeleitete Ideologie des Ausschlusses, den Anspruch auf Assimilierung der Eingewanderten und die kulturelle Kriminalisierung von Minderheiten. Es wird ein "Wahrheitsregime" beschrieben, welches Generalverdacht, Überwachung und Einschränkungen der Freiheitsrechte legitimiert.
Welche Rolle spielen Medien und Experten im Diskurs?
Die Arbeit erwähnt die Rolle von Medien und "Experten" im Diskurs, implizierend, dass diese eine wichtige Rolle bei der Verbreitung und Verstärkung orientalistischer Denkmuster spielen. Eine detaillierte Analyse dieser Rolle ist jedoch nicht explizit im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Saids Kritik am Orientalismus, dem orientalistischen Einwanderungsdiskurs in Deutschland, den Ursachen dieser Denkmuster und deren Auswirkungen auf die Integrationspolitik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Orientalismus, Integrationspolitik, Einwanderungsdiskurs, Islam, Deutschland, Feindbilder, Medien, Identität, Macht, Kolonialismus, Assimilation, Ausgrenzung, Diskriminierung und Leitkultur.
- Quote paper
- Hannah Amhaz (Author), 2012, Eurozentrismus und Integration – eine Analyse orientalistischer Strukturen innerhalb des deutschen Einwanderungsdiskurses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206834