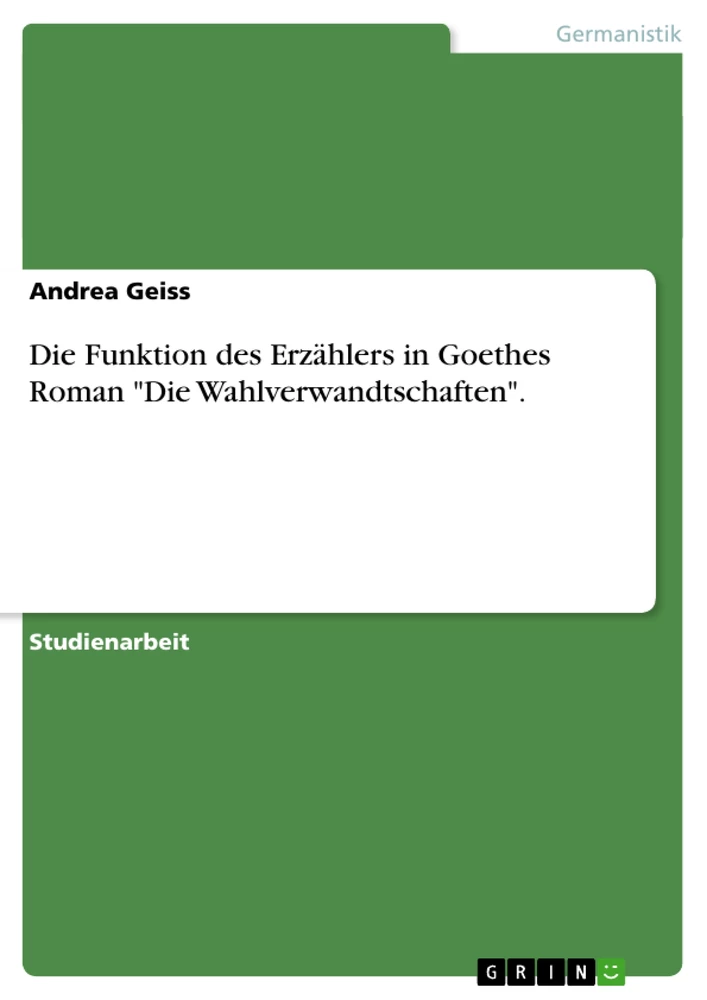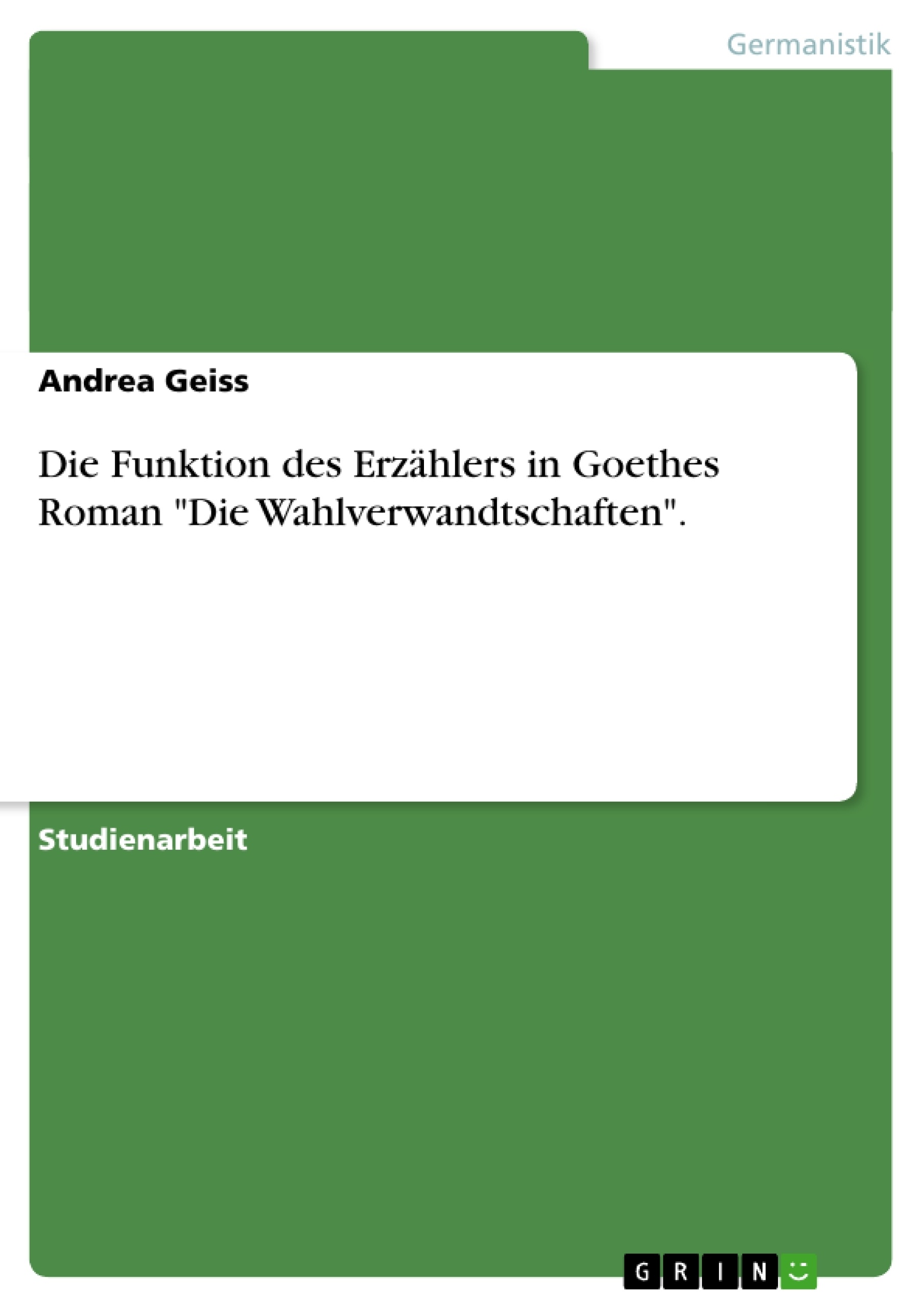Die Rolle des Erzählers in Johann Wolfgang Goethes „Die Wahlverwandtschaften“ erstmals detailliert in den Blick seiner Forschungen genommen zu haben, war der Verdienst von Stefan Blessin. Seine Untersuchungen über das Verhältnis von Handlung und Erzählung im Roman brachten neue Aspekte in die Diskussion um dieses vielschichtige Werk. Möglich wurde seine Arbeit durch jene Entwicklung der Literaturwissenschaft, die die Erzählstruktur des Romans als Stilmittel begreift. Im Gegensatz zur älteren Forschung begreift sie die Instanz des Erzählers keineswegs als deckungsgleich mit dem Autor. Die vorliegende Hausarbeit bezieht sich in ihrer Fokussierung auf den Erzähler auf die Forschungen von Blessin. Dieser Ansatz ist bis jetzt keineswegs ausgeschöpft und bietet noch zahlreiche Erkenntnisse, die bei der Interpretation der Wahlverwandtschaften hilfreich sind. So ist die Konzentration auf die Erzähltechnik im Roman auch bei der Frage um seinen- in der Forschung stets kontrovers diskutierten- Schluss nützlich. Der erste Teil dieser Arbeit versucht ganz allgemein, die Position des Erzählers im Roman zu fassen. Es wird sich zeigen, dass der Text vielfach selbst die Problematik von Erzählung und Konstruktion metasprachlich aufnimmt. Die Rolle des Erzählers zwischen Berichterstatter und Kommentator wird genauer zu bestimmen sein. Der zweite Teil der Hausarbeit beschäftigt sich mit der Figur Ottilie. Ihre Rolle als ‚Heilige’ gibt der Forschung bis heute Rätsel auf. Bei der vielschichtigen Verklärung von Ottilie wird sich der Anteil des Erzählers als zentral herausstellen. An diesem Beispiel zeigt sich, wie der Blick auf die Erzählstruktur auch bei der Diskussion um ein ‚Einzelthema’ hilfreich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Romanstruktur und Erzählerfunktion
- Der Erzähler als Regisseur
- Dialoge, Briefe, Tagebuch
- Der wechselhafte Erzähler
- Zusammenfassung
- „Das herrliche Kind“. Ottilie und der Erzähler
- Die vermittelte Figur
- Ottilie, das gute Kind?
- Stilisierung zur Heiligen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Erzählers in Goethes „Die Wahlverwandtschaften“, basierend auf den Forschungen von Stefan Blessin. Der Fokus liegt auf der Analyse der Erzähltechnik und deren Einfluss auf die Interpretation des Romans, insbesondere im Hinblick auf die Figur Ottilie. Die Arbeit beleuchtet, wie der Erzähler als konstruierendes Element die Handlung und die Figuren beeinflusst.
- Die Rolle des Erzählers als Regisseur der Handlung
- Der Einfluss der Erzählperspektive auf die Interpretation der Figuren
- Die Konstruktion von Ottilies Figur durch den Erzähler
- Die metasprachliche Reflexion des Erzählprozesses im Roman
- Die Bedeutung der Erzähltechnik für die Interpretation des Romanschlusses
Zusammenfassung der Kapitel
Romanstruktur und Erzählerfunktion: Dieser Abschnitt analysiert die Position des Erzählers in Goethes Roman. Er argumentiert, dass der Text selbst die Problematik von Erzählung und Konstruktion metasprachlich thematisiert. Der Erzähler agiert sowohl als Berichterstatter als auch als Kommentator, wobei seine Selektion von Ereignissen und seine Interpretationen die Leserezeption maßgeblich beeinflussen. Der erste Satz des Romans, "Eduard – so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter", wird als Beispiel für die vom Erzähler vorgenommene Konstruktion der Geschichte herangezogen. Die Analyse beleuchtet, wie der Erzähler durch seine Eingriffe und Kommentare die Handlung gestaltet und interpretiert, und verdeutlicht, dass der Erzähler nicht als allwissende Instanz, sondern als interpretierender Akteur verstanden werden muss. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere detaillierte Untersuchung der Figur Ottilie und ihrer Konstruktion durch den Erzähler.
„Das herrliche Kind“. Ottilie und der Erzähler: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Figur Ottilie und die Rolle des Erzählers bei ihrer Darstellung. Es untersucht, wie der Erzähler Ottilie stilisiert und welche Auswirkungen diese Stilisierung auf das Verständnis ihrer Rolle im Roman hat. Der Erzähler kontrolliert die Informationen, die der Leser über Ottilie erhält, hauptsächlich durch Auszüge aus ihrem Tagebuch und Kommentierung ihrer Handlungen. Die Analyse hinterfragt die Darstellung Ottilies als "heiliges Kind" und beleuchtet die Ambivalenzen in ihrer Charakterisierung. Die gezielte Auswahl und Präsentation von Informationen durch den Erzähler wird als zentrales Mittel zur Konstruktion von Ottilies Bild beim Leser herausgestellt. Die Vermittlung von Ottilies Innerleben durch den Erzähler und die Selektion von Details aus ihrem Tagebuch wird dabei als entscheidender Faktor für die Interpretation ihrer Persönlichkeit und ihres Handelns betont.
Schlüsselwörter
Erzählerfunktion, Goethe, Die Wahlverwandtschaften, Erzähltechnik, Ottilie, Konstruktion, Interpretation, Romanstruktur, Metasprache, Perspektive.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Die Wahlverwandtschaften" - Erzähleranalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Funktion des Erzählers in Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften", insbesondere im Hinblick auf die Konstruktion der Figur Ottilie. Der Fokus liegt auf der Erzähltechnik und deren Einfluss auf die Interpretation des Romans.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle des Erzählers als Regisseur der Handlung, den Einfluss der Erzählperspektive auf die Figureninterpretation, die Konstruktion von Ottilies Figur durch den Erzähler, die metasprachliche Reflexion des Erzählprozesses und die Bedeutung der Erzähltechnik für die Interpretation des Romanschlusses. Es werden die Romanstruktur, die Erzählerfunktion (inkl. Dialogen, Briefen und Tagebüchern), sowie die Darstellung Ottilies als "heiliges Kind" und die damit verbundenen Ambivalenzen untersucht.
Wie wird die Romanstruktur analysiert?
Die Analyse der Romanstruktur untersucht die Position des Erzählers als Berichterstatter und Kommentator. Es wird gezeigt, wie seine Selektion von Ereignissen und Interpretationen die Leserezeption beeinflussen. Der erste Satz des Romans dient als Beispiel für die vom Erzähler vorgenommene Konstruktion der Geschichte. Der Erzähler wird nicht als allwissende Instanz, sondern als interpretierender Akteur verstanden.
Welche Rolle spielt Ottilie in der Analyse?
Das Kapitel über Ottilie konzentriert sich auf die Rolle des Erzählers bei ihrer Darstellung. Es untersucht, wie der Erzähler Ottilie stilisiert und welche Auswirkungen diese Stilisierung auf das Verständnis ihrer Rolle im Roman hat. Die Analyse hinterfragt die Darstellung Ottilies als "heiliges Kind" und beleuchtet die Ambivalenzen in ihrer Charakterisierung. Die gezielte Auswahl und Präsentation von Informationen durch den Erzähler wird als zentrales Mittel zur Konstruktion von Ottilies Bild beim Leser hervorgehoben. Die Vermittlung von Ottilies Innerleben durch den Erzähler und die Selektion von Details aus ihrem Tagebuch wird als entscheidender Faktor für die Interpretation ihrer Persönlichkeit und ihres Handelns betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erzählerfunktion, Goethe, Die Wahlverwandtschaften, Erzähltechnik, Ottilie, Konstruktion, Interpretation, Romanstruktur, Metasprache, Perspektive.
Welche Forschungsansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf den Forschungen von Stefan Blessin und untersucht die Funktion des Erzählers als konstruierendes Element, das Handlung und Figuren beeinflusst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu "Romanstruktur und Erzählerfunktion" und "„Das herrliche Kind“. Ottilie und der Erzähler". Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung.
- Quote paper
- Andrea Geiss (Author), 2003, Die Funktion des Erzählers in Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften"., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20675