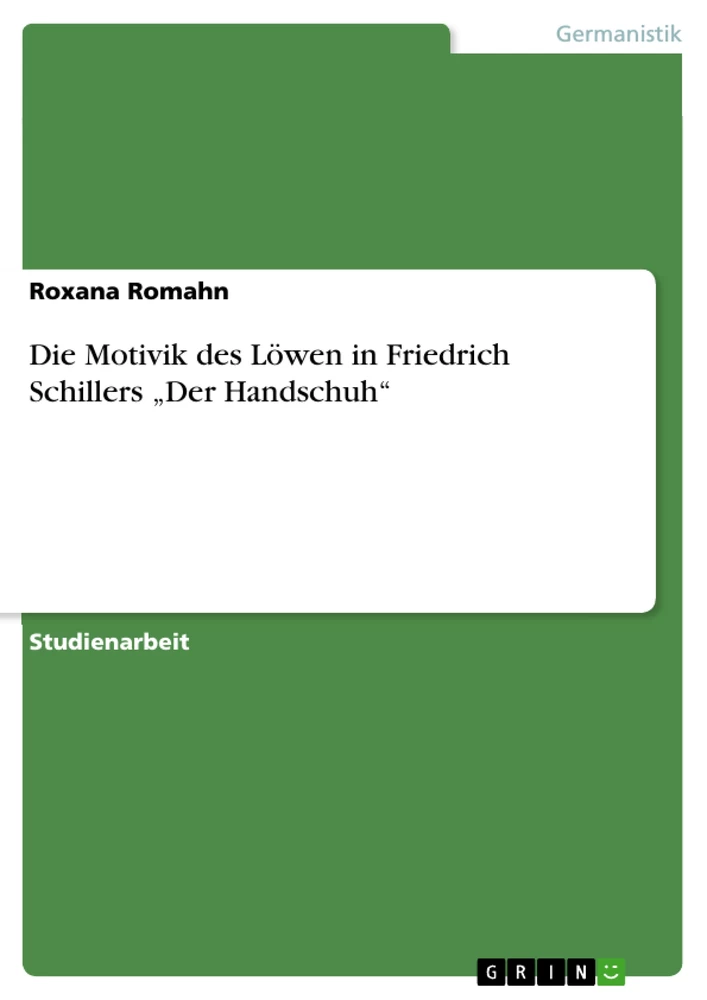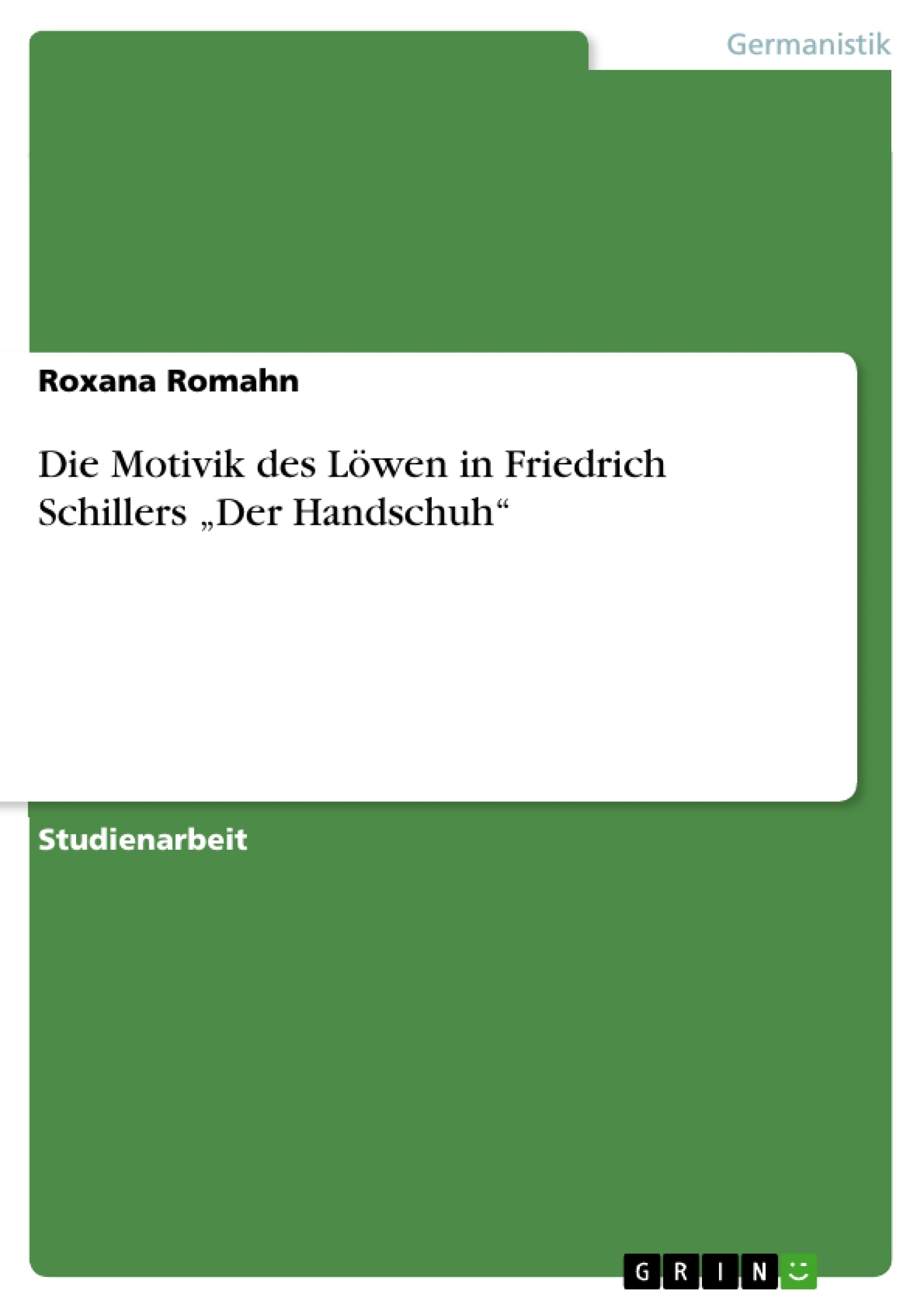"Herausragende Leistungen unter Schillers Mittelalterballaden sind ´Der
Handschuh´ und ´Der Taucher´"
Dieser Aussage Daus kann man sich nur anschließen, wenn man die einzelnen Motive und ihre Zusammenhänge einmal näher betrachtet. Auf den ersten Blick mutet die Ballade zwar wie eine „im einzelnen geglückte und interessante, im ganzen jedoch uneinheitliche und daher unbefriedigende Dichtung“ an. Offenkundig ging es Schiller nur darum, eine fast banal wirkende, historische Anekdote zu verwerten und den Leser nur zu amüsieren und zu unterhalten. Näher betrachtet erschließt sich jedoch eine Fülle an literarischen Dimensionen und Interpretationsmöglichkeiten.
Schiller selbst mag auch Schuld an der eher stiefmütterlichen Behandlung des
„Handschuhs“ tragen, denn am 18. Juni 1797 bezeichnete er ihn selbst in einem Brief an Goethe als „ein kleines Nachstück zum Taucher, wozu ich durch eine Anecdote[ sic! ] in S. Foix Essay sur Paris aufgemuntert wurde.“ Damit legt er den Status dieser Ballade selbst fest und setzt sie so gesehen hinter dem „Taucher“ zurück.
Auch wenn der Reiz des Stückes hauptsächlich den anekdotischen Gegebenheiten gilt, so kann man trotzdem sagen, dass sich eine Betrachtung der kürzesten aller schillerschen Balladen durchaus lohnt.
Hier soll nun das Augenmerk auf einen ganz speziellen Aspekt gelegt werden. Zu
betrachten ist die Löwenmotivik und ihre Wirkung. Es soll geklärt werden, ob der Löwe aus reinem Zufall als eines der drei Gefahren, die den Ritter Delorges bedrohen, gewählt wurde, oder ob andere Beweggründe vorlagen.
Darüber hinaus finden sich auch Anhaltspunkte in Verbindung mit dem Löwen- und
Königsmotiv, die die Anekdote sowohl räumlich als auch zeitlich verankern.
Zusätzlich soll dargestellt werden, dass die äußere Form der Ballade keineswegs zufällig gewählt wurde, sondern korrespondierend zum Inhalt bewusst gewählt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der Löwe bei Schiller
- 2.1. Die Löwenmotivik in der Kulturgeschichte
- 2.2. Verortung der Ballade im Zusammenhang mit Löwen
- 2.3. Die Löwenstrophe
- 2.4. Vergleich des Löwen mit dem Menschen
- 3. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Motivik des Löwen in Schillers Ballade „Der Handschuh“. Ziel ist es, die Bedeutung des Löwenmotivs im Kontext der Ballade zu ergründen und zu analysieren, ob seine Wahl rein zufällig war oder tieferliegende Beweggründe vorlagen. Die Arbeit beleuchtet den historischen und kulturellen Kontext des Löwenmotivs, seine Funktion in der Ballade und seine Beziehung zum König und zum Ritter.
- Die kulturelle und historische Bedeutung des Löwenmotivs
- Die Rolle des Löwen in Schillers „Der Handschuh“
- Der Vergleich zwischen Löwe und König
- Die Bedeutung der räumlichen und zeitlichen Verortung der Ballade
- Die formale Gestaltung der Ballade im Verhältnis zum Inhalt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die Ballade „Der Handschuh“ als eine scheinbar einfache, aber interpretationsreiche Dichtung vor. Sie erwähnt die kritische Rezeption des Werkes und die Einschätzung Schillers selbst, der es als „kleines Nachstück“ zum „Taucher“ bezeichnete. Die Arbeit kündigt die Fokussierung auf die Löwenmotivik und deren Bedeutung für das Verständnis der Ballade an. Die Untersuchung soll klären, ob die Wahl des Löwen als Symbol zufällig war oder durch tiefergehende Beweggründe motiviert wurde.
2. Der Löwe bei Schiller: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Löwenmotivs in Schillers Ballade. Es beginnt mit einer Betrachtung der Löwenmotivik in der Kulturgeschichte, wobei der Löwe als beliebtes Wappentier, als Symbol für Weisheit und Güte, und als Repräsentant königlicher Macht hervorgehoben wird. Es wird gezeigt, wie der Löwe im Mittelalter als Symbol für Stärke, Mut, und die mittelalterlichen Tugenden stand. Das Kapitel vergleicht dann das positive Bild des Löwen mit dem eher negativen Bild des Königs in Schillers Ballade und beleuchtet die Ironie dieser Gegenüberstellung. Schließlich wird die räumliche und zeitliche Verortung der Ballade untersucht, unter Bezugnahme auf Saint-Foix' „Essais historiques sur Paris“, welches die Handlung in Paris zur Zeit von König Franz I. verortet und die Haltung von Löwen am Königshof thematisiert. Die Untersuchung zeigt, dass die Wahl des Löwenmotivs kein Zufall, sondern ein bewusstes Stilmittel Schillers ist, das die tieferliegenden Bedeutungen der Ballade unterstreicht.
Schlüsselwörter
Schiller, Der Handschuh, Löwenmotivik, Kulturgeschichte, König, Ritter, Ironie, Symbol, Mittelalter, Saint-Foix, Paris, König Franz I.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Handschuh" - Schiller: Löwenmotivik und Interpretation
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Motivik des Löwen in Schillers Ballade „Der Handschuh“. Im Fokus steht die Analyse der Bedeutung des Löwenmotivs im Kontext der Ballade und die Frage, ob seine Verwendung zufällig war oder tieferliegende Beweggründe hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die kulturelle und historische Bedeutung des Löwenmotivs, seine Funktion in der Ballade, die Beziehung zwischen Löwe und König, die räumliche und zeitliche Verortung der Ballade und den Zusammenhang zwischen formaler Gestaltung und Inhalt. Konkret werden der Löwe als Wappentier, Symbol für Weisheit und Güte sowie als Repräsentant königlicher Macht im Mittelalter behandelt. Der Vergleich zwischen dem positiven Bild des Löwen und dem eher negativen Bild des Königs in der Ballade spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Hauptteil ("Der Löwe bei Schiller"), der die Löwenmotivik detailliert analysiert, und abschließende Schlussbetrachtungen. Der Hauptteil unterteilt sich weiter in Unterkapitel zur Löwenmotivik in der Kulturgeschichte, zur Verortung der Ballade im Zusammenhang mit Löwen, zur Analyse der "Löwenstrophe" und zum Vergleich zwischen Löwe und Mensch.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich unter anderem auf Saint-Foix' „Essais historiques sur Paris“, um die Handlung der Ballade in Paris zur Zeit König Franz I. einzuordnen und die Haltung von Löwen am Königshof zu thematisieren.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Wahl des Löwenmotivs in Schillers Ballade kein Zufall ist, sondern ein bewusstes Stilmittel, das die tieferliegenden Bedeutungen der Ballade unterstreicht. Die detaillierte Analyse der Löwenmotivik im historischen und kulturellen Kontext soll zu einem umfassenderen Verständnis der Ballade beitragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schiller, Der Handschuh, Löwenmotivik, Kulturgeschichte, König, Ritter, Ironie, Symbol, Mittelalter, Saint-Foix, Paris, König Franz I.
- Citar trabajo
- Roxana Romahn (Autor), 2009, Die Motivik des Löwen in Friedrich Schillers „Der Handschuh“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206510