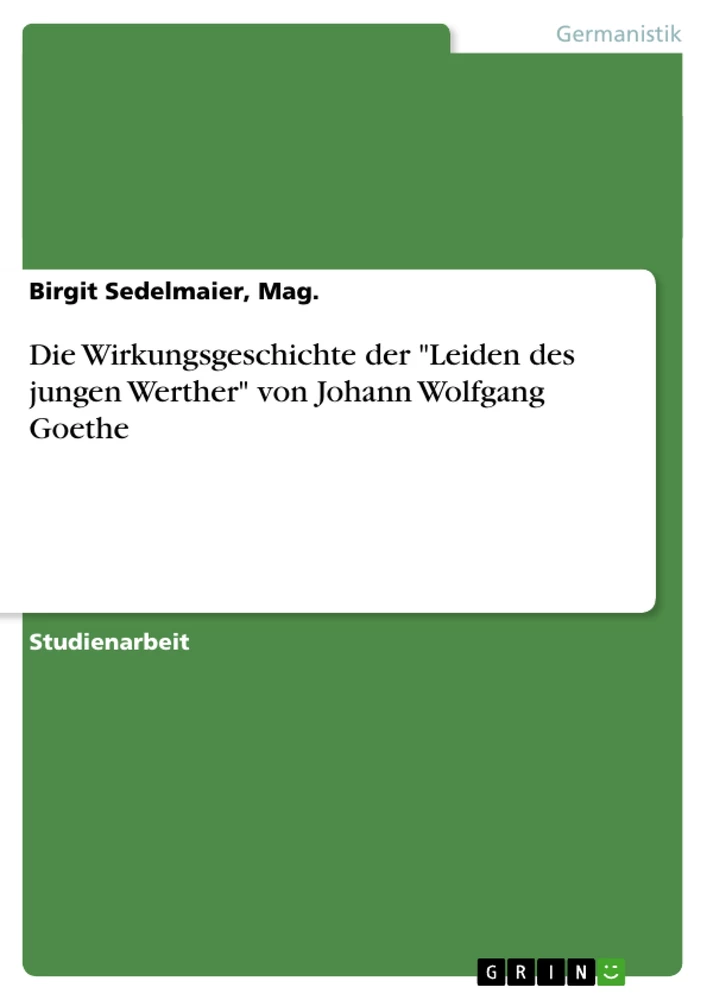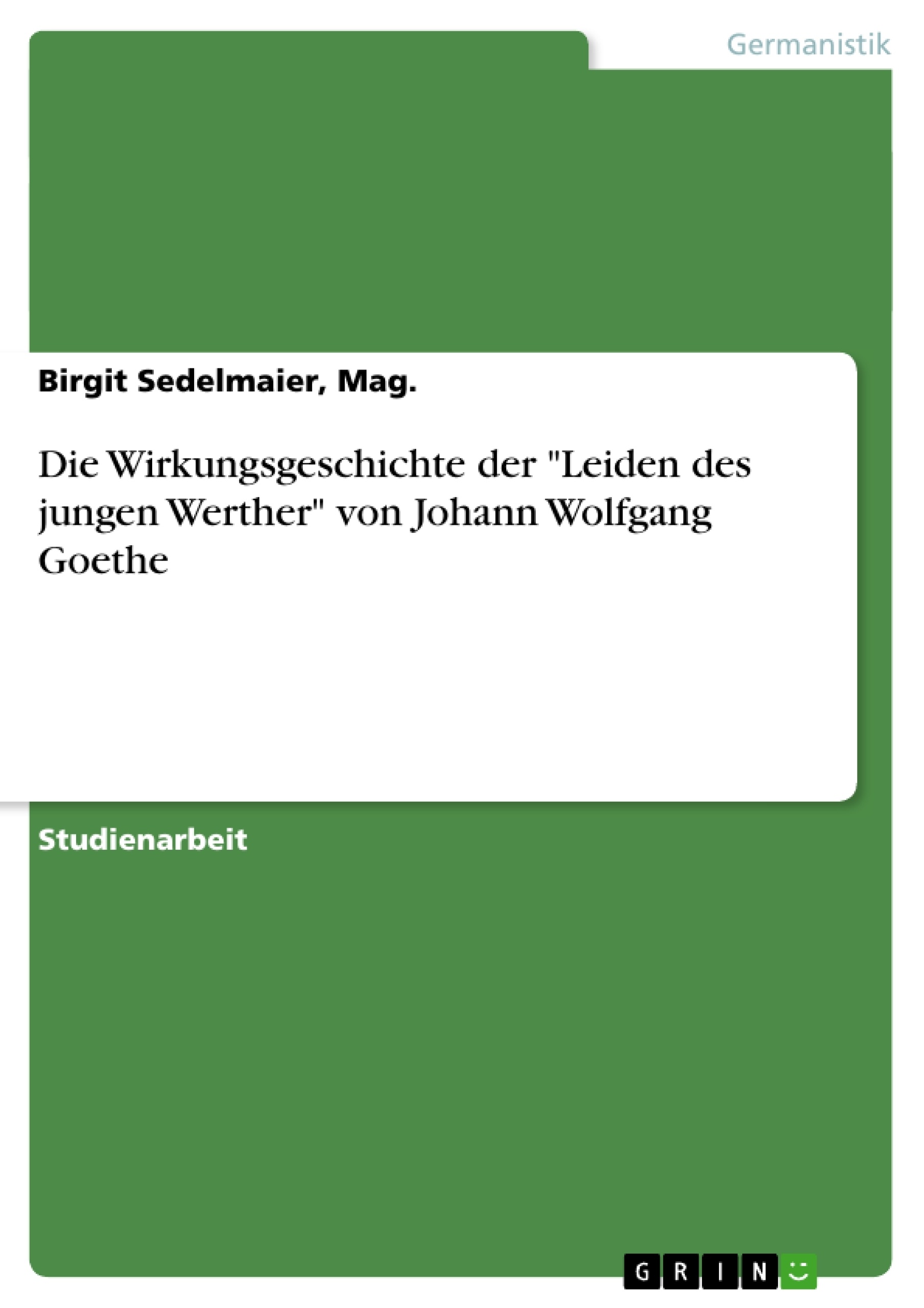Goethes Wirken hat eindrucksvolle Spuren in der Entwicklung der
deutschen Literatur hinterlassen. Seine Wirkungsgeschichte zu betrachten,
heißt ihrem Einfluss auf die Geschichte und auf die Etablierung der
deutschen Literatur in der Weltliteratur auf den Grund zu gehen.
Die Reaktionen auf Goethes Werke waren schon zu seinen Lebzeiten
enorm zahlreich und vielseitig. Das mag darin liegen, dass Goethe seine
Kritiker, sowohl ihm wohl Gesonnene als auch Zweifler, immer wieder vor
das Problem stellte, ihn nicht einordnen zu können. Bestehendes
durchbrach und revolutionierte er, sich in Entwicklung Befindliches trieb er
auf nicht mehr überbietbare Höhepunkte und erweiterte immer wieder den
Spielraum, in dem sich Literatur befand. Die Wirkung seiner Werke
übertraf in vielen Fällen den Erwartungshorizont des Publikums und führte
es an die Grenzen des allseits anerkannten Verständnisses und
Geschmackes von Literatur. Mandelkow schreibt hier von der Entstehung
eines neuen selbstbewußten Publikums und von der Entwicklung der
literarischen Kritik zu einer eigenständigen Disziplin.1 Die
Wirkungsgeschichte des Werthers ist geradezu ein Modellfall dieser
Entwicklung und zeigt in welches Spannungsverhältnis von
Meinungsbildnern dieses Werk seinen Fuß gesetzt hat. Was auf die
Veröffentlichung des Werthers folgte, übertraf alles bisher Dagewesene,
weil auch „Die Leiden des jungen Werther“ alles bisher Dagewesene
übertraf und den Briefroman wie auch den empfindsamen Roman an einen
Punkt führte, der keine Weiterentwicklung mehr zuließ.
Im Jahre 1774 erschienen „Die Leiden des junge Werthers“ von J. W.
Goethe. Goethe schrieb diesen Briefroman in nur vier Wochen nieder. Er
verarbeitet damit eine Reihe persönlicher Erlebnisse, wie den Selbstmord
eines Bekannten, Jerusalem, Probleme in der Arbeit und die unglückliche
Liebe zu Charlotte Buff. Schon kurz nachdem das Werk erschienen war, löste es eine Flut von
Reaktionen aus, positiver als auch negativer Natur. Zunächst möchte ich
die geistigen und literarischen Strömungen dieser Zeit näher betrachten,
um der Frage auf den Grund zu gehen, warum dieses Werk so einen
heftigen Literaturstreit vom Zaun brechen konnte. Dann möchte ich den
einzelnen Lagern, wie und in welcher Weise sie auf den Werther reagiert
haben, meine Aufmerksamkeit widmen. [...]
1 Mandelkow, K. R. Goethe im Urteil seiner Kritiker. Bd. I. München, 1975. S XXV
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Wirkungsgeschichte
- Die Kulturepochen
- Die Aufklärung
- Der Sturm und Drang
- Die Leserschaft
- Die literarische Tradition
- Zeitkritik im Werther
- Die Rationalisten
- Die Aufklärer
- Der Orthodoxer Klerus
- Die Sturm und Dränger
- Das Publikum
- Goethes Rezension
- Schlusswort
- Rezensionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkungsgeschichte von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ im Kontext der damaligen kulturellen und literarischen Strömungen. Ziel ist es, die vielfältigen Reaktionen auf das Werk zu analysieren und zu verstehen, warum es einen so heftigen Literaturstreit auslöste. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Interpretationen des Werthers durch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und zeigt, wie das Werk die Entwicklung der literarischen Kritik beeinflusste.
- Die Rezeption von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
- Der Einfluss des Werthers auf die Entwicklung der literarischen Kritik
- Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen kulturellen Strömungen der Zeit (Aufklärung, Sturm und Drang)
- Die Rolle des Werthers im Kontext der zeitgenössischen Zeitkritik
- Die Bedeutung des Werthers für die Entwicklung des Briefromans und des Empfindsamkeitsromans
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wirkungsgeschichte von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ ein. Sie betont die enorme und vielseitige Reaktion auf Goethes Werk zu seinen Lebzeiten und erklärt, wie Goethe durch seine Werke bestehende Konventionen durchbrach und die Grenzen der Literatur erweiterte. Die Einleitung verweist auf Mandelkows Ausführungen zur Entstehung eines neuen, selbstbewussten Publikums und der Entwicklung der literarischen Kritik. Sie umreißt das Ziel der Arbeit: die Reaktionen auf den Werther vor dem geistigen Hintergrund der Zeit zu veranschaulichen und die Berechtigung von Lob und Kritik im Kontext der jeweiligen Weltanschauung zu verstehen. Die Arbeit betrachtet den Werther als Modellfall für die Entwicklung der literarischen Kritik und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Briefromans.
Der Begriff Wirkungsgeschichte: Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Wirkungsgeschichte“ im Kontext literaturwissenschaftlicher Betrachtung. Es betont die Bedeutung des historischen Hintergrunds, soziokultureller Strömungen und gesellschaftlicher Konventionen für das Verständnis der Rezeption eines Werkes. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Werkes durch die Leserschaft aus unterschiedlichen Schichten und geistigen Lagern zu verschiedenen Zeiten. Der Autor betont die Wichtigkeit, Kunst nicht ihrer Zeit zu entreißen und die Bedeutung der unterschiedlichen Konkretisationen eines Werkes zu berücksichtigen. Die Wirkungsgeschichte des Werthers dient als Beispiel für diese Betrachtungsweise.
Die Kulturepochen: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die kulturellen Strömungen der Zeit, in der Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ erschien, mit einem Fokus auf die Aufklärung und den Sturm und Drang. Es beschreibt die zentralen Merkmale der Aufklärung, wie die Betonung der Vernunft, die neue Staatslehre und die Bestrebungen nach einer Vernunftreligion. Die Literatur der Aufklärung hatte die Aufgabe, den Menschen zu erziehen und zu bilden. Dieses Kapitel legt den Grundstein zum Verständnis der komplexen Reaktionen auf den Werther im weiteren Verlauf der Arbeit.
Zeitkritik im Werther: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen verschiedener Gruppen auf Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, einschliesslich Rationalisten, Aufklärer, den orthodoxen Klerus, die Sturm und Dränger und das breite Publikum. Es untersucht die Kritikpunkte und die positiven Reaktionen und betrachtet diese im Kontext der herrschenden Ideologien und Weltanschauungen. Das Kapitel vermeidet eine bloße Beurteilung der Kritiken, sondern konzentriert sich auf das Verständnis des jeweiligen Kontextes, in dem die Meinungen gebildet wurden. Goethes eigene Rezension wird ebenfalls behandelt, wodurch ein umfassendes Bild der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit dem Werk entsteht.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werther, Goethe, Wirkungsgeschichte, Rezeption, Aufklärung, Sturm und Drang, Literaturkritik, Briefroman, Empfindsamkeit, Zeitkritik, gesellschaftliche Reaktionen, literarische Tradition.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Wirkungsgeschichte von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Wirkungsgeschichte von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Sie untersucht die vielfältigen Reaktionen auf das Werk aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen (Rationalisten, Aufklärer, Klerus, Sturm und Dränger, Publikum) und beleuchtet den Einfluss des Werthers auf die Entwicklung der literarischen Kritik und des Briefromans. Die Arbeit betrachtet den historischen Kontext (Aufklärung, Sturm und Drang) und erläutert den Begriff der Wirkungsgeschichte selbst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Rezeption des Werthers in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, den Einfluss des Werks auf die literarische Kritik, die Auseinandersetzung mit den kulturellen Strömungen der Zeit (Aufklärung und Sturm und Drang), die Rolle des Werthers in der zeitgenössischen Zeitkritik und seine Bedeutung für die Entwicklung des Briefromans und des Empfindsamkeitsromans.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Der Begriff Wirkungsgeschichte, Die Kulturepochen (Aufklärung und Sturm und Drang), Zeitkritik im Werther (Analyse der Reaktionen verschiedener Gruppen, inklusive Goethes eigener Rezension) und Schlusswort sowie Rezensionen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Aspekt der Wirkungsgeschichte.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, betont die enorme und vielseitige Reaktion auf Goethes Werk und erklärt, wie Goethe Konventionen durchbrach. Sie verweist auf die Entstehung eines neuen Publikums und der Entwicklung der literarischen Kritik und umreißt das Ziel der Arbeit: die Reaktionen auf den Werther vor dem geistigen Hintergrund der Zeit zu veranschaulichen und die Berechtigung von Lob und Kritik im Kontext der jeweiligen Weltanschauung zu verstehen.
Wie wird der Begriff "Wirkungsgeschichte" definiert?
Das Kapitel "Der Begriff Wirkungsgeschichte" erläutert den Begriff im literaturwissenschaftlichen Kontext. Es betont die Bedeutung des historischen Hintergrunds, soziokultureller Strömungen und gesellschaftlicher Konventionen für das Verständnis der Rezeption eines Werkes. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Werkes durch die Leserschaft aus verschiedenen Schichten und zu verschiedenen Zeiten.
Welche kulturellen Strömungen werden untersucht?
Das Kapitel "Die Kulturepochen" bietet einen Überblick über die Aufklärung und den Sturm und Drang, beschreibt deren Merkmale und legt den Grundstein zum Verständnis der Reaktionen auf den Werther.
Wie analysiert die Arbeit die Zeitkritik im Werther?
Das Kapitel "Zeitkritik im Werther" analysiert die Reaktionen verschiedener Gruppen (Rationalisten, Aufklärer, Klerus, Sturm und Dränger, Publikum) auf den Werther. Es untersucht Kritikpunkte und positive Reaktionen im Kontext der herrschenden Ideologien und Weltanschauungen und betrachtet auch Goethes eigene Rezension.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Leiden des jungen Werther, Goethe, Wirkungsgeschichte, Rezeption, Aufklärung, Sturm und Drang, Literaturkritik, Briefroman, Empfindsamkeit, Zeitkritik, gesellschaftliche Reaktionen, literarische Tradition.
- Quote paper
- Birgit Sedelmaier, Mag. (Author), 2003, Die Wirkungsgeschichte der "Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20639