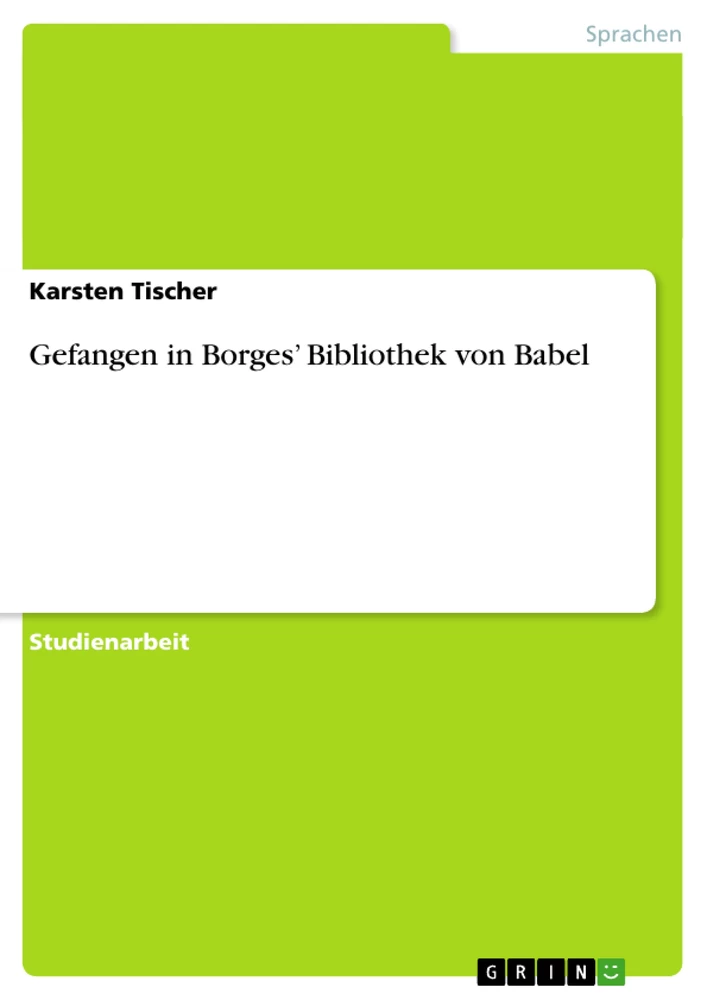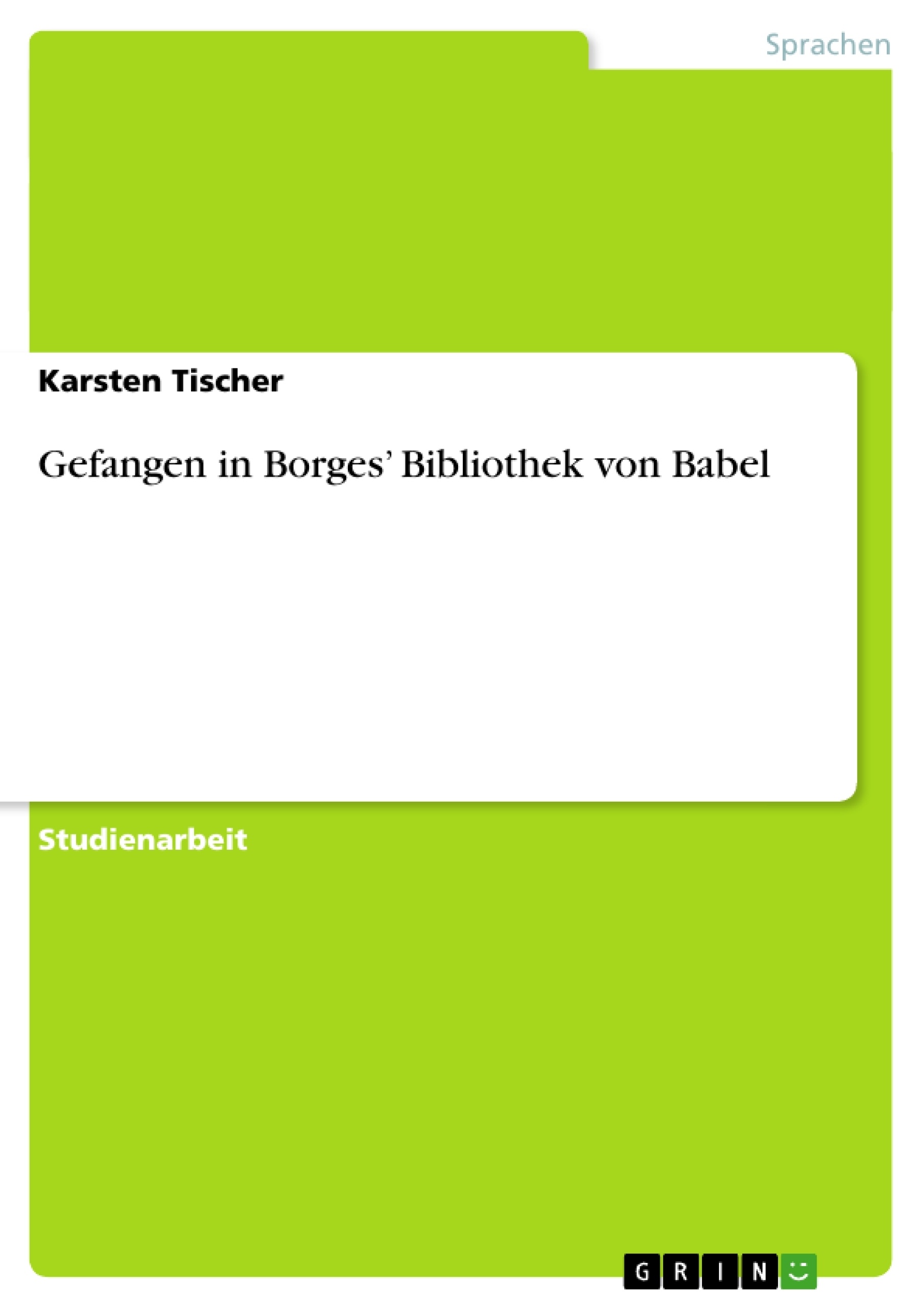Voll chaotischer Unordnung zeigt sich die Natur, die die Menschen umgibt. „Sie ist mysteriös und verhüllt, bietet sich der Erkenntnis nicht dar“.2 Und dennoch glaubt der Mensch, dass in diesem Durcheinander eine Ordnung, ein Sinn verborgen liegt, den es bloß zu entschlüsseln gilt. „Die Welt ist von Zeichen bedeckt, die man entziffern muß“,3 so der Antriebsgedanke der Suchenden. Die Kultur ist dabei das Raster, das über die Dinge gelegt wird und sie ordnet.4 Folglich bildet sich in der aufgespürten Ordnung nicht die natürliche, sondern eine menschengemachte ab: „Erkennen heißt also interpretieren“.5
Das entscheidende Merkmal, welches schließlich eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen den Dingen herstellt, ist dabei häufig völlig willkürlich ausgewählt.6
[...]
2 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. FfM: Suhrkamp 2003 (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 96), S. 60.
3 Ebd., S. 63.
4 Vgl. ebd., S. 23.
5 Ebd., S. 63.
6 Vgl. ebd., S. 56-59.
Foucault gibt einige Beispiele für derartige Verknüpfungen: So erlangte beispielsweise der Eisenhut seinen Status als Heilpflanze zur Behandlung von Augenerkrankungen, da dessen Samenkörner aussehen wie „kleine dunkle Kügelchen, eingefaßt in weiße Schalen“. Diese zufällige, rein optische „Signatur“ stellte erst die Verbindung zwischen beiden Dingen her. (Vgl. ebd., S. 58)
Inhalt
1 Einleitung
2 Das unendliche Zeichenuniversum
2.1 Bucherwelt
2.2 Systemkritik
3 Schluss
4 Bibliographie
„lch las vor einigen Tagen, daft der Mann, der den Bau der nahezu unendlichen Chinesischen Mauer anordnete, jener erster Kaiser war, Schih Huang Ti, der ebenso alle Bucher verbrennen lieft, die vor ihm da waren."
Jorge Luis Borges, Die Mauer und die Bucher [1]
1 Einleitung
Voll chaotischer Unordnung zeigt sich die Natur, die die Menschen umgibt. „Sie ist mysterios und verhullt, bietet sich der Erkenntnis nicht dar".[2] Und dennoch glaubt der Mensch, dass in diesem Durcheinander eine Ordnung, ein Sinn verborgen liegt, den es blob zu entschlusseln gilt. „Die Welt ist von Zeichen bedeckt, die man entziffern mub",[3] so der Antriebsgedanke der Suchenden. Die Kultur ist dabei das Raster, das uber die Dinge gelegt wird und sie ordnet.[4] Folglich bildet sich in der aufgespurten Ordnung nicht die naturliche, sondern eine menschengemachte ab: „Erkennen heibt also interpretieren".[5]
Das entscheidende Merkmal, welches schlieblich eine Ahnlichkeitsbeziehung zwischen den Dingen herstellt, ist dabei haufig vollig willkurlich ausgewahlt.[6] Im Laufe der Zeit verhullt dieses Verfahren der menschlichen Interpretation der Gegebenheiten die eigentliche, naturliche Welt ganzlich, so dass ein unmittelbarer Zugang zu dieser schlieblich unmoglich wird. Die menschliche Realitat ist eine virtuelle.
Entscheidend fur jene Verwandlung war die Sprache:
In ihrer ursprunglichen Form, als sie den Menschen von Gott gegeben wurde, war die Sprache ein absolut sicheres und wahres Zeichen der Dinge, weil sie ihnen ahnelte. [...] Diese Transparenz wurde in Babel als Bestrafung fur die Menschen zerstort.[7]
Seither wachst die Sprache ins Unendliche[8] ; sie erzeugt „eine Art Gegen-Welt"[9] und der Mensch irrt durch dieses dunkle Zeichenlabyrinth auf der unendlichen Suche nach der letzten Wahrheit und einem Sinn.[10]
Dieses manische Forschen im Chaos lasst Jorge Luis Borges in seiner Erzahlung Die Bibliothek von Babel (1941) ausgerechnet in einer Bibliothek stattfinden - einem Ort, der sich im Allgemeinen durch seine monotone Struktur auszeichnet, in der Wissen systematisch geordnet und fur jeden einfach zuganglich gemacht wird. In Die Bibliothek von Babel verkorpert diese Einrichtung nun nicht mehr einen kleinen Raum des Wissens, sondern das dUniversum"[11] im Ganzen. Es prasentiert sich als eine gewaltige Anhaufung von Zeichen, der scheinbar eine klare Ordnung und Sinn inharent ist. Doch der Versuch eben jenen Sinn zu erkennen, erweist sich als Albtraum. In seinen Bestrebungen, die Welt zu ,lesen', kann der Mensch nur einen Bruchteil dessen bewaltigen, was in den endlosen Regalen vorhanden ist.
Aus dieser Aussichtslosigkeit der eigenen, Lebenszeit raubenden Unternehmungen heraus, setzt der Ich-Erzahler einen Kontrapunkt, der sich gegen jenes permanente Uberlagern der Welt durch eine virtuelle Schicht der Interpretation, emport. Dies erfolgt in einer literarischen Form, die exakt diese Skepsis gegenuber einem fest verankerten Weltbild durch „Denkansto6e"[12] zum Ausdruck bringen kann - dem Essay. Der folgende Beitrag mochte sowohl versuchen, darzulegen, warum die Bibliothek von Babel eher einem Irrgarten gleicht, der die Menschen gefangen halt, als auch wie der Essay und die fur ihn typische „unabgeschlossene[ ] Wahrheitssuche"[13] einen Ausweg daraus sucht.
2 Das unendliche Zeichenuniversum 2.1 Bucherwelt
Erst die Transformation des „individuelle[n] Gedachtnis[ses]"[14] in ein „kollektive[s]"[15] durch das Medium der Schrift macht ein langfristiges Konservieren von Wissen uber die Dauer eines menschlichen Lebens hinaus moglich. Dieser Wandel findet in der Form der Bibliothek eine architektonische Entsprechung. An jenem Ort wird der stetig anwachsende Wissensfundus systematisch geordnet und allen gegenwartigen wie zukunftigen Generationen zuganglich gemacht.[16] „Die Bibliothek hat also, so konnte man sagen, einen eigenen Raum und eine eigene Zeit"[17]. Sie behandelt alle Bucher gleich - alte stehen neben neuen, wahre neben falschen[18] - ahnlich wie Schrift selbst blob „eine gleichmabige, leidenschaftslose Reihe von Zeichen" ist.[19]
Von diesem Bauwerk Bibliothek geht eine unglaublich beruhigende Wirkung aus: In ihr ist das uferlose Wissen uber die Welt geordnet und stabil an einem begrenzten Ort zu finden.[20] Sie stellt damit eine Art Gegenraum dar, der sich den ubrigen Orten widersetzt[21] - eine so genannte „Heterotopie"[22], wie Foucault es nennt: Dies sind „tatsachlich verwirklichte Utopien, in denen die realen Orte, all die anderen realen Orte, die man in der Kultur finden kann, zugleich reprasentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden."[23] Praziser gefasst ist die Bibliothek eine „Heterotopie[ ] der Zeit"[24]. Sie sammelt unaufhorlich Dinge; anders gesagt, sie hauft Zeit an[25], also etwas, das dem einzelnen Menschen permanent davonlauft.[26] Hier zeigt sich zum ersten Mal der beunruhigende Charakter der Bibliothek. Ihr Ziel, das gesamte Menschheitswissen fur die Ewigkeit zu erhalten, lasst die „vollige Nichtigkeit der Individuen"[27] erkennen. Dieser bedruckende Umstand ist nach Foucaults Konzept der Heterotopien jedoch von geringer Relevanz, sind Heterotopien doch „Gegenraume"[28], die in der Regel auch wieder verlassen werden konnen.[29]
In Die Bibliothek von Babel potenziert sich diese Bedrohung, indem es kein einzelner, abgeschlossener Raum mehr ist, den die Bibliothek darstellt, sondern eine Metapher fur die gesamte Welt: „Das Universum (das andere die Bibliothek nennen)" (67), ist die erste Feststellung des Ich-Erzahlers. Es ist demnach keine extern wirkende Gefahr, vielmehr eine vom Menschen produzierte. Er erkennt in den Strukturen der ihn umgebenden Welt eine sinnreiche ,Ordnung der Dinge'.[30] Daraus ergibt sich die Ahnlichkeit zu einer Bibliothek, die dem Verstand gleicht, der „entdeckt und baut; [der] [...] nicht nur ein forschender, sondern auch ein architektonischer Verstand [ist]."[31] Dieser liest die Zeichen, interpretiert sie und verknupft sie miteinander. Damit erzeugt der Mensch eine eigene Sicht auf die Dinge; eine virtuelle Realitat, die die eigentliche Wirklichkeit - wenn es so etwas uberhaupt gibt - verdeckt und unzuganglich macht.
[...]
[1] Jorge Luis Borges: Werke in 20 Banden. Hrsg. von Gisbert Haefs und FritzArnold. Bd. 7: Inquisitionen. Essays 1941-1 952. 2. Aufl. FfM: Fischer 2007, S.11.
[2] Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archaologie der Humanwissenschaften. FfM: Suhrkamp 2003 (= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 96), S. 60.
[3] Ebd., S. 63.
[4] Vgl. ebd., S. 23.
[5] Ebd., S. 63.
[6] Vgl. ebd., S. 56-59.
Foucault gibt einige Beispiele fur derartige Verknupfungen: So erlangte beispielsweise der Eisenhut seinen Status als Heilpflanze zur Behandlung von Augenerkrankungen, da dessen Samenkorner aussehen wie „kleine dunkle Kugelchen, eingefabt in weibe Schalen". Diese zufallige, rein optische „Signatur" stellte erst die Verbindung zwischen beiden Dingen her. (Vgl. ebd., S. 58)
[7] Ebd., S. 67.
[8] Vgl. ebd., S. 77.
[9] Michaela Greb: Die Sprachverwirrung und das Problem des Mythos. Vom Turmbau zu Babel zum Pfingstwunder. FfM: Peter Lang 2007 (= Wurzburger Studien zur Fundamentaltheologie 37), S.31.
[10] Tatsachlich muss die Suche endlos sein, wie Sextus Empiricus (um 200 n. Chr.) in einem Kommentar zum unendlichen Regress darlegt: „Wir sagen, dab das zur Bestatigung des fraglichen Gegenstandes Angefuhrte wieder einer anderen Bestatigung bedurfe und diese wiederum einer anderen und so ins Unendliche, so dab die Zuruckhaltung folge, da wir nicht wissen, wo wir mit der Begrundung beginnen sollen." (Susanne Zepp: Jorge Luis Borges und die Skepsis. Stuttgart: Franz Steiner 2003 (= Text und Kontext. Romanische Literaturen und Allgemeine Literaturwissenschaft20), S. 32) Der Mensch ist wie Achill, der versucht die langsame Schildkrote vor ihm einzuholen und es doch nie schafft, da sich mit jedem Neugewinn an Erkenntnis sich gleichsam neue Fragen ergeben.
[11] Jorge Luis Borges: Werke in 20 Banden. Hrsg. von Gisbert Haefs und Fritz Arnold. Bd. 5: Fiktionen. Erzahlungen 1939 - 1944. 9. Aufl. FfM: Fischer 2004, S. 67. Im Foigenden finden sich die Seifennachweise des Primartextes direkt hinter dem Zitat in runden Kiammern.
[12] Gero von Wilpert: Sachworterbuch der Literatur. 8. Aufl. Stuttgart: Kroner2001, S.241.
[13] Irmgard Schweikle und Kai Kauffmann: Essay. In: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. 3. Aufl. Hrsg. von Dieter Burdorf, Christoph Fasbender und Burkhard Moennighoff. Stuttgart: Metzler 2007, S. 210.
[14] Tanja Heber: Die Bibliothek als Speichersystem des kulturellen Gedachtnisses. Marburg: Tectum 2009, S. 117.
[15] Ebd.,S. 115.
[16] Vgl. ebd.,S. 136.
[17] Kirsten Dickhaut: Das Paradox der Bibliothek. Metapher, Gedachtnisort, Heterotopie. In: Erinnerung, Gedachtnis, Wissen. Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedachtnisforschung. Hrsg. von Gunter Oesterle. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht2005 (= Formen der Erinnerung 26), S. 312.
[18] Vgl. HeinzSchlaffer: Borges. FfM: Fischer 1993, S. 75.
[19] Ebd.,S. 8.
[20] Vgl. ebd.,S. 76.
[21] Vgl. Michel Foucault: Die Heterotopien. Der utopische Korper. Zwei Radiovortrage. FfM: Suhrkamp 2005, S. 10.
[22] Ebd.,S. 11.
[23] Michel Foucault: Von anderen Raumen. In: Schriften in vier Banden. Dits et Ecrits. Band IV: 1980-1988. Hrsg. von Daniel Defert und Frangois Ewald. FfM: Suhrkamp 2005, S. 935.
[24] M. Foucault: Heterotopien, S. 16.
[25] Vgl. M. Foucault: Von anderen Raumen, S. 939.
[26] „Leben ist Zeit verlieren." (Jorge Luis Borges: Werke in 20 Banden. Hrsg. von Gisbert Haefs und Fritz Arnold. Bd. 3: Niedertracht und Ewigkeit. Erzahlungen und Essays 1935- 1936. FfM: Fischer 1991, S. 119)
[27] Ebd.,S. 107.
[28] M. Foucault: Heterotopien, S. 10.
[29] „Als funften und letzten Grundsatz der Heterotopologie mochte ich die Tatsache anfuhren, dass Heterotopien stets ein System der Offnung und Abschlieftung besitzen, welches sie von der Umgebung isoliert." (Ebd.,S. 18)
[30] Das Ordnungsprinzip von Bibliotheken grundete sich fruher auf dem so genannten Ordo-Gedanke, d.h. man war uberzeugt, die Bibliothek spiegele eine Ordnung wieder, die von Gott stamme. (Vgl. K. Dickhaut: Das Paradox der Bibliothek, S. 301) Die Bibliothek ist ein Versuch „den verborgenen Strukturen unserer gewohnten Welt den Status einer evidenten Realitat [zu] verschaffen" (H. Schlaffer: Borges, S. 74).
Häufig gestellte Fragen zu diesem Text
Was ist der Hauptgegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht die Bibliothek von Babel als Metapher für das Universum und die menschliche Suche nach Sinn und Wahrheit in einem unendlichen Zeichenuniversum. Er thematisiert die Rolle der Sprache und der menschlichen Interpretation bei der Konstruktion einer virtuellen Realität, die den Zugang zur eigentlichen Wirklichkeit verdeckt.
Was ist die Bedeutung der Bibliothek in diesem Kontext?
Die Bibliothek, insbesondere in Borges' "Die Bibliothek von Babel", wird nicht nur als ein Ort der Ordnung und des Wissens dargestellt, sondern als ein Labyrinth, das die Menschen gefangen hält. Sie symbolisiert die überwältigende Menge an Informationen und die Schwierigkeit, darin Sinn zu finden.
Welche Rolle spielt die Sprache in dieser Analyse?
Die Sprache wird als ein Werkzeug der Interpretation und Konstruktion von Realität gesehen. Ursprünglich als Spiegel der Dinge gedacht, hat sie sich zu einem unendlichen Zeichenuniversum entwickelt, das den Menschen auf eine endlose Suche nach Wahrheit führt.
Was sind Heterotopien im Zusammenhang mit Bibliotheken, wie sie von Foucault beschrieben werden?
Foucault beschreibt Heterotopien als "Gegenräume", die reale Orte repräsentieren, in Frage stellen und ins Gegenteil verkehren. Bibliotheken sind "Heterotopien der Zeit", die Wissen sammeln und für die Ewigkeit bewahren, was die Nichtigkeit des Einzelnen hervorheben kann.
Welchen Bezug hat der Essay zu dieser Thematik?
Der Text schlägt vor, dass der Essay mit seiner "unabgeschlossenen Wahrheitssuche" einen Ausweg aus dem Labyrinth der Bibliothek von Babel bieten kann, indem er Denkanstöße gibt und Skepsis gegenüber einem festen Weltbild zum Ausdruck bringt.
Wer sind die zitierten Autoren und ihre Hauptaussagen?
Der Text zitiert unter anderem Jorge Luis Borges über die Beziehung zwischen dem Bau der Chinesischen Mauer und dem Verbrennen von Büchern sowie über die Bibliothek als Universum. Michel Foucault wird zitiert bezüglich der Ordnung der Dinge und der Rolle der Sprache. Weitere Autoren werden zitiert, um Konzepte wie Heterotopien und die Bedeutung der Bibliothek als Speichersystem des kulturellen Gedächtnisses zu erläutern.
Was ist der "Ordo-Gedanke" in Bezug auf Bibliotheken?
Der "Ordo-Gedanke" bezieht sich auf die frühere Überzeugung, dass die Ordnung einer Bibliothek eine von Gott gegebene Ordnung widerspiegelt, was die Bibliothek zu einem Versuch macht, die verborgenen Strukturen unserer Welt als evidente Realität darzustellen.
- Citar trabajo
- Karsten Tischer (Autor), 2012, Gefangen in Borges’ Bibliothek von Babel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206138