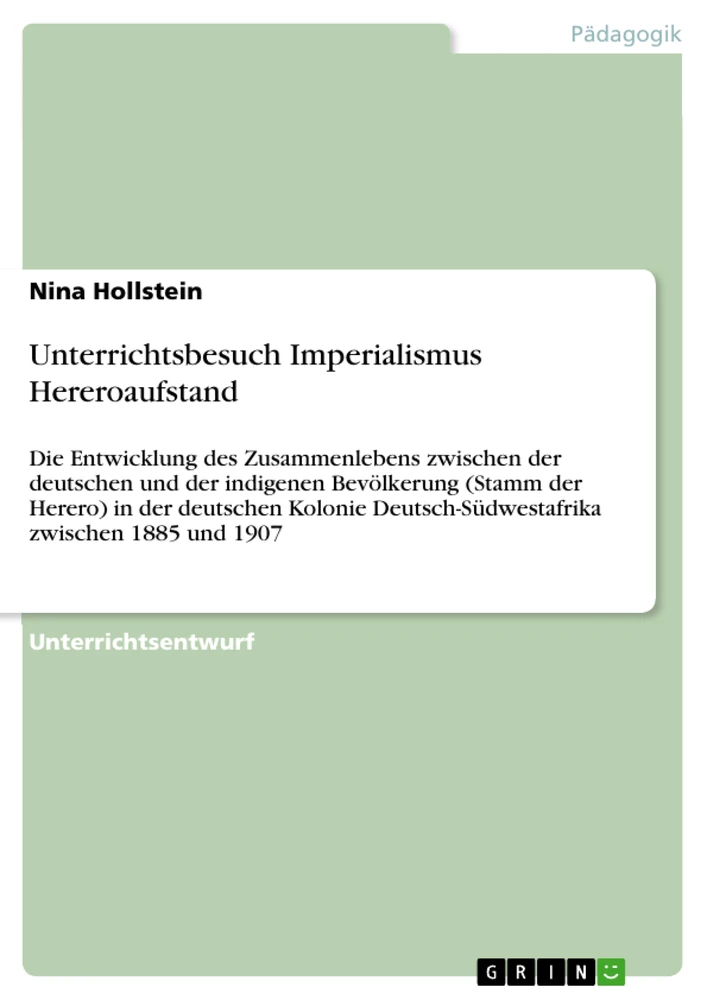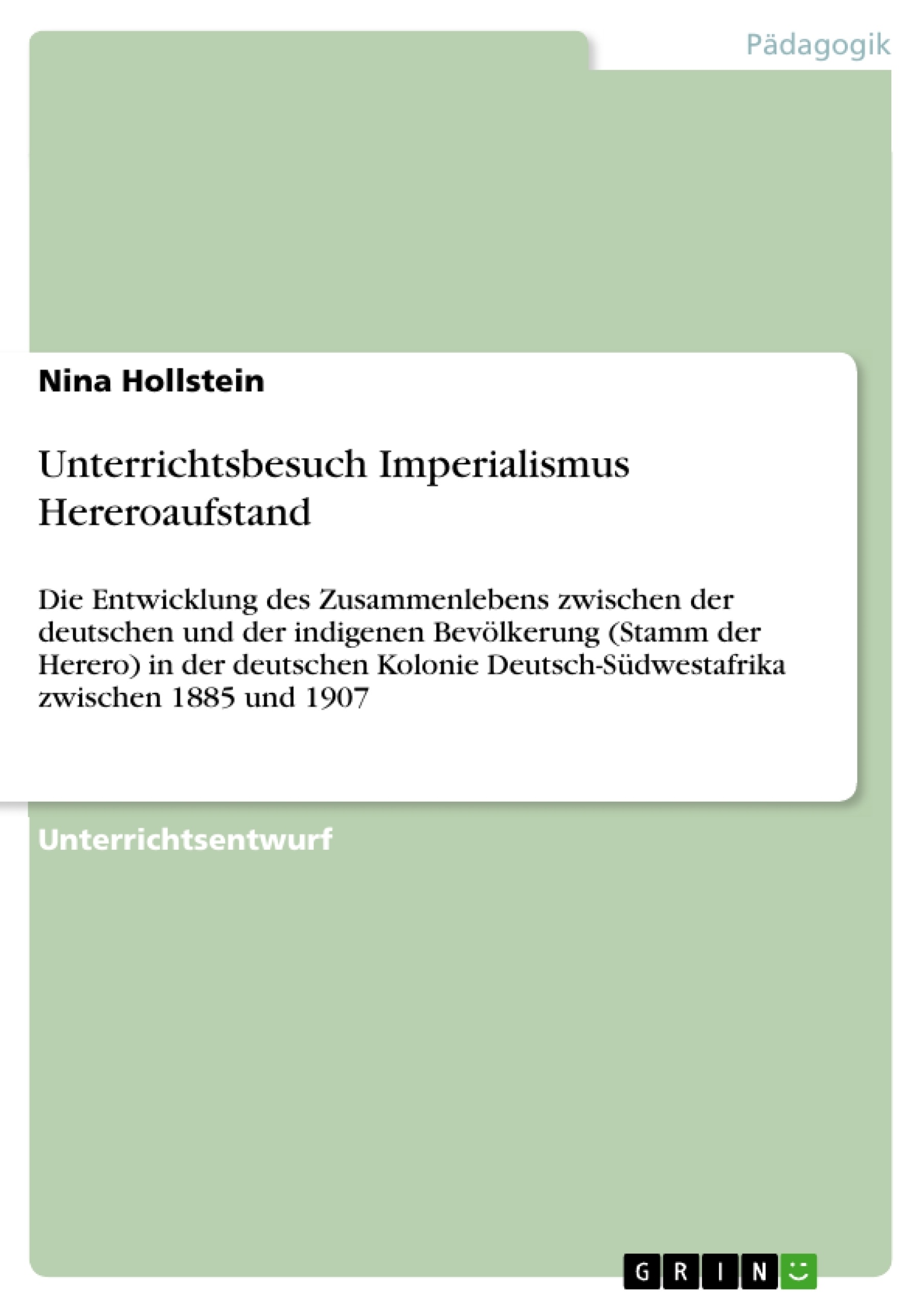Die vorliegende Stunde ist die fünfte Stunde innerhalb einer zehnstündigen Unterrichtsreihe zum Thema ‚Das Zeitalter des Imperialismus‘. In diesem Zusammenhang haben sich die SuS zunächst mit dem Begriff ‚Imperialismus‘ befasst und Leitfragen an die neue Unterrichtseinheit formuliert (vgl. Relevanzanalyse). Nun wurden allgemeine Gründe, die das imperialistische Streben von Großmächten verursachten, erarbeitet. Daran anschließend rückte das Deutsche Kaiserreich in den Fokus der Betrachtung. Nachdem die Gründe erarbeitet wurden, die eine anfängliche Zurückhaltung in der Kolonialfrage seitens der deutschen Reichsregierung bis 1884 begründeten, schloss sich die Thematisierung der Kursänderung ab 1884/85 innerhalb der dt. Kolonialpolitik an. Um einen konkreten Einblick in die Kolonialpolitik zu gewinnen, wurde in der vorangegangenen Stunde die Kolonie Deutsch-Südwestafrika (heutiges Namibia) einführend thematisiert. Die heutige Stunde knüpft an dieses Thema an, indem die SuS die zentralen und spezifischen historischen Ereignisse und Prozesse in der Kolonie im Hinblick auf Anlässe, Ursachen und Folgen untersuchen und bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkungen zur Lerngruppe
- Bemerkungen zum Unterrichtszusammenhang
- Sachanalyse
- Didaktische Überlegungen
- Relevanzanalyse
- Konzeption des Lern- und Erkenntnisprozesses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtseinheit ist es, den Schülerinnen und Schülern einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Zusammenlebens zwischen der deutschen und der indigenen Bevölkerung (Herero) in Deutsch-Südwestafrika zwischen 1884 und 1907 zu ermöglichen. Die Schüler sollen lernen, historische Ereignisse und Prozesse zu untersuchen, Ursachen und Folgen zu analysieren und kritisch zu bewerten. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Kolonialvertrags von 1885 und dessen Bruch, den daraus resultierenden Konflikten und den weitreichenden Folgen für die Herero-Bevölkerung.
- Der Kolonialvertrag von 1885 zwischen dem Deutschen Reich und den Herero
- Die systematische Etablierung deutscher Herrschaft in Deutsch-Südwestafrika
- Der Herero-Aufstand von 1904 und die darauf folgende deutsche Vergeltung
- Die Rolle der deutschen Kolonialpropaganda
- Die Kontroverse um die Einordnung des deutschen Vorgehens als Genozid
Zusammenfassung der Kapitel
Anmerkungen zur Lerngruppe: Dieser Abschnitt wurde zur Anonymisierung entfernt.
Bemerkungen zum Unterrichtszusammenhang: Diese Stunde ist die fünfte in einer Reihe zum Imperialismus. Die Schüler haben bereits den Begriff "Imperialismus" erarbeitet, allgemeine Ursachen imperialistischen Strebens untersucht und sich mit der deutschen Kolonialpolitik bis 1884 auseinandergesetzt. Die vorherige Stunde behandelte einführend die Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Die aktuelle Stunde baut darauf auf und untersucht die spezifischen Ereignisse und Prozesse in der Kolonie bezüglich Ursachen und Folgen.
Sachanalyse: Die Sachanalyse beschreibt detailliert die Geschichte Deutsch-Südwestafrikas von der Etablierung der deutschen Kolonialherrschaft 1884 bis zum Ende des Herero-Krieges und darüber hinaus. Sie beleuchtet den Schutzvertrag von 1885 zwischen dem Deutschen Reich und den Herero, die zunehmende deutsche Dominanz, die Missachtung des Vertrages durch deutsche Siedler, den Herero-Aufstand, die brutale Vergeltungsaktion der deutschen Truppen unter Generalleutnant von Trotha, und die genozidale Politik, die zur drastischen Reduktion der Herero-Bevölkerung führte. Die Analyse umfasst auch die Rolle der deutschen Kolonialpropaganda zur Rechtfertigung der eigenen Handlungen. Der Abschnitt endet mit der Diskussion um die Einordnung der deutschen Maßnahmen als Genozid.
Didaktische Überlegungen: Relevanzanalyse: Die Relevanzanalyse rechtfertigt die Wahl des Themas sowohl fachlich (Rahmenrichtlinien des Kerncurriculums) als auch schüler- und gesellschaftsrelevant. Die Schüler sollen Sachkompetenz im Umgang mit Kolonialismus erwerben und ihre Deutungs- und Reflexionskompetenz schulen. Die Schülerfrage nach dem Umgang der Kolonialmacht mit der indigenen Bevölkerung bildete den Ausgangspunkt der Themeneinstieg.
Didaktische Überlegungen: Konzeption des Lern- und Erkenntnisprozesses: Die Stunde folgt einem problemorientierten Ansatz. Die Schüler werden mit dem Schutzvertrag von 1885 und einem Bild abgemagerter Herero konfrontiert und sollen die Diskrepanz zwischen beiden erklären. Ein Arbeitsblatt (M2) dient der Erarbeitung der Ereignisse zwischen 1885 und 1907. Die Schüler sollen die Informationen analysieren und einen Transfer zum Vertrag leisten, um die Vertragsbrüche der Deutschen zu identifizieren. Der Fokus liegt auf der Frage, wie es trotz des Vertrags zu der grausamen Behandlung der Herero kam.
Schlüsselwörter
Deutsch-Südwestafrika, Herero, Imperialismus, Kolonialismus, Schutzvertrag, Genozid, Rassenkrieg, Kolonialpropaganda, Generalleutnant Lothar von Trotha, Vertragsbruch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsch-Südwestafrika: Herero und der Kolonialvertrag von 1885
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Unterrichtsvorbereitung für eine Schulstunde zum Thema Deutsch-Südwestafrika, speziell zum Umgang der deutschen Kolonialmacht mit der Herero-Bevölkerung zwischen 1884 und 1907. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Kolonialvertrags von 1885, dessen Bruch und den daraus resultierenden Konflikten, einschließlich der Diskussion um die Einordnung des deutschen Vorgehens als Genozid.
Welche Themen werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind der Kolonialvertrag von 1885 zwischen dem Deutschen Reich und den Herero, die Etablierung deutscher Herrschaft in Deutsch-Südwestafrika, der Herero-Aufstand von 1904, die deutsche Vergeltung, die Rolle der deutschen Kolonialpropaganda und die Kontroverse um den Genozid an den Herero.
Welche Zielsetzung verfolgt die Unterrichtseinheit?
Die Unterrichtseinheit soll den Schülerinnen und Schülern einen detaillierten Einblick in die Entwicklung des Zusammenlebens zwischen der deutschen und der indigenen Bevölkerung (Herero) in Deutsch-Südwestafrika ermöglichen. Sie sollen lernen, historische Ereignisse und Prozesse zu untersuchen, Ursachen und Folgen zu analysieren und kritisch zu bewerten.
Wie ist die Stunde didaktisch aufgebaut?
Die Stunde folgt einem problemorientierten Ansatz. Die Schüler werden mit dem Schutzvertrag von 1885 und einem Bild abgemagerter Herero konfrontiert und sollen die Diskrepanz zwischen beiden erklären. Ein Arbeitsblatt unterstützt die Erarbeitung der Ereignisse zwischen 1885 und 1907. Der Fokus liegt auf der Frage, wie es trotz des Vertrags zu der grausamen Behandlung der Herero kam.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Deutsch-Südwestafrika, Herero, Imperialismus, Kolonialismus, Schutzvertrag, Genozid, Rassenkrieg, Kolonialpropaganda, Generalleutnant Lothar von Trotha, Vertragsbruch.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Das Dokument beinhaltet Zusammenfassungen zu Anmerkungen zur Lerngruppe (anonymisiert), Bemerkungen zum Unterrichtszusammenhang (Einordnung in den Stundenverlauf), Sachanalyse (detaillierte Darstellung der historischen Ereignisse), und didaktische Überlegungen (Relevanzanalyse und Konzeption des Lernprozesses).
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist primär für Lehrkräfte gedacht, die eine Unterrichtseinheit zum Thema Deutsch-Südwestafrika und der Kolonialgeschichte vorbereiten. Es dient als detaillierte Planungsgrundlage.
Wie wird der Genozid im Kontext des Dokuments behandelt?
Der Genozid an den Herero wird als zentrale Thematik behandelt. Die Sachanalyse beleuchtet die brutale Vergeltungsaktion der deutschen Truppen und die Diskussion um die Einordnung der deutschen Maßnahmen als Genozid.
- Citar trabajo
- Nina Hollstein (Autor), 2009, Unterrichtsbesuch Imperialismus Hereroaufstand , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206035