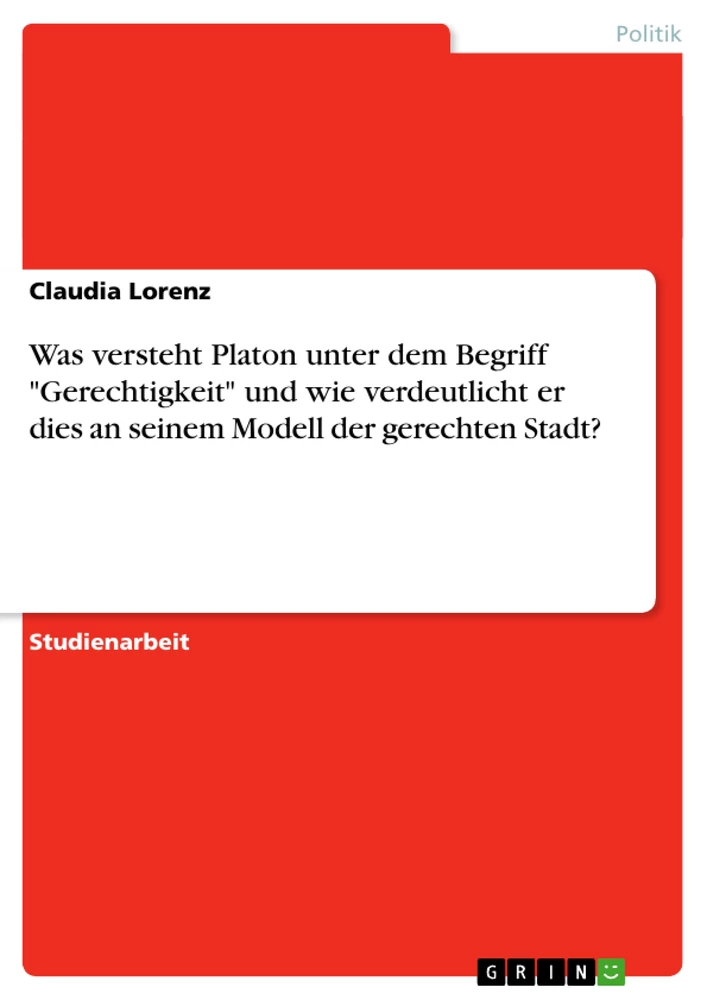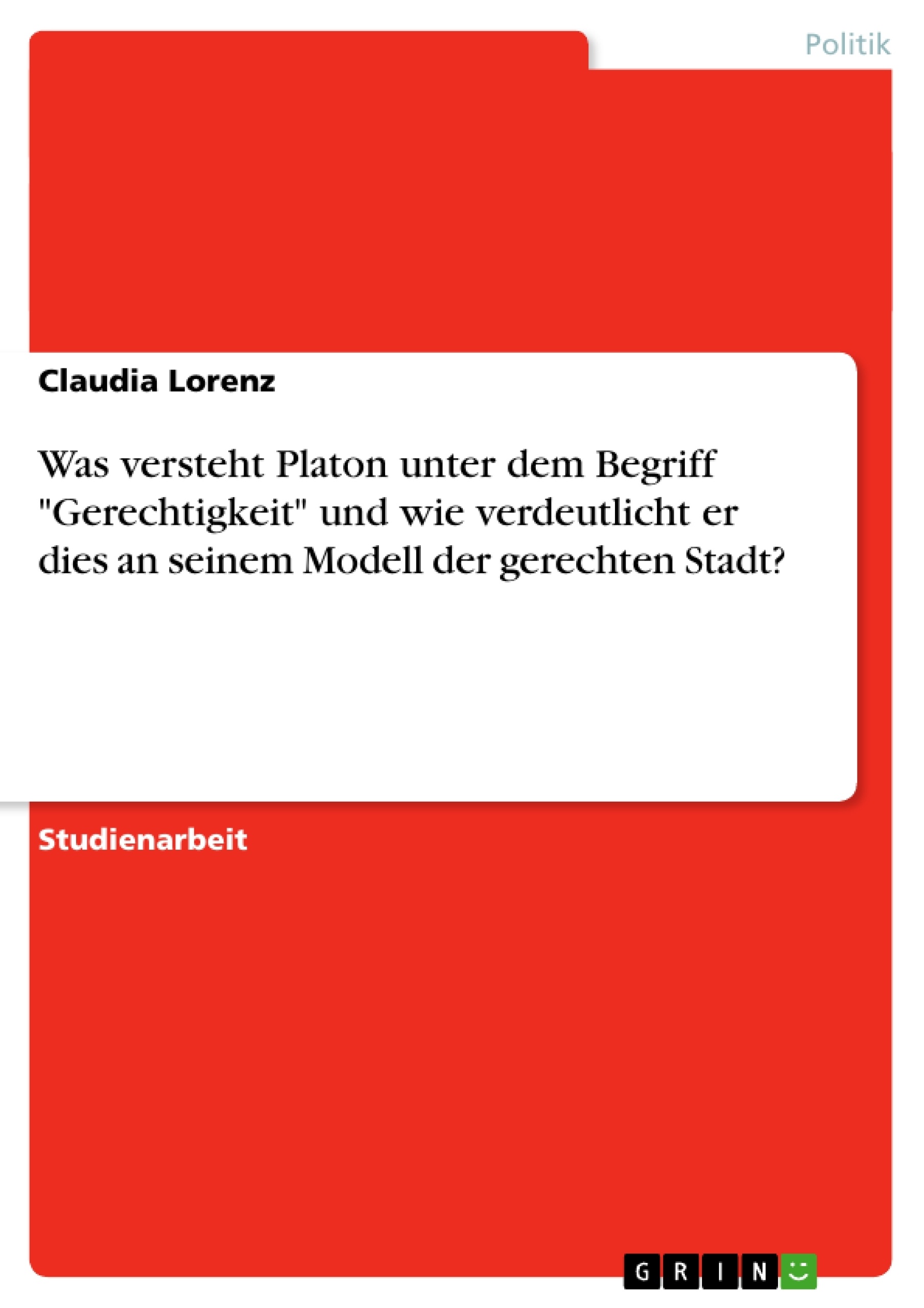Platon hat sich in seinen Werken intensiv mit der Frage nach
der Gerechtigkeit beschäftigt. So kündigt sich seine Politeia
zwar im Titel nur als ein Beitrag zur politischen Philosophie
oder Staatsphilosophie an, aber ihr wurde später der
Untertitel „Über das Gerechte“ (peri tou dikaiou) hinzugefügt.
„Die Politeia ist Platons philosophisches und politisches
Hauptwerk“ 1.
Sie behandelt neben der Gerechtigkeit viele Teilgebiete: sie
befaßt sich mit einer Erziehungslehre, sie vertritt die
Gleichberechtigung von Mann und Frau, sie entfaltet eine
Kritik der Dichtung sowie auch eine Theorie der Musik.
Nicht zuletzt ist der Höhepunkt der Politeia die Idee des
Guten. Die Gerechtigkeit ist allerdings der rote Faden, der
sich durch das ganze Werk zieht.
Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit Platons
Definition der Gerechtigkeit. Deswegen werde ich nicht auf
alle Teilgebiete eingehen, sondern mich hauptsächlich auf die
Bücher I bis V beschränken. Diese beinhalten das Problem der
Gerechtigkeit und ihres Nutzens und die Darstellung der
Gerechtigkeit an einem Modell der gerechten Stadt. Ich möchte
mich dabei eng an die Struktur halten, die Platon in seinem
Werk verwendet, um an seine Definition der Gerechtigkeit
hinzuführen.
Gängige Vorstellungen der Gerechtigkeit
Die Politeia beginnt mit mehreren Dialogen, wobei Sokrates von
unterschiedlichen Gesprächspartnern deren Vorstellung von
Gerechtigkeit erzählt bekommt. Diese ersten Versuche einer
Gerechtigkeitsdefinition sind geläufige Vorstellungen der
Gerechtigkeit, die auch meist bei der Allgemeinheit zu finden
sind. Sokrates erster Gesprächspartner ist Kephalos. Dieser Dialog
bildet die Ausgangslage einer philosophischen
Gerechtigkeitsuntersuchung. Über Sokrates` Frage nach dem
Reichtum Kephalos und seinem Nutzen daraus, gelangen sie
schnell zum Hauptthema. Nach Kephalos sind wir unseren
Mitmenschen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit schuldig.
„Wahrhaftigkeit heißt dabei soviel wie, ein ehrlicher
Geschäftsmann sein, niemanden betrügen, niemanden etwas
schuldig bleiben“.2 [...]
1 Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Band 1 / 2, S.22
2 Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Band 1 / 2, S.26
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung der Definition der Gerechtigkeit bei Platon
- Gängige Vorstellungen der Gerechtigkeit
- Das Gespräch mit Kephalos – Gerechtigkeit ist Wahrhaftigkeit und Wiedergeben, was man empfangen Hat
- Das Gespräch mit Polemarchos – Gerechtigkeit ist Freunden zu nützen und Feinden zu schaden
- Das Gespräch mit Thrasymachos – Gerechtigkeit ist der Vorteil des Stärkeren
- Das Gespräch mit Glaukon – Fortführung vom ,,Lob der Ungerechtigkeit
- Die Entstehung der Polis
- Vom Urstaat zum aufgedunsenen Staat
- Vom aufgedunsenen Staat zum vollkommenen Staat
- Die vollkommene Polis
- Platons Stände
- Die Wächter und Regenten
- Der Mythos als Legitimation der Ungleichheit
- Weitere Funktionen der Wächter und Regenten
- Platons Kardinaltugenden
- Die Weisheit
- Die Tapferkeit
- Die Besonnenheit
- Die Gerechtigkeit
- Die Gerechtigkeit im Staat
- Die Gerechtigkeit in der Seele
- Gängige Vorstellungen der Gerechtigkeit
- Platons Definition der Gerechtigkeit im Kontext der "Politeia"
- Die Rolle des Dialogs in der Entwicklung der Gerechtigkeitsdefinition
- Das Modell der gerechten Stadt als Instrument zur Veranschaulichung der Gerechtigkeit
- Die Bedeutung der Kardinaltugenden für die Gerechtigkeit
- Die Verbindung von politischer und individueller Gerechtigkeit
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Sie erläutert kurz die Bedeutung der "Politeia" und Platons Definition der Gerechtigkeit im Kontext der politischen Philosophie.
- Die Entstehung der Definition der Gerechtigkeit bei Platon: Dieses Kapitel untersucht Platons Definition der Gerechtigkeit anhand von verschiedenen Dialogen, die er in seinem Werk ,,Politeia" führt. Es zeigt, wie Platon gängige Vorstellungen von Gerechtigkeit aufgreift und kritisiert, um so zu seiner eigenen Definition zu gelangen.
- Gängige Vorstellungen der Gerechtigkeit: Dieses Unterkapitel analysiert die Definitionen der Gerechtigkeit, die Sokrates von verschiedenen Gesprächspartnern präsentiert bekommt. Diese Definitionen basieren auf allgemeinen und intuitiven Vorstellungen von Gerechtigkeit, die jedoch von Sokrates kritisch hinterfragt werden.
- Das Gespräch mit Kephalos: Kephalos definiert Gerechtigkeit als Wahrhaftigkeit und Wiedergabe von Schulden. Sokrates widerlegt diese Definition, indem er zeigt, dass sie in bestimmten Situationen nicht gerecht ist.
- Das Gespräch mit Polemarchos: Polemarchos erweitert die Definition der Gerechtigkeit, indem er argumentiert, dass es Freunden gebührt, Gutes zu tun, und Feinden, Böses. Auch diese Definition hält Sokrates Kritik stand, da sie nicht erklären kann, wie man Freunde von Feinden unterscheidet und wie man auf eine ungerechte Handlung mit Gerechtigkeit reagiert.
- Das Gespräch mit Thrasymachos: Thrasymachos definiert Gerechtigkeit als den Vorteil des Stärkeren. Sokrates konfrontiert Thrasymachos mit Argumenten, die diese Definition in Frage stellen und zeigen, dass der Vorteil des Stärkeren nicht unbedingt mit der Gerechtigkeit übereinstimmt.
- Das Gespräch mit Glaukon: Glaukon setzt sich mit der Frage auseinander, ob Ungerechtigkeit manchmal vorteilhafter ist als Gerechtigkeit. Er argumentiert, dass die Ungerechtigkeit für den Einzelnen im gewissen Sinne profitabler sein kann, und stellt Sokrates vor die Aufgabe, die Gerechtigkeit als etwas intrinsisch Gutes zu verteidigen.
- Die Entstehung der Polis: Dieses Unterkapitel beschreibt Platons Modell der Entstehung des Staates. Es erklärt, wie der Staat aus der Notwendigkeit entsteht, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, und wie er sich von einer einfachen Gemeinschaft zu einem komplexen und hierarchisch strukturierten Staat entwickelt.
- Platons Stände: Dieses Unterkapitel stellt Platons Theorie der sozialen Ordnung dar. Es erläutert die drei Stände – Wächter, Krieger und Produzenten – und ihre jeweiligen Aufgaben und Funktionen im Staat. Es analysiert die Rolle der Wächter als Hüter der Gerechtigkeit und die Legitimation der Ungleichheit durch den Mythos.
- Platons Kardinaltugenden: Dieses Unterkapitel befasst sich mit den vier Kardinaltugenden der Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Es untersucht, wie jede dieser Tugenden zur Entstehung einer gerechten Gesellschaft beiträgt und wie sie sich auf das Individuum übertragen lassen.
- Gängige Vorstellungen der Gerechtigkeit: Dieses Unterkapitel analysiert die Definitionen der Gerechtigkeit, die Sokrates von verschiedenen Gesprächspartnern präsentiert bekommt. Diese Definitionen basieren auf allgemeinen und intuitiven Vorstellungen von Gerechtigkeit, die jedoch von Sokrates kritisch hinterfragt werden.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Platons Definition der Gerechtigkeit, die er in seinem Werk ,,Politeia" entwickelt. Im Fokus steht die Frage, wie Platon die Gerechtigkeit definiert und welche Argumentationsstrategie er dabei verwendet. Dabei wird sich vor allem auf die ersten fünf Bücher der "Politeia" konzentriert, in denen die Definition der Gerechtigkeit an einem Modell der gerechten Stadt entwickelt wird. Die Arbeit folgt dabei eng der Struktur, die Platon in seinem Werk verwendet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Platons Definition der Gerechtigkeit in seinem Werk „Politeia". Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gerechtigkeit, Staatsphilosophie, Dialog, "Politeia", Stände, Kardinaltugenden, Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit, Seele, Mythos, Legitimation, Ungleichheit.
- Quote paper
- Claudia Lorenz (Author), 2003, Was versteht Platon unter dem Begriff "Gerechtigkeit" und wie verdeutlicht er dies an seinem Modell der gerechten Stadt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20600