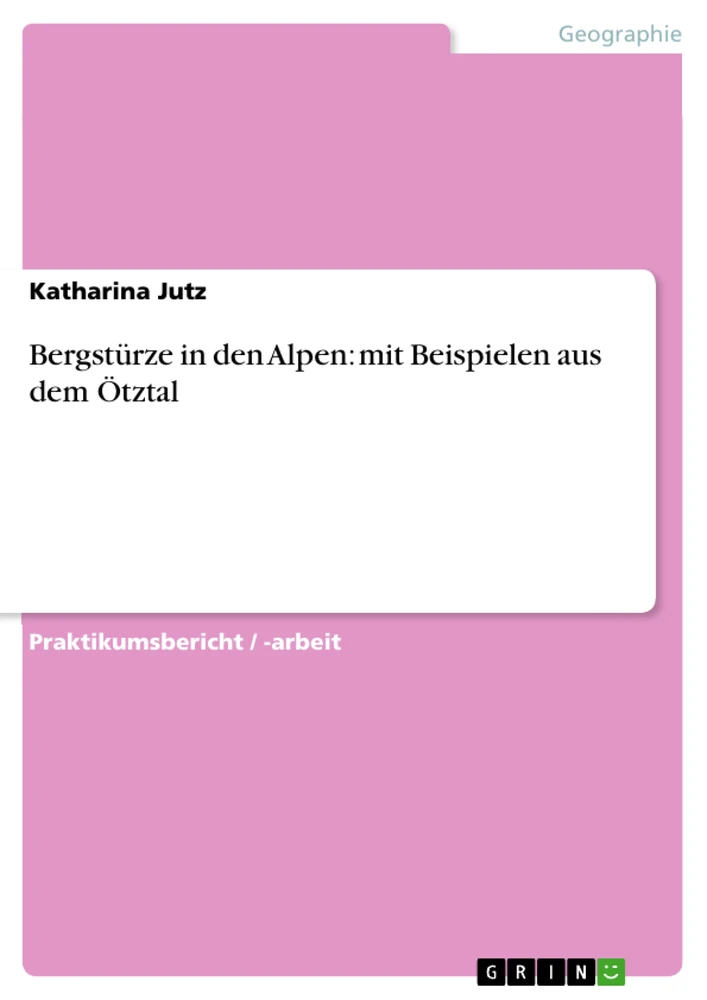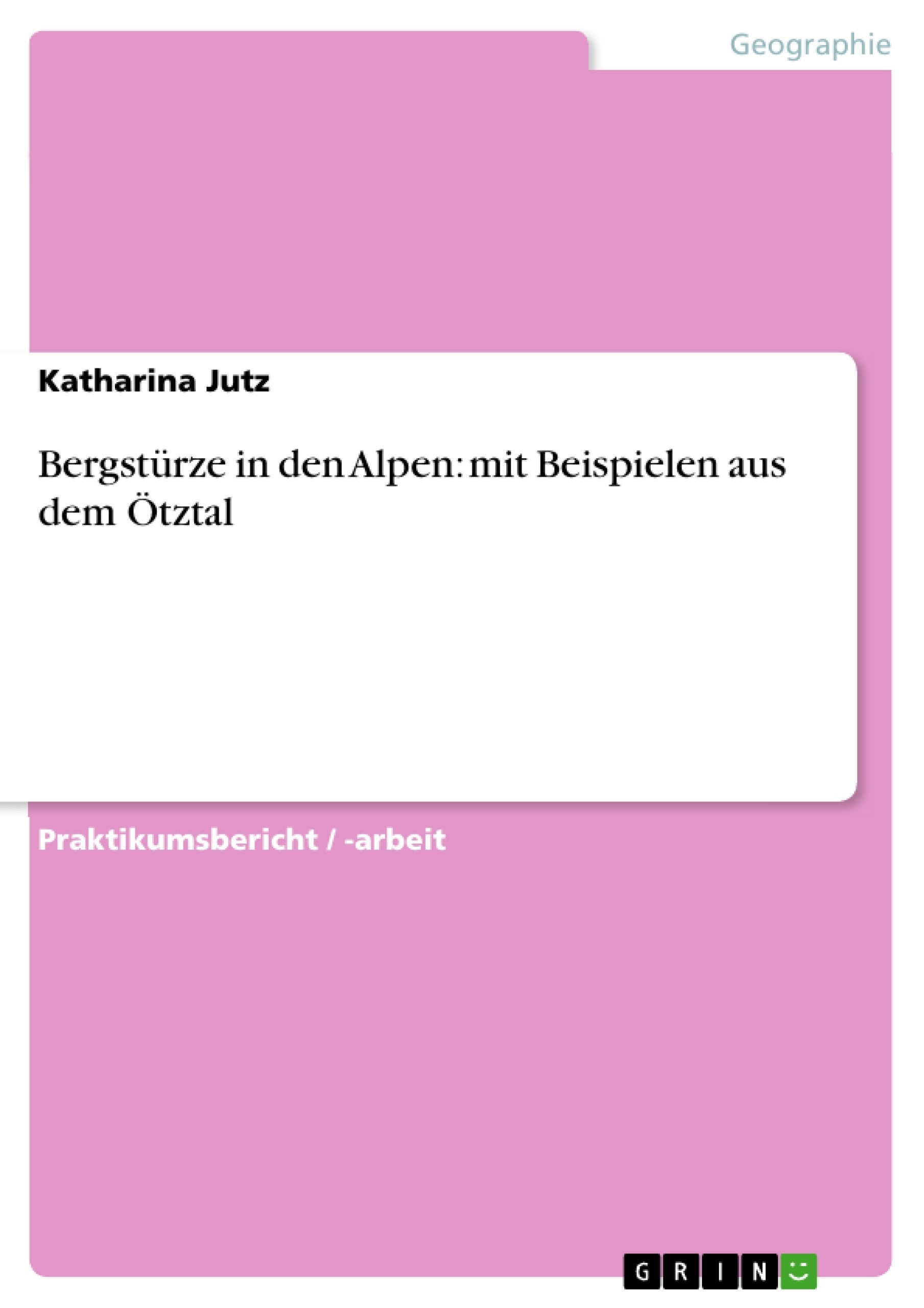Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Physiogeographisches Geländepraktikum“ besteht die Aufgabe eine wissenschaftliche Einzelarbeit zu einem ausgewählten Thema zu schreiben.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Bergstürzen im Ötztal. Zu Beginn der Arbeit wird durch eine Definition von Abele und Ersimann zuerst mal erläutert, was Bergstürze sind. Anschließend folgt eine detaillierte Ausarbeitung zu der Unterteilung des Bergsturzgebietes, den Ursachen und Auslösern und den Folgeerscheinungen. Im Anschluss daran wird etwas näher auf die Bergstürze im Ötztal eingegangen. Dabei wird der Bergsturz von Köfels und der Tschirgant Bergsturz näher erläutert.
Die Arbeit stützt sich größtenteils auf die Publikation von Gerhard Abele – „Bergstürze in den Alpen – Ihre Verbreitung, Morphologie und Folgeerscheinungen“ von 1974. Weiteres wurde auch noch Literatur von Aichinger, Erismann, Louis und Mayer hinzugezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Unterteilung des Bergsturzgebietes
- 3.1. Abbruchgebiet
- 3.2. Bergsturzfahrbahn
- 3.2.1. Streuung
- 3.3. Ablagerungsgebiet
- 4. Ursachen und Auslöser
- 4.1. Grunddispositionen
- 4.2. Variable Dispositionen
- 4.3. Auslöser
- 5. Folgeerscheinungen
- 5.1. Physisch-geographische Folgen
- 5.2. Anthropogeographische Folgen
- 6. Bergstürze im Ötztal
- 6.1. Köfler Bergsturz
- 6.2. Tschirgant
- 6.3. Habichen und Tumpen
- 7. Quellen
- 8. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Bergstürze im Ötztal, basierend auf der Definition und Klassifizierung von Abele und Erismann. Ziel ist es, die Unterteilung des Bergsturzgebietes, die Ursachen und Auslöser sowie die Folgeerscheinungen zu erläutern und an Beispielen aus dem Ötztal zu veranschaulichen.
- Definition und Klassifizierung von Bergstürzen
- Unterteilung des Bergsturzgebietes (Abbruch-, Fahrbahn-, Ablagerungsgebiet)
- Ursachen und Auslöser von Bergstürzen (geologische und klimatische Faktoren)
- Physisch-geographische und anthropogeographische Folgen von Bergstürzen
- Beispiele für Bergstürze im Ötztal
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Zweck der Arbeit – eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Bergstürzen im Ötztal im Rahmen eines physiogeographischen Geländepraktikums. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit einer Definition von Bergstürzen, gefolgt von einer detaillierten Analyse der Gebiete, Ursachen, Auslöser und Folgen, bevor sie sich auf konkrete Beispiele im Ötztal konzentriert, insbesondere den Köfels- und den Tschirgant-Bergsturz. Die Arbeit basiert hauptsächlich auf Abele (1974) und weiteren Quellen, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind.
2. Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Bergsturz“. Es verdeutlicht die Schwierigkeit einer präzisen Definition aufgrund der Variabilität von Massenbewegungen in Größe, Ursache, Mechanismus, Geschwindigkeit und Zerfallsgrad. Die Arbeit stützt sich auf die Kriterien von Abele (Größe und Geschwindigkeit), der Bergstürze als Fels- und Schuttbewegungen mit hoher Geschwindigkeit definiert, die ein bestimmtes Volumen überschreiten oder eine Mindestfläche bedecken. Im Gegensatz dazu diskutiert sie Erismanns Ansatz, der sich auf charakteristische Merkmale wie Geschwindigkeit und die fehlende Behinderung beim Absturz konzentriert. Der Unterschied zwischen Abels quantitativer und Erismanns qualitativer Betrachtungsweise wird hervorgehoben.
3. Unterteilung des Bergsturzgebietes: Dieses Kapitel unterteilt das Bergsturzgebiet in drei Bereiche: das Abbruchgebiet, die Bergsturzfahrbahn und das Ablagerungsgebiet. Die Rekonstruktion des Abbruchgebiets vor dem Bergsturz wird als schwierig beschrieben, wobei der Vergleich mit angrenzenden Hängen und Volumenberechnungen herangezogen werden. Der Hangwinkel vor dem Bergsturz spielt eine wichtige Rolle, ebenso die petrographische Beschaffenheit des Gesteins. Es wird der Zusammenhang zwischen Hangwinkel, Form des Abbruchgebietes, Gesteinsart und Volumen des Bergsturzes beleuchtet. Die Bedeutung von Gleitflächen wird diskutiert, wobei der Unterschied zwischen Bergstürzen mit und ohne vorher existierende Gleitflächen herausgestellt wird.
4. Ursachen und Auslöser: Dieses Kapitel behandelt die Ursachen und Auslöser von Bergstürzen. Es unterscheidet zwischen Grunddispositionen (z.B. geologische Schwächezonen) und variablen Dispositionen (z.B. Wassergehalt des Gesteins). Auslöser wie starke Regenfälle oder Erdbeben werden ebenfalls thematisiert. Es wird die Rolle von Schwächezonen im Gestein, wie Klüfte und Spalten, hervorgehoben, die das Loslösen des Materials begünstigen. Der Prozess des hangabwärts gerichteten Bewegens, sei es springend oder rollend, wird beschrieben. Die Kapitel unterscheidet zwischen den drei Zonen eines Bergsturzes.
5. Folgeerscheinungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen von Bergstürzen, unterteilt in physisch-geographische und anthropogeographische Auswirkungen. Die physisch-geographischen Folgen umfassen Veränderungen in der Landschaft, die Bildung neuer Seen oder die Beeinträchtigung von Flussläufen. Die anthropogeographischen Folgen betreffen potenzielle Schäden an Infrastruktur, Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen sowie Gefahren für die Bevölkerung. Es wird die weitreichende und tiefgreifende Wirkung von Bergstürzen auf die Umwelt und den Menschen dargestellt, mit dem Fokus auf den veränderten geomorphologischen Situationen und dem Risiko für die menschliche Bevölkerung.
6. Bergstürze im Ötztal: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von Bergstürzen im Ötztal, mit Fokus auf den Köfler Bergsturz und den Tschirgant-Bergsturz. Weitere Bergstürze werden erwähnt (Habichen und Tumpen), jedoch ohne detaillierte Beschreibung. Es wird erwartet, dass dieses Kapitel detaillierte Gegebenheiten zu den genannten Bergstürzen beinhaltet, inklusive geologischer Besonderheiten, Ausmaß des Ereignisses und potentieller Folgen. Die Beispiele dienen der Veranschaulichung der zuvor diskutierten Konzepte und der Illustration regionaler Variationen.
Schlüsselwörter
Bergsturz, Ötztal, Massenbewegung, Geomorphologie, Abele, Erismann, Abbruchgebiet, Bergsturzfahrbahn, Ablagerungsgebiet, Ursachen, Auslöser, Folgeerscheinungen, physisch-geographische Folgen, anthropogeographische Folgen, Gesteinsarten, Hangwinkel, Gleitflächen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Bergstürze im Ötztal
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Bergstürze im Ötztal. Es beinhaltet eine Einleitung, eine Definition von Bergstürzen, eine Unterteilung des Bergsturzgebietes (Abbruch-, Fahrbahn-, Ablagerungsgebiet), die Ursachen und Auslöser von Bergstürzen, die Folgeerscheinungen (physisch-geographisch und anthropogeographisch), sowie Fallstudien zu spezifischen Bergstürzen im Ötztal (Köfler Bergsturz, Tschirgant-Bergsturz, Habichen und Tumpen). Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Wie wird ein Bergsturz definiert?
Das Dokument diskutiert die Schwierigkeit, Bergstürze präzise zu definieren, da Massenbewegungen in Größe, Ursache, Mechanismus, Geschwindigkeit und Zerfallsgrad variieren. Es vergleicht die Definitionen von Abele (quantitativ, basierend auf Volumen und Geschwindigkeit) und Erismann (qualitativ, basierend auf charakteristischen Merkmalen wie Geschwindigkeit und fehlender Behinderung beim Absturz).
Wie wird das Bergsturzgebiet unterteilt?
Das Bergsturzgebiet wird in drei Bereiche unterteilt: das Abbruchgebiet (wo der Bergsturz beginnt), die Bergsturzfahrbahn (der Weg des herabstürzenden Materials) und das Ablagerungsgebiet (wo das Material zu liegen kommt). Die Rekonstruktion des Abbruchgebiets vor dem Ereignis ist schwierig und erfordert den Vergleich mit benachbarten Hängen und Volumenberechnungen. Der Hangwinkel, die Gesteinsart und die Existenz von Gleitflächen spielen wichtige Rollen.
Was sind die Ursachen und Auslöser von Bergstürzen?
Das Dokument unterscheidet zwischen Grunddispositionen (geologische Schwächezonen) und variablen Dispositionen (z.B. Wassergehalt des Gesteins). Als Auslöser werden starke Regenfälle oder Erdbeben genannt. Schwächezonen im Gestein, wie Klüfte und Spalten, begünstigen das Loslösen des Materials. Der Prozess des hangabwärts gerichteten Bewegens, sei es springend oder rollend, wird ebenfalls beschrieben.
Welche Folgen haben Bergstürze?
Die Folgen werden in physisch-geographische und anthropogeographische Auswirkungen unterteilt. Physisch-geographische Folgen umfassen Landschaftsveränderungen, die Bildung neuer Seen oder die Beeinträchtigung von Flussläufen. Anthropogeographische Folgen betreffen Schäden an Infrastruktur, Gebäuden und landwirtschaftlichen Flächen sowie Gefahren für die Bevölkerung.
Welche Bergstürze im Ötztal werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt im Detail den Köfler Bergsturz und den Tschirgant-Bergsturz. Weitere Bergstürze wie die von Habichen und Tumpen werden erwähnt, jedoch ohne detaillierte Beschreibungen.
Auf welchen Quellen basiert das Dokument?
Das Dokument basiert hauptsächlich auf den Arbeiten von Abele (1974) und weiteren Quellen, die im Literaturverzeichnis aufgeführt sind (welches im Dokument selbst enthalten ist).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bergsturz, Ötztal, Massenbewegung, Geomorphologie, Abele, Erismann, Abbruchgebiet, Bergsturzfahrbahn, Ablagerungsgebiet, Ursachen, Auslöser, Folgeerscheinungen, physisch-geographische Folgen, anthropogeographische Folgen, Gesteinsarten, Hangwinkel, Gleitflächen.
- Quote paper
- BA Katharina Jutz (Author), 2010, Bergstürze in den Alpen: mit Beispielen aus dem Ötztal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205903