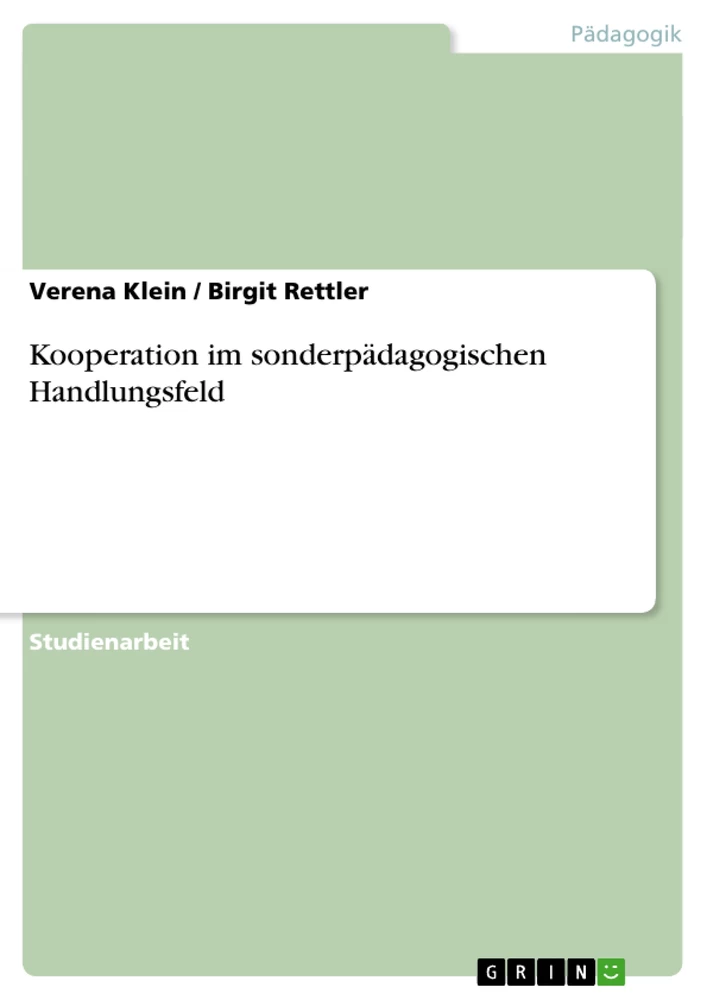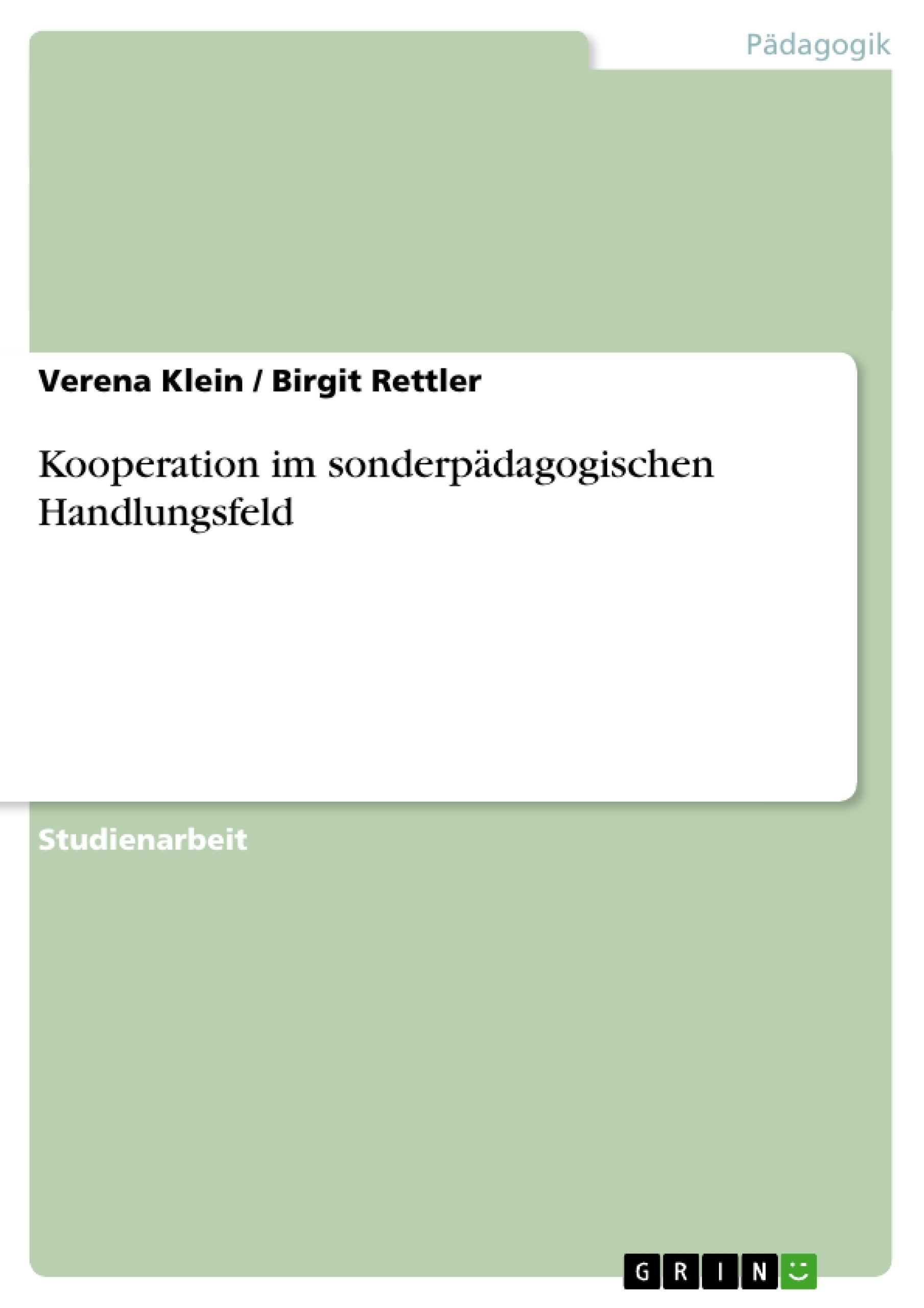In den vergangenen Jahren hat sich das Berufsbild der Sonderpädagogen gewandelt. Die Kultusministerkonferenz 1994 spricht sich für „ein differenziertes System sonderpädagogischer Dienste im Bereich des Schulwesen“ aus (Penné in: Zeitschrift für Heilpädagogik 46, S.275, Z. 25 ff). Kooperation wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger, aber es ist auch eine ernstzunehmende Problemquelle, die sowohl durch personelle Defizite (geringe Kooperationsfähigkeit) als auch durch strukturelle Mängel der Institution Schule begründet wird. Erforderlich wird Kooperation, „wenn eine Aufgabe für den Einzelnen zu schwer oder zu komplex ist“, wie es z.B. in Integrationsklassen der Fall ist (Penné in: Zeitschrift für Heilpädagogik 46, S. 276, Z. 139 ff). Die Anzahl der Integrationsklassen steigt an, weil die sonderpädagogische Förderung von behinderten Kindern ist in einigen Bundesländern „nach gesetzlichem Auftrag“ den Regelschulen zugewiesen wurde (Penné in: Zeitschrift für Heilpädagogik 46, S. 277, Z. 78). Diese Tatsache beeinflusst die Kooperation in der Weise, dass es jetzt nicht mehr möglich ist, auf Sympathie oder Freiwilligkeit der Kooperationspartner Rücksicht zu nehmen. Dennoch sollte das Ziel Kooperation angestrebt werden, denn nur so kann in Integrationsklassen die pädagogische Aufgabe erfüllt werden. (vgl. Penné in: Zeitschrift für Heilpädagogik 46, S. 275 - 281)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines zum Thema Kooperation
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Definition des Begriffs „Kooperation“ von Hans Meister und Alfred Sanders
- 1.3 Erleichternde und erschwerende Bedingungen von Kooperation
- 1.4 Problembereiche nach Wocken
- 1.5 Was sind eigentlich Konflikte?
- 2. Das Kennenlernen als wichtige Voraussetzung für eine gelungene Kooperation
- 2.1 Wie kann am günstigsten mit der Kooperation begonnen werden?
- 2.2 Die Planung von konkreten Schritten
- 2.3 Aktives Zuhören
- 3. Kooperationsbereitschaft
- 3.1 Kooperationshemmendes- und förderndes Verhalten
- 4. Kooperation mit anderen Berufsgruppen
- 4.1 Kooperation mit Hilfskräften
- 4.2 Kooperation mit Eltern
- 4.3 Kooperation mit Therapeutinnen und Therapeuten
- 4.4 Kooperation mit Erzieherinnen im Kindergarten und im Hort
- 5. Sonderschullehrer in Integrationsklassen
- 5.1 Warum steigen Pädagogen aus der Integration aus?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Kooperation im sonderpädagogischen Handlungsfeld. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten gelungener Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, insbesondere im Kontext von Integrationsklassen. Der Fokus liegt auf der Analyse von fördernden und hindernden Faktoren für erfolgreiche Kooperation.
- Definition und Verständnis von Kooperation im sonderpädagogischen Kontext
- Fördernde und hemmende Faktoren für gelungene Kooperation
- Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen (Eltern, Therapeuten, etc.)
- Herausforderungen der Integration und der Ausstieg von Pädagogen aus Integrationsklassen
- Wichtigkeit des Kennenlernens und der Planung für erfolgreiche Kooperation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines zum Thema Kooperation: Dieses Kapitel führt in das Thema Kooperation im sonderpädagogischen Bereich ein. Es beleuchtet den Wandel des Berufsbildes der Sonderpädagogen und die zunehmende Bedeutung von Kooperation, insbesondere in Integrationsklassen. Die steigende Anzahl von Integrationsklassen aufgrund gesetzlicher Vorgaben wird als wichtiger Kontextfaktor hervorgehoben. Die Definition von Kooperation nach Meister und Sander wird vorgestellt, welche die nicht-hierarchische Zusammenarbeit und den Kompetenztransfer zwischen den Beteiligten betont. Schließlich werden erleichternde und erschwerende Bedingungen für erfolgreiche Kooperation diskutiert, wobei Faktoren wie Sympathie, zeitliche Ressourcen, vergleichbares Anspruchsniveau und die Unterstützung der Schulleitung als positiv, und kurzfristige Vorbereitung, unterschiedliche Arbeitsbedingungen und mangelnde Unterstützung als negativ hervorgehoben werden.
2. Das Kennenlernen als wichtige Voraussetzung für eine gelungene Kooperation: Dieses Kapitel unterstreicht die Bedeutung des Kennenlernprozesses als Grundlage für erfolgreiche Kooperation. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, wie eine Kooperation optimal begonnen werden kann, inkl. der Planung konkreter Schritte und der Bedeutung von aktivem Zuhören. Die Kapitel betonen die Notwendigkeit, gemeinsame Ziele zu definieren und Wege zu finden, um diese zu erreichen, und heben die Bedeutung einer ausreichenden Vorbereitungsphase zur Vermeidung von Anfangsschwierigkeiten hervor. Der Fokus liegt auf der Etablierung einer positiven Arbeitsatmosphäre und auf der Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen und Respekt.
3. Kooperationsbereitschaft: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Analyse von Verhaltensweisen, die die Kooperation entweder fördern oder hemmen. Es werden konkrete Beispiele und Strategien für die Förderung einer positiven Kooperationskultur vorgestellt. Das Kapitel untersucht die individuellen und institutionellen Faktoren, die die Kooperationsbereitschaft beeinflussen können und bietet praktische Ansätze, um diese Herausforderungen zu bewältigen und eine konstruktive Zusammenarbeit zu erreichen.
4. Kooperation mit anderen Berufsgruppen: In diesem Kapitel wird die Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen, wie Hilfskräften, Eltern, Therapeuten und Erziehern, im Detail beleuchtet. Es werden spezifische Herausforderungen und Chancen jeder einzelnen Kooperation diskutiert, sowie mögliche Strategien zur Optimierung der Zusammenarbeit aufgezeigt. Das Kapitel betont die Notwendigkeit einer klaren Rollenverteilung und einer effektiven Kommunikation, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten und die Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen.
5. Sonderschullehrer in Integrationsklassen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Erfahrungen und Herausforderungen von Sonderschullehrern in Integrationsklassen. Es analysiert die Gründe, warum Pädagogen aus der Integration aussteigen, und untersucht die wesentlichen Faktoren, die zu diesem Phänomen beitragen. Das Kapitel beleuchtet die wichtigsten Aspekte des Arbeitsalltags in Integrationsklassen und bietet mögliche Lösungsansätze für die beobachteten Probleme.
Schlüsselwörter
Kooperation, Sonderpädagogik, Integrationsklassen, Kooperationsbereitschaft, Berufsgruppen, Eltern, Therapeuten, Hilfskräfte, Schwierigkeiten, Förderung, Integration, Professionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Kooperation in der Sonderpädagogik
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Kooperation im sonderpädagogischen Bereich, insbesondere im Kontext von Integrationsklassen. Sie analysiert fördernde und hemmende Faktoren für erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren wie Sonderschullehrern, Eltern, Therapeuten und anderen Berufsgruppen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Kooperation, darunter die Definition von Kooperation, die Bedeutung des Kennenlernprozesses, die Analyse von kooperationsförderndem und -hemmendem Verhalten, die Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen (Eltern, Therapeuten, Hilfskräfte, Erzieher) und die Herausforderungen von Sonderschullehrern in Integrationsklassen, inklusive der Gründe für den Ausstieg aus der Integration.
Welche Definition von Kooperation wird verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Definition von Kooperation nach Meister und Sander, die eine nicht-hierarchische Zusammenarbeit und den Kompetenztransfer zwischen den Beteiligten betont.
Welche Faktoren fördern bzw. hemmen die Kooperation?
Fördernde Faktoren sind unter anderem Sympathie, ausreichende zeitliche Ressourcen, ein vergleichbares Anspruchsniveau und die Unterstützung der Schulleitung. Hemmende Faktoren sind beispielsweise eine kurzfristige Vorbereitung, unterschiedliche Arbeitsbedingungen und mangelnde Unterstützung.
Welche Rolle spielt das Kennenlernen für eine gelungene Kooperation?
Das Kennenlernen wird als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Kooperation hervorgehoben. Die Arbeit betont die Bedeutung der Planung konkreter Schritte, des aktiven Zuhörens und der Definition gemeinsamer Ziele.
Wie wird die Kooperation mit verschiedenen Berufsgruppen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Zusammenarbeit mit Hilfskräften, Eltern, Therapeuten und Erziehern im Detail. Sie diskutiert spezifische Herausforderungen und Chancen jeder einzelnen Kooperation und zeigt mögliche Strategien zur Optimierung der Zusammenarbeit auf.
Warum steigen Pädagogen aus der Integration aus?
Dieses Thema wird im Kapitel über Sonderschullehrer in Integrationsklassen behandelt. Die Arbeit analysiert die Gründe für den Ausstieg aus der Integration und untersucht die Faktoren, die dazu beitragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kooperation, Sonderpädagogik, Integrationsklassen, Kooperationsbereitschaft, Berufsgruppen, Eltern, Therapeuten, Hilfskräfte, Schwierigkeiten, Förderung, Integration, Professionalisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Allgemeines zum Thema Kooperation, 2. Das Kennenlernen als wichtige Voraussetzung für eine gelungene Kooperation, 3. Kooperationsbereitschaft, 4. Kooperation mit anderen Berufsgruppen, 5. Sonderschullehrer in Integrationsklassen und 6. Fazit.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung jedes Kapitels ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" enthalten, der eine detaillierte Übersicht über die Inhalte jedes Kapitels bietet.
- Quote paper
- Verena Klein (Author), Birgit Rettler (Author), 2002, Kooperation im sonderpädagogischen Handlungsfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20575