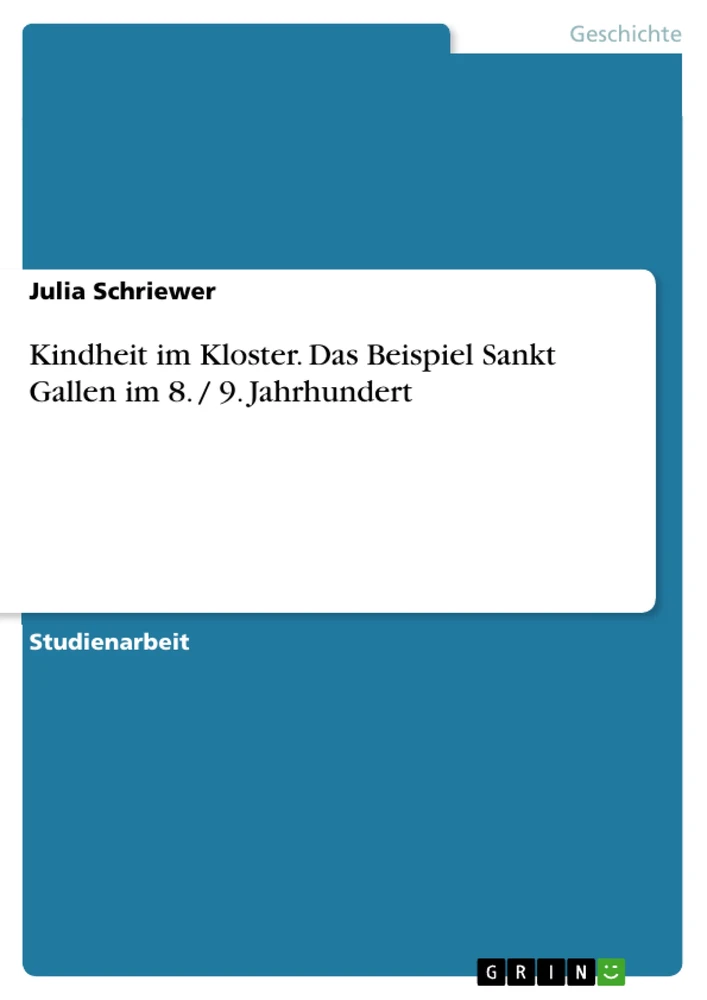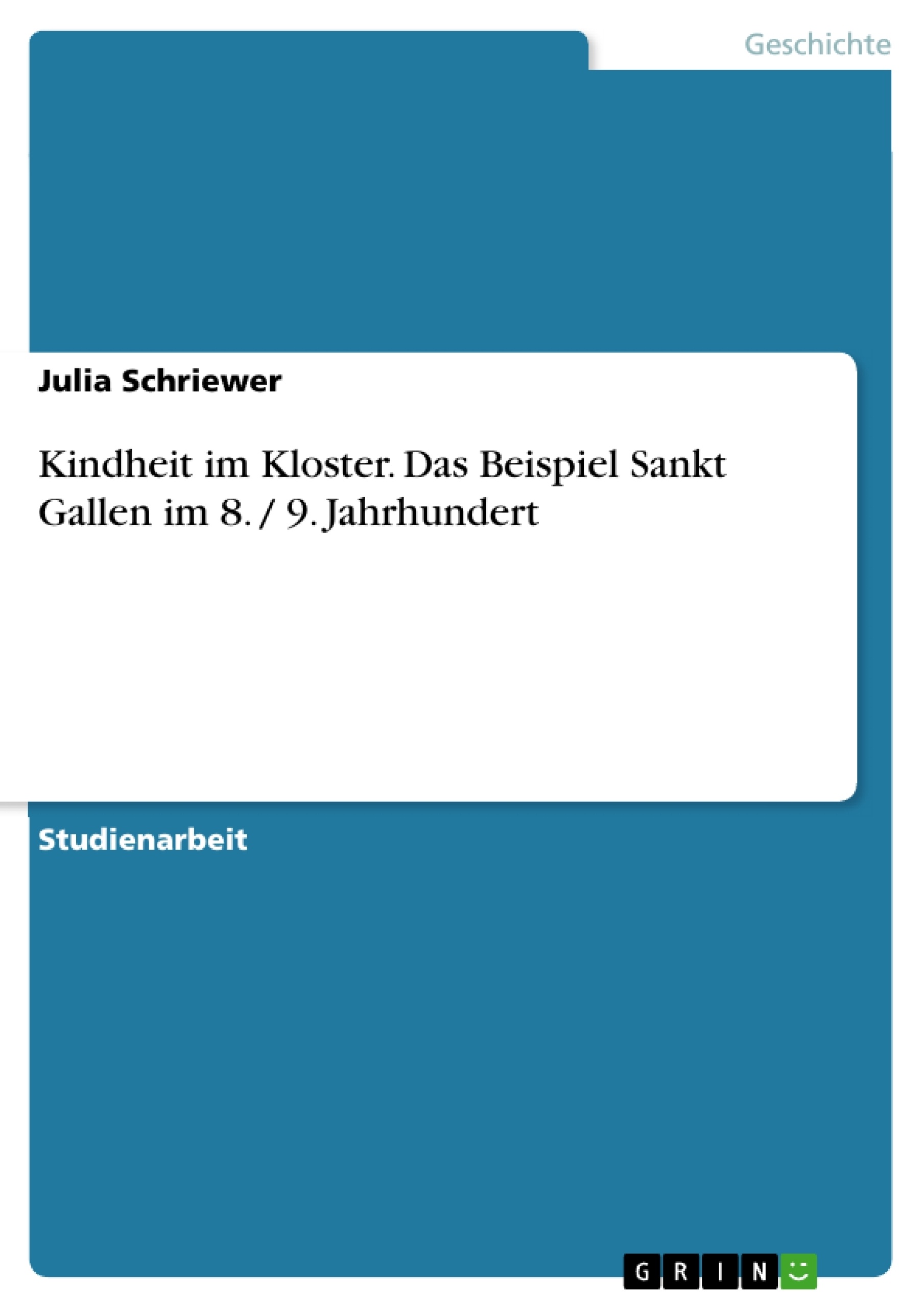Die Erforschung des Lebens der Kinder im Kloster zur Zeit des Früh- und Hochmittelalters steht vor der großen Herausforderung, dass die Quellenlage nur sehr dünn ist. In einer Zeit, in der der größte Teil der Bevölkerung keinen Zugang zur geschriebenen Sprache hat und die Klöster zu den wenigen Orten gehören, an denen die Schriftsprache erlernt und praktiziert wird, wird Alltägliches kaum schriftlich festgehalten und für die Nachwelt überliefert. In dieser Zeit werden in den Skripturalen der Klöster vor allem Werke von großem religiösen und wissenschaftlichen Rang von den Schreibermönchen erstellt.
Das Benediktinerkloster St. Gallen mit seiner über eintausend Jahren alten Geschichte ermöglicht durch noch heute vorhandene Quellen einen Einblick in den Alltag der Kinder im Kloster. Zahlreiche Mönche und Äbte des St. Galler Klosters erlangen nicht nur zu Lebzeiten Berühmtheit. Ihre Namen sind in den noch heute überlieferten Quellen zu finden und sie haben dazu beigetragen, dass es gegenwärtig möglich ist, einen Blick in den Alltag der Mönche in den ersten Jahrhunderten nach Gründung des St. Galler Klosters im 8. Jahrhundert zu werfen. Das Kloster St. Gallen zeichnet sich ganz im Sinne der familiären Tradition der Benediktinerklöster aus: Viele der Lehrer, Äbte und Bischöfe sind selbst Schüler in St. Gallen gewesen und gehören auch über die Jugend hinaus, nach Verlassen der klösterlichen Gemeinschaft weiterhin zu dieser Familie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg ins Kloster
- Das Leben im Kloster
- Die Klosterschule
- Erziehungsziele und Erziehungsmethoden im Kloster
- Der Tagesablauf im Kloster
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Klosters im Leben von Kindern im Früh- und Hochmittelalter am Beispiel des Benediktinerklosters St. Gallen im 8./9. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Gründe, warum Kinder in das Kloster gegeben wurden, sowie das Leben der Kinder im Kloster, einschließlich ihrer Bildung, Erziehung und ihres Tagesablaufs.
- Der Weg ins Kloster: Motive und soziale Hintergründe
- Die Klosterschule: Organisation, Inhalte und Ziele
- Erziehungsziele und Erziehungsmethoden: Position der Kinder in der Klostergemeinschaft, Betreuung und Strafen
- Der Tagesablauf: Stundengebet, Unterricht und andere Pflichten
- Das Kloster als Bildungseinrichtung und die Bedeutung der Schriftlichkeit im mittelalterlichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kindererziehung im Mittelalter ein und stellt das Kloster St. Gallen als Forschungsgegenstand vor. Kapitel 2 beleuchtet die Gründe, warum Kinder in das Kloster gegeben wurden, wobei die sozialen Hintergründe der Familien, die Motive der Eltern sowie die verschiedenen Lebensumstände der Kinder im Vordergrund stehen. Kapitel 3 konzentriert sich auf das Leben der Kinder im Kloster. Es behandelt die Organisation der Klosterschule, die Erziehungsmethoden und die Position der Kinder in der Klostergemeinschaft, sowie den Tagesablauf mit seinen Pflichten und eventuellen Freiheiten. Das Kapitel zeigt anhand von Quellenbeweisen, wie die Kinder in das Klosterleben eingebunden waren und welchen Herausforderungen sie begegneten.
Schlüsselwörter
Frühmittelalter, Hochmittelalter, Kloster St. Gallen, Kindererziehung, Bildung, Klosterleben, Mönche, Schriftlichkeit, Quellenforschung, Regula Benedicti, Ekkehard IV., Casus sancti Galli, soziale Hierarchien, Erziehungsziele, Tagesablauf.
- Quote paper
- Julia Schriewer (Author), 2012, Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205647