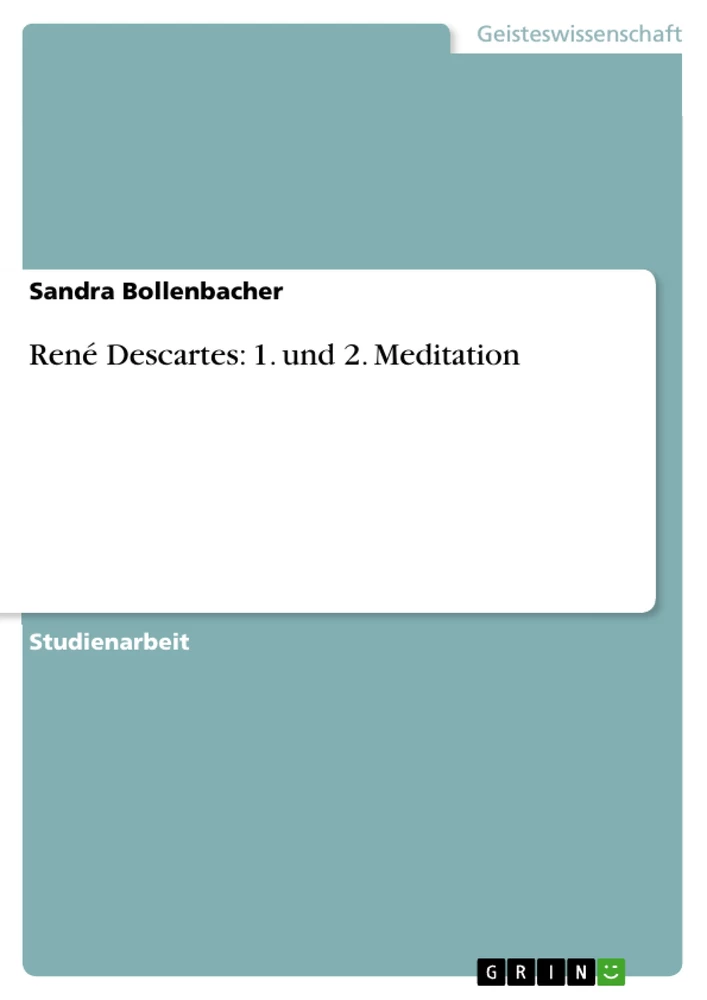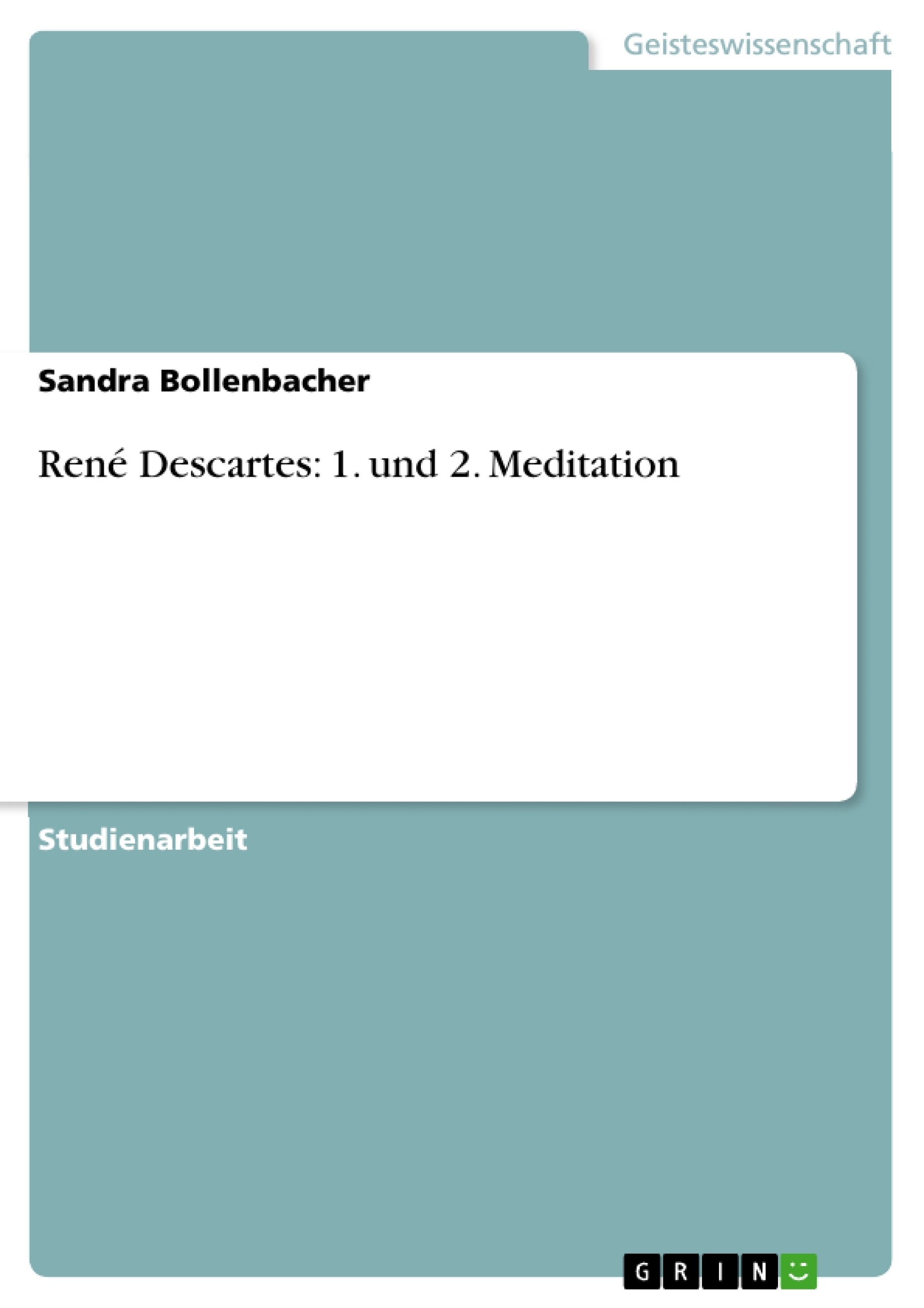René Descartes wurde am 31.03.1596 in Frankreich geboren und starb am 11.02.1650. Im Jahre 1641 verfasste er die „Meditationes de Prima Philosphia“ – die „Meditationen über die Erste Philosophie“. Das Werk ist in der Gelehrtensprache Latein geschrieben und besteht aus sechs einzelnen Meditationen, die alle in Monologform in der ersten Person Singular geschrieben sind.
In der ersten Meditation „Woran man zweifeln kann“ befasst er sich mit dem methodischen Zweifel. Descartes hat erkannt, dass vieles falsch ist, was er in seiner Jugend für wahr gehalten hat und dass alles, was er daraus schloss, anzuzweifeln ist. Deshalb möchte er alles umstürzen, indem er die Grundlagen und Prinzipien anzweifelt, um am Ende etwas Festes zu erlangen, das nicht mehr angezweifelt werden kann.
In der zweiten Meditation „Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er leichter erkennbar als der Körper“ möchte er, von allem befreit, was einen Zweifel zulässt, herausfinden, was ER eigentlich ist. Am Ende kommt er zu der Erkenntnis, dass die Existenz seines Geistes und damit seine eigene nicht angezweifelt werden kann, da er denkt.
Wie Descartes in seiner Argumentation von dem Anfang, alles anzuzweifeln, zu dieser festen, unumstößlichen Erkenntnis kommt, wird im Folgenden dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Erste und Zweite Meditation in neun Argumentationsschritten
2.1. Die Sinnestäuschung
2.2. Der Verrückte
2.3. Das Traum-Argument
2.4. Der Maler
2.5. Der täuschende Gott
2.6. Der böse Geist
2.7. Das „Denkende Ding“
2.8. Das Wachs-Argument
2.9. Das Mantel-Argument
3. Gegenwartsbezug – Was wäre wenn?
4. Zusammenfassung
1. Einleitung
René Descartes wurde am 31.03.1596 in Frankreich geboren und starb am 11.02.1650. Im Jahre 1641 verfasste er die „Meditationes de Prima Philosphia“ – die „Meditationen über die Erste Philosophie“. Das Werk ist in der Gelehrtensprache Latein geschrieben und besteht aus sechs einzelnen Meditationen, die alle in Monologform in der ersten Person Singular geschrieben sind.
In der ersten Meditation „Woran man zweifeln kann“ befasst er sich mit dem methodischen Zweifel. Descartes hat erkannt, dass vieles falsch ist, was er in seiner Jugend für wahr gehalten hat und dass alles, was er daraus schloss, anzuzweifeln ist. Deshalb möchte er alles umstürzen, indem er die Grundlagen und Prinzipien anzweifelt, um am Ende etwas Festes zu erlangen, das nicht mehr angezweifelt werden kann.
In der zweiten Meditation „Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er leichter erkennbar als der Körper“ möchte er, von allem befreit, was einen Zweifel zulässt, herausfinden, was ER eigentlich ist. Am Ende kommt er zu der Erkenntnis, dass die Existenz seines Geistes und damit seine eigene nicht angezweifelt werden kann, da er denkt.
Wie Descartes in seiner Argumentation von dem Anfang, alles anzuzweifeln, zu dieser festen, unumstößlichen Erkenntnis kommt, wird im Folgenden dargestellt.
2. Die Erste und Zweite Meditation in neun Argumentationsschritten
„Die Erste Meditation – Woran man zweifeln kann“ umfasst die Schritte 1-6, „die Zweite Meditation – Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er leichter erkennbar als der Körper“ die Schritte 7-9 des Zweifelns.
2.1. Die Sinnestäuschung
Im ersten Schritt überlegt Descartes, was er denn immer als wahr anerkannt hat, ohne daran zu zweifeln: das, was er sah, hörte, roch, schmeckte, fühlte. Eben das, was er mit seinen Sinnen erfassen konnte. Aber kann man daran wirklich nicht zweifeln? Oft täuschen uns unsere Sinne, ob man nun ein vorbeiwehendes Blatt für ein Tier oder das Geräusch eines Motorrads für einen Donner hält. Woher wissen wir also, dass unsere Sinne uns nicht immer täuschen? Wir können ihnen also nicht mehr länger (ver)trauen, wenn es möglich ist, dass sie uns immer täuschen.
„Alles nämlich, was ich bis heute als ganz wahr gelten ließ, empfing ich unmittelbar oder mittelbar von den Sinnen; diese aber habe ich bisweilen auf Täuschungen ertappt, und es ist eine Klugheitsregel, niemals denen volles Vertrauen zu schenken, die uns auch nur ein einziges Mal getäuscht haben.“[1]
Aus der Prämisse „die Sinne täuschen uns manchmal“ schließt er, dass es möglich ist, dass sie uns immer täuschen. Da man aber keinem trauen soll, der schon einmal getäuscht hat, kommt er zu der Konklusion, dass man seinen Sinnen nicht trauen darf.
2.2. Der Verrückte
Nun räumt Descartes aber ein, dass gewisse Dinge zu offensichtlich sind, als dass sie eine Täuschung unserer Sinne sein könnten, wie zum Beispiel sein eigener Körper oder die Kleidung, die er trägt.
Nur ein Verrückter, dessen „Gehirn ein hartnäckiger melancholischer Dunst so schwächt“[2], der also an einer psychischen Krankheit leidet oder aus anderen Gründen nicht Herr seiner Sinne ist, würde sich irgendwelche Dinge einbilden, die in Wahrheit nicht existieren. Descartes geht davon aus, dass er kein Wahnsinniger ist. Aber wie kann man da so sicher sein? Ein Wahnsinniger ist ja auch davon überzeugt, dass alles, was er erlebt, real und wahr ist.
[...]
[1] René Descartes. Meditationes de Prima Philosophia – Meditationen über die Erste Philosophie (Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co., 1986) 65.
[2] ebd. 65
- Arbeit zitieren
- Sandra Bollenbacher (Autor:in), 2006, René Descartes: 1. und 2. Meditation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205548