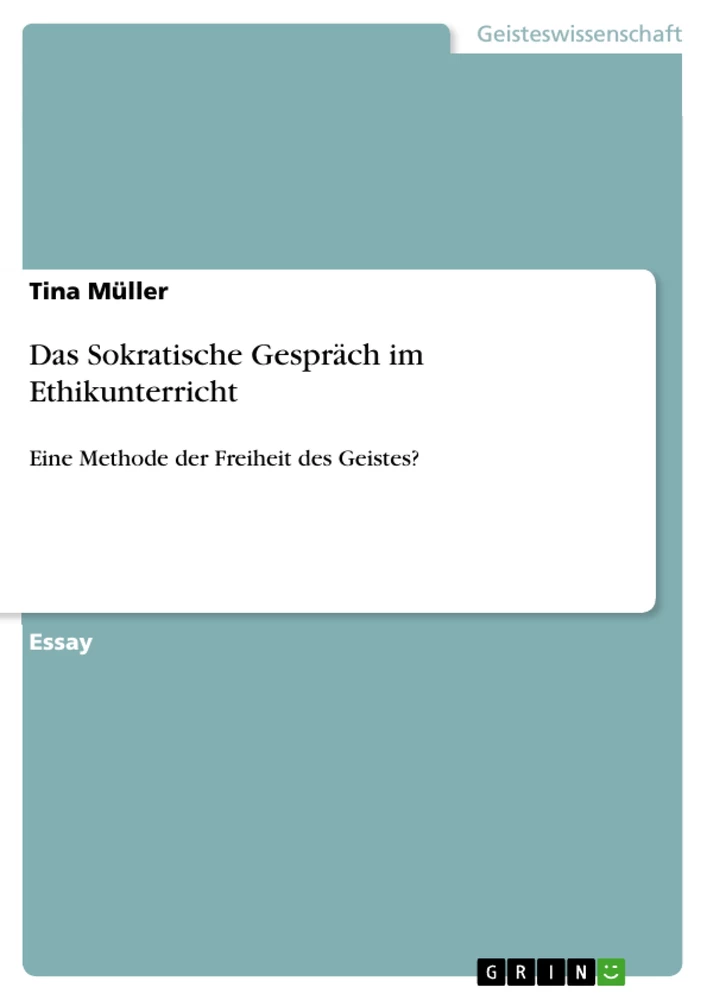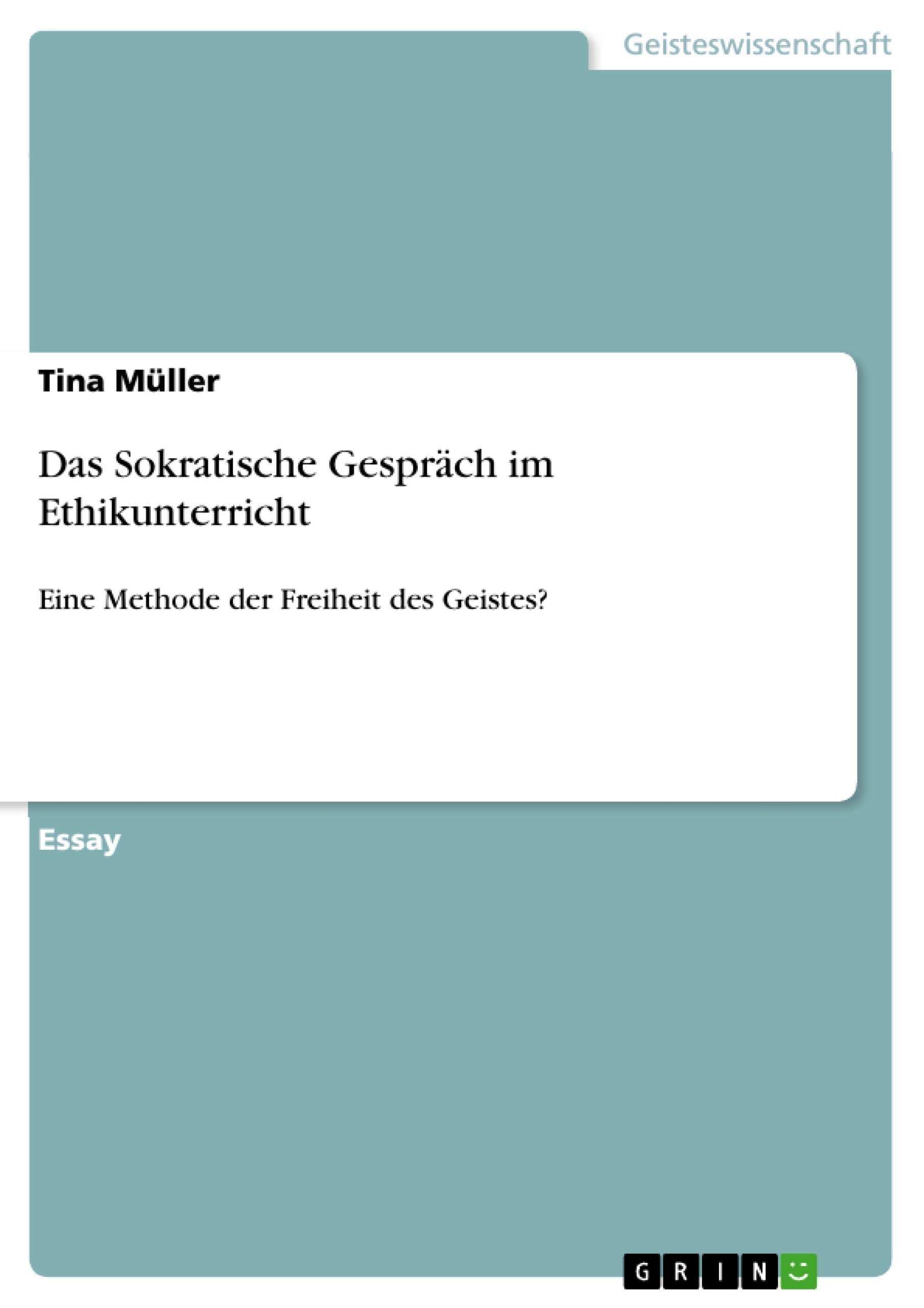„Solange die Menschen unkritisch in der alltäglichen Erfahrung stehen, leben sie in einer Scheinwelt […] und wissen nichts vom eigentlichen Sein.“ (Anzenbacher, 2002, 45)
In dieser Arbeit soll auf die Grundidee des (Neo-) Sokratischen Gesprächs, die Rolle der Lehrperson im Ethikunterricht, wie auch im sokratischen Gespräch eingegangen werden. Die Theorie einer Abwesenheit von Autoritäten soll hier kritisch hinterfragt werden, indem die Existenz von latenten Autoritäten analysiert wird. Abschließend werden Lösungsvorschläge und Möglichkeiten für einen Umgang mit unterbewussten Machtkomplexen erläutert um einen Weg in ein herrschaftsfreies Sokratische Gespräch und dessen Ablauf zu gewährleisten.
Essay: Das Sokratische Gespräch im Ethikunterricht. Eine Methode der Freiheit des Geistes?
1. Einleitung
„Solange die Menschen unkritisch in der alltäglichen Erfahrung stehen, leben sie in einer Scheinwelt […] und wissen nichts vom eigentlichen Sein.“ (Anzenbacher, 2002, 45)
In dieser Arbeit soll auf die Grundidee des (Neo-) Sokratischen Gesprächs, die Rolle der Lehrperson im Ethikunterricht, wie auch im sokratischen Gespräch eingegangen werden. Die Theorie einer Abwesenheit von Autoritäten soll hier kritisch hinterfragt werden, indem die Existenz von latenten Autoritäten analysiert wird. Abschließend werden Lösungsvorschläge und Möglichkeiten für einen Umgang mit unterbewussten Machtkomplexen erläutert um einen Weg in ein herrschaftsfreies Sokratische Gespräch und dessen Ablauf zu gewährleisten.
2. Das Sokratische Gespräch Idee/Grundlagen/Regeln
In der ursprünglichen Sokratischen Methode ist die Aufgabe der Lehrperson mit der Rolle einer Hebamme zu vergleichen, welche den/die Lernende/n dabei unterstützt, Wissen/ „Wahrheit“ zu gebären. Die Lehrperson selbst „[bringt] keine klugen Gedanken hervor“ (Platon, 2002, 18), sondern muss mit allen Mitteln prüfen, „ob die Überlegung […] ein bloßes Trugbild oder etwas Falsches herausgebracht hat oder etwas Lebenskräftiges und Wahres.“ (ebenda.). Dies ist die Ursprungsidee des Sokrates, welche von Leonard Nelson und Gustav Heckmann zu einer Methode des Sokratischen Gesprächs weiterentwickelt wurde. Die Idee von einer Lehrperson, welche Fragen stellt, wird in ein Gruppengespräch umgewandelt, bei welchem jede/r TeilnehmerIn die Möglichkeit hat, als Hebamme Fragen zu stellen und das Wissen bei den anderen TeilnehmerInnen ans Licht zu bringen. Die Grundidee des Sokrates blieb auch in der Weiterentwicklung erhalten:
„den Dialogpartner[in] die Wahrheit selbst finden zu lassen, dass die Wahrheit jedem verständigen und gutwilligen Menschen gleichermaßen zugänglich ist; und dass das Finden der Wahrheit nicht nur den Mut verlangt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sondern- weil die Wahrheit vielfach hinter dem Schleier der Konventionen, des Vorurteils und der Illusionen verborgen ist- auch eine gewisse Willensanstrengung, die Überwindung von Denkfaulheit und Konformismus.“ (Birnbacher, Krohn, 2002, 7).
Das (Neo-) Sokratische Gespräch stellt eine Methode im Ethikunterricht dar, bei welcher die Gruppe gemeinsam Kriterien, Werte, Maßstäbe und Handlungsweisen eines Problems entdeckt. Von einer konkreten Situation (religiös, ethisch, pädagogisch, philosophisch) sollen die SchülerInnen abstrahieren und zu allgemeingültigen Handlungsgründen kommen. Wichtige Kriterien, an welche sie sich halten sollen, sind das selbstständige Denken (keine Ideen von Vordenkern verwenden), das miteinander Denken (nicht den Anderen als Gegner, den es zu besiegen gilt wahrnehmen, sondern als Hilfe für den eigenen/gemeinsamen Denkweg). Wichtig ist es, den Erfahrungsbezug (konkrete Situation) immer wieder herzustellen, wahrheitsorientiert zu denken und die eigene Meinung zu begründen. Themen können sein: Freundschaft, Toleranz, Wahrheit, Liebe, Freiheit, Frieden und Glück. In diesen Themenbereichen ist es jedem möglich, ohne Vorwissen mitzudenken und eigene Punkte anzubringen. Beim regressiven Zurückschreiten soll die jeweilige konkrete Situation auf die ihr zu Grunde liegenden Ursachen und Voraussetzungen untersucht werden. Hierzu sollen die SchülerInnen persönlich erlebte Situationen zur Wahrheitsfindung nutzen, indem sie auf Ursachenfindung gehen und so zu einem Urteil kommen. Dieses auf die konkrete Situation bezogene Urteil soll Grundlage des Abstraktionsprozesses sein und mithilfe ständiger Rückfragen, zu allgemeinen Handlungsmaßstäben führen. Durch das fortwährende Fragen werden „Widersprüche und Wissens- bzw. Argumentationslücken“ (Pfeifer, 2009, S. 135) im eigenen Wissen aufgedeckt. Die kritische Hermeneutik fördert das Erkennen des eigenen Ichs, eigener Überzeugungen, Einstellungen und Lücken im eigenen Denkprozess. (vgl. Pfeifer, 2009, S. 125ff) Die Sokratische Methode fördert kritische Toleranz, Selbstkritik, Geduld, Argumentationsdisziplin und Freundlichkeit.
3. Die Moderation als Antiautorität
„Die gedanklichen Produkte sollen möglichst frei von Fremdbestimmung inhaltlicher oder kommunikativer Art ans Tageslicht kommen, also möglichst frei von Dogmatismus und Herrschaft sich entfalten können“ (Raupach-Strey, 2002, S. 118).
Die Lehrperson muss mit den SchülerInnen zusammen erkennen und verinnerlichen, dass jedem Menschen ein gleichwertiges Urteilsvermögen zugetraut werden kann. Die SchülerInnen müssen erkennen, dass sie, um zu philosophieren, kein Vorwissen benötigen, sie auf die eigene Vernunft vertrauen können und keine Ängste haben brauchen etwas falsches zu sagen.
„Nelson hatte wohl starke Befürchtungen, daß beim geringsten Wink des Gesprächsleiters die Autonomie der Urteilsbildung beeinträchtigt und Sachgründe durch Autoritätsgründe ersetzt werden könnten. (Unsere heutigen Teilnehmer/innen sind da oft resistenter)“ (Raupach-Strey, 2002, S. 113)
Doch auch heute in einer vermeintlich aufgeklärten Zeit, wo Autoritäten ständiger Kritik ausgesetzt werden, sind Menschen in keinster Weise resistenter gegenüber Autoritäten als damals. Milgram fand in den 1960er Jahren heraus das zwei Drittel aller Menschen durch Autoritäten zu blindem Gehorsam fähig sind. Dieses Experiment wurde im Jahr 2010 von französischen Forschern wiederholt und kam zu denselben Ergebnissen. (vgl. Bégue, 2010, S.55) Nelson hat mit seiner Befürchtung Recht. Aus diesem Grund sollte für die Lehrperson ein absolutes Gebot der Zurückhaltung bestehen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Tina Müller (Autor:in), 2010, Das Sokratische Gespräch im Ethikunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205246