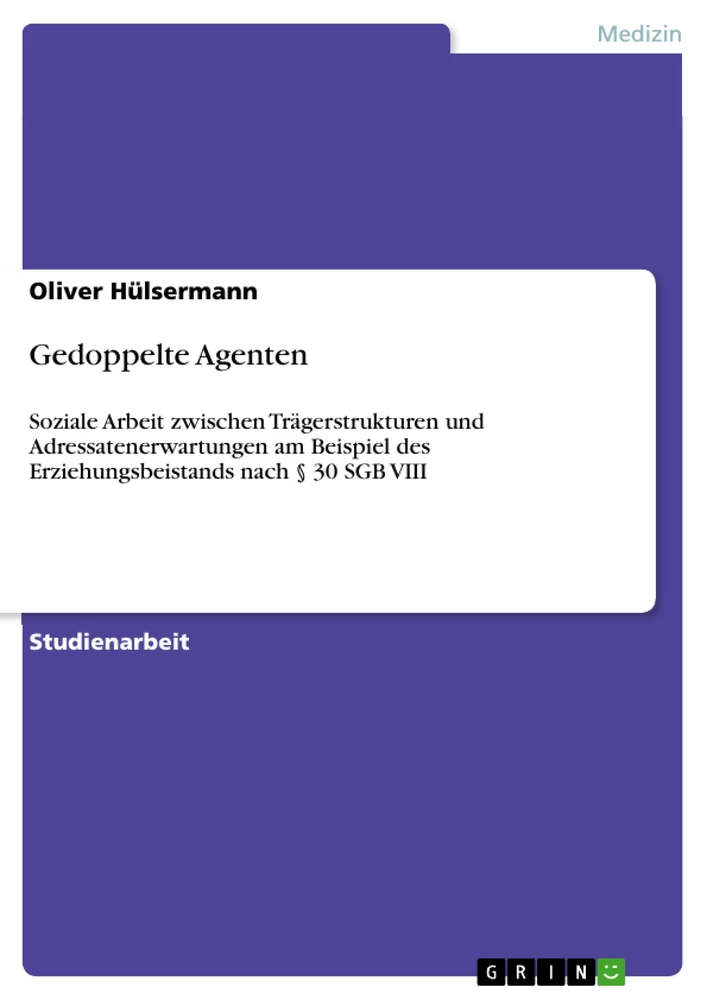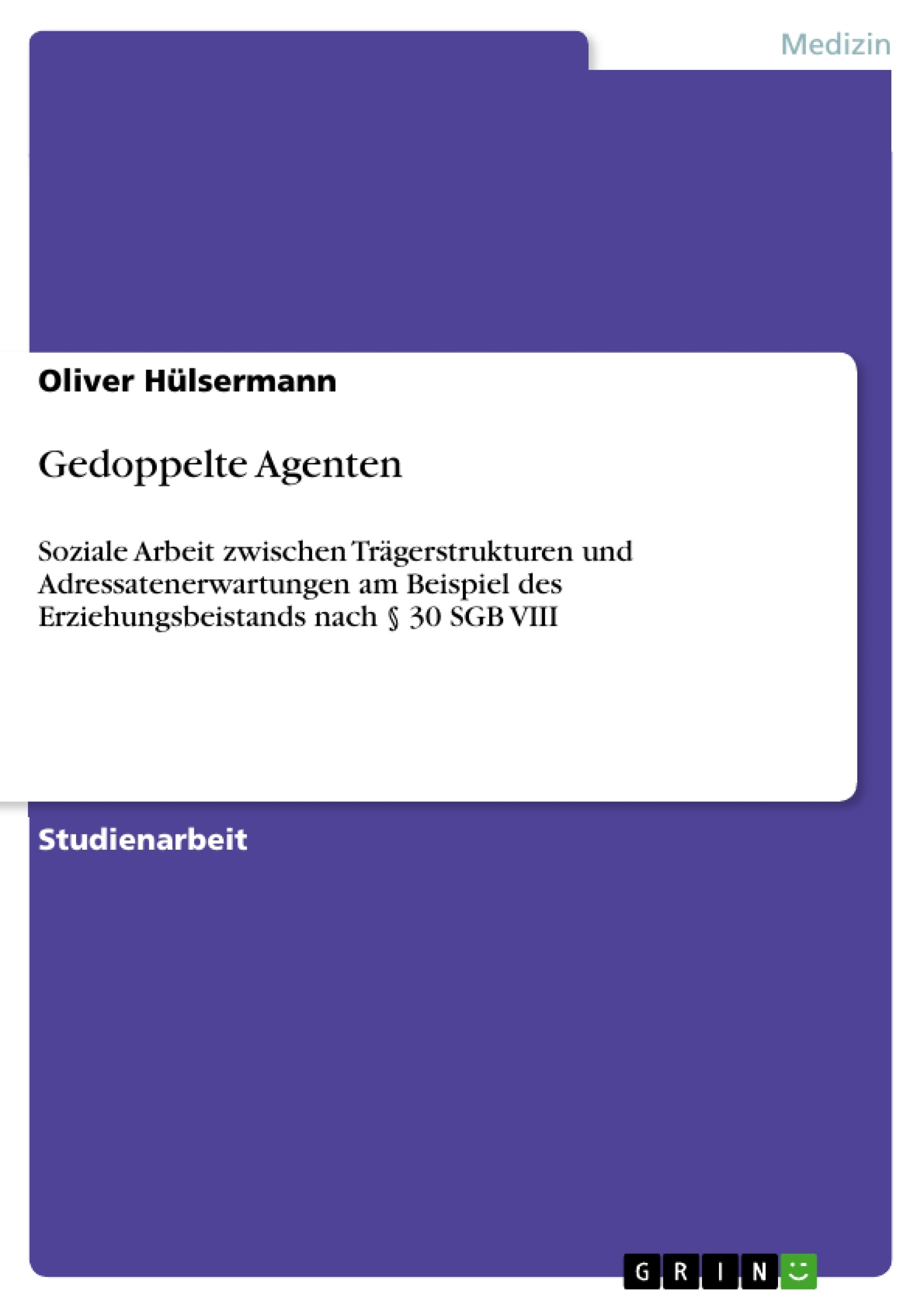Gedoppelte Agenten sind Auftragnehmer, die sich hinsichtlich einer Aufgabe in Vertragsbeziehungen mit zwei Auftraggebern befinden. In der Sozialen Arbeit gibt es zahlreiche solcher Auftragsverhältnisse. Entsprechend groß ist die Anzahl der gedoppelten Agenten in diesem Bereich, sprich: der Professionellen, die bei einem Träger der Sozialen Arbeit angestellt sind und Adressaten bzw. Klienten betreuen. Dem folgend hat der Professionelle zwei Aufträge für ein und dieselbe Sache. Im Falle des Erziehungsbeistands nach § 30 SGB VIII betreut er Kinder oder Jugendliche. Zudem ist er bei einem Träger beschäftigt, verfügt über einen mehr oder minder präzisen expliziten Arbeitsvertrag mit diesem und hat somit den Auftrag, in dessen Sinne zu handeln. Neben dem Träger der Sozialen Arbeit ist der Adressaten des Erziehungsbeistands – also quasi den Hilfeempfänger, der eigentlich den Kern des expliziten Vertrages zwischen dem Professionellen und dem Träger bildet. Zwischen dem Adressaten und dem Professionellen besteht ein impliziter Vertrag. Auf diesen Vertrag fußt die adressatenspezifische Aufgabe des Professionellen im Erziehungsbeistand.
Der Professionelle als Agent wird von zwei Auftraggebern gedoppelt, die unterschiedlicher nicht sein können: Der Träger der Sozialen Arbeit beurteilt die Handlungen des Professionellen unter organisationalen und ökonomischen Kriterien. Für den Adressaten hingegen ist die Interaktion mit dem Professionellen zentrales Beurteilungskriterium. Das passt nur schwer zusammen. Mehr noch: Die Ökonomisierung hält vermehrt Einzug in die Soziale Arbeit. Dies hat Auswirkungen auf die Professionellen, die einerseits immer enger in die Trägerstrukturen eingebunden werden und diesen verpflichtet sind, aber andererseits loyal ihren Klienten gegenüber zu sein haben. Auf Basis dieses Dilemmas stellen sich diverse Fragen:
Welche Probleme ergeben sich aus den zunehmenden organisationalen und ökonomischen Steuerungsversuchen professioneller Tätigkeit in den Handlungsstrukturen Sozialer Arbeit?
Können ökonomische Kriterien, wie Qualität, Effizienz und Effektivität als adäquate Steuerungsmittel im Bereich der Sozialen Arbeit analysiert werden?
Welchen Platz hat dabei das zentrale Interaktionsgeschehen zwischen Professionellem und Adressaten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit und inhaltliches Vorgehen
- Vorbemerkungen
- Die Prinzipal-Agent-Theorie
- Definition und Problemstellung
- Vertragsbeziehungen
- Interessenkonflikte
- Umweltunsicherheiten
- Informationsasymmetrien
- Informationsdimensionen
- Asymmetrietypen
- Hidden Characteristics
- Hidden Action
- Hidden Information
- Prinzipal-Agent-Probleme
- Harmonie und Konflikt
- Adverse Selection
- Moral Hazard
- Übersicht
- Das Doppelte-Prinzipal-Agent-Modell in der Sozialen Arbeit
- Hilfen zur Erziehung
- Beratung und Bewilligung
- Hilfeplanung
- Erziehungsbeistand
- Zwei Prinzipale und ein Agent
- Der Träger als Prinzipal
- Die ökonomische Organisationsanalyse
- Informationsasymmetrien und Agenturprobleme
- Der Klient als Prinzipal
- Dienstleistung Soziale Arbeit
- Die Bedeutung von Vertrauen
- Der unmündige Prinzipal
- Grenzen des Klienten
- Vertragsbasis
- Schutz des Klienten
- Abschließende Gedanken und Ausblick
- Diskussionsansätze für die Zukunft
- Erweiterung der Grenzen
- Rollenkonflikte und Entscheidungsunsicherheiten
- Weiche Faktoren
- Ethische Gesichtspunkte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der doppelten Agenturrolle von Erziehungsbeiständen nach § 30 SGB VIII. Sie analysiert die Konflikte zwischen den Anforderungen des Trägers der Sozialen Arbeit und den Bedürfnissen der Klienten. Die Arbeit beleuchtet die Anwendung der Prinzipal-Agent-Theorie auf diesen Kontext und untersucht die daraus resultierenden Informationsasymmetrien und Agenturprobleme.
- Anwendung der Prinzipal-Agent-Theorie auf die Soziale Arbeit
- Analyse von Informationsasymmetrien und Agenturproblemen im Kontext des Erziehungsbeistands
- Die Rolle von Vertrauen im Verhältnis zwischen Erziehungsbeistand und Klient
- Konflikte zwischen ökonomischen Anforderungen und klientenzentrierter Arbeit
- Zukünftige Herausforderungen und Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der doppelten Agenturrolle von Erziehungsbeiständen ein. Sie beschreibt die Situation des Erziehungsbeistands als Angestellter eines Trägers, der gleichzeitig den Interessen der Klienten verpflichtet ist. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage und das Vorgehen, welches die Prinzipal-Agent-Theorie nutzt, um die Herausforderungen dieses Kontexts zu analysieren. Die zentralen Fragen der Arbeit werden formuliert, um die Konflikte zwischen organisationalen und ökonomischen Zielen und den Bedürfnissen der Klienten zu untersuchen.
Die Prinzipal-Agent-Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Prinzipal-Agent-Theorie, ihre Definition und zentrale Probleme. Es beleuchtet Vertragsbeziehungen, Interessenkonflikte und Unsicherheiten in der Umwelt, die zu Informationsasymmetrien führen. Die verschiedenen Arten von Informationsasymmetrien (Hidden Characteristics, Hidden Action, Hidden Information) werden detailliert erklärt. Das Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die spätere Analyse der spezifischen Situation des Erziehungsbeistands.
Informationsasymmetrien: Dieses Kapitel vertieft das Verständnis von Informationsasymmetrien und deren Auswirkungen. Es werden die verschiedenen Dimensionen von Informationen sowie die jeweiligen Asymmetrietypen detailliert dargestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der asymmetrischen Informationsverteilung im Kontext der Prinzipal-Agent-Beziehung und deren Konsequenzen für die Steuerung und Kontrolle professionellen Handelns. Die Ausführungen schaffen die Grundlage für das Verständnis von Problemen im Verhältnis zwischen Träger und Erziehungsbeistand, sowie zwischen Erziehungsbeistand und Klient.
Prinzipal-Agent-Probleme: In diesem Kapitel werden konkrete Probleme der Prinzipal-Agent-Theorie, wie Adverse Selection und Moral Hazard, umfassend erläutert. Das Kapitel differenziert zwischen Harmonie und Konflikt im Prinzipal-Agent-Verhältnis und zeigt, wie diese sich in der Praxis manifestieren können. Die verschiedenen Aspekte werden mit konkreten Beispielen illustriert, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen und die spätere Anwendung auf den Kontext der Sozialen Arbeit vorzubereiten.
Das Doppelte-Prinzipal-Agent-Modell in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel wendet das Prinzipal-Agent-Modell auf den Kontext der Sozialen Arbeit an, insbesondere auf den Erziehungsbeistand. Es beschreibt die Rolle des Trägers und des Klienten als Prinzipale und den Erziehungsbeistand als Agent. Es untersucht die spezifischen Herausforderungen, die aus der doppelten Berichtspflicht resultieren, und analysiert Informationsasymmetrien und Agenturprobleme in diesem Kontext. Die Bedeutung von Vertrauen im Verhältnis zum Klienten wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Prinzipal-Agent-Theorie, Soziale Arbeit, Erziehungsbeistand, § 30 SGB VIII, Informationsasymmetrie, Moral Hazard, Adverse Selection, Vertrauen, ökonomische Steuerung, klientenzentrierte Arbeit, Doppelte Agenturrolle, Hilfen zur Erziehung, Co-Produktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Das Doppelte Prinzipal-Agent-Modell in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der doppelten Agenturrolle von Erziehungsbeiständen nach § 30 SGB VIII. Sie analysiert die Konflikte zwischen den Anforderungen des Trägers der Sozialen Arbeit und den Bedürfnissen der Klienten unter Anwendung der Prinzipal-Agent-Theorie.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Prinzipal-Agent-Theorie, um die Herausforderungen der doppelten Agenturrolle von Erziehungsbeiständen zu analysieren. Diese Theorie dient dazu, die Informationsasymmetrien und Agenturprobleme im Kontext des Erziehungsbeistands zu verstehen.
Welche konkreten Probleme werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet Informationsasymmetrien (Hidden Characteristics, Hidden Action, Hidden Information), Adverse Selection und Moral Hazard im Kontext der doppelten Berichtspflicht des Erziehungsbeistands an den Träger und den Klienten. Die Rolle von Vertrauen und die Konflikte zwischen ökonomischen Anforderungen und klientenzentrierter Arbeit werden ebenfalls analysiert.
Wer sind die Akteure im untersuchten Modell?
Das Modell beinhaltet drei Akteure: Der Träger der Sozialen Arbeit (Prinzipal), der Klient (Prinzipal) und der Erziehungsbeistand (Agent). Die Arbeit untersucht die komplexen Beziehungen und die daraus resultierenden Konflikte zwischen diesen Akteuren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Prinzipal-Agent-Theorie, ein Kapitel zu Informationsasymmetrien, ein Kapitel zu Prinzipal-Agent-Problemen, ein Kapitel zum Doppelten Prinzipal-Agent-Modell in der Sozialen Arbeit und abschließende Gedanken mit Ausblick.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht, wie die Prinzipal-Agent-Theorie auf die Situation des Erziehungsbeistands angewendet werden kann, welche Informationsasymmetrien und Agenturprobleme daraus resultieren und wie die Konflikte zwischen organisationalen/ökonomischen Zielen und den Bedürfnissen der Klienten gelöst werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prinzipal-Agent-Theorie, Soziale Arbeit, Erziehungsbeistand, § 30 SGB VIII, Informationsasymmetrie, Moral Hazard, Adverse Selection, Vertrauen, ökonomische Steuerung, klientenzentrierte Arbeit, Doppelte Agenturrolle, Hilfen zur Erziehung, Co-Produktion.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen. Diese Zusammenfassungen dienen dem schnellen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und Praktiker im Bereich der Sozialen Arbeit, insbesondere für diejenigen, die sich mit Hilfen zur Erziehung, dem § 30 SGB VIII und den Herausforderungen der organisationalen Steuerung in der Sozialen Arbeit befassen.
Wie kann ich mehr über das Thema erfahren?
(Hier könnte ein Link zu der vollständigen Arbeit oder weiterführender Literatur eingefügt werden.)
- Quote paper
- Oliver Hülsermann (Author), 2012, Gedoppelte Agenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205231