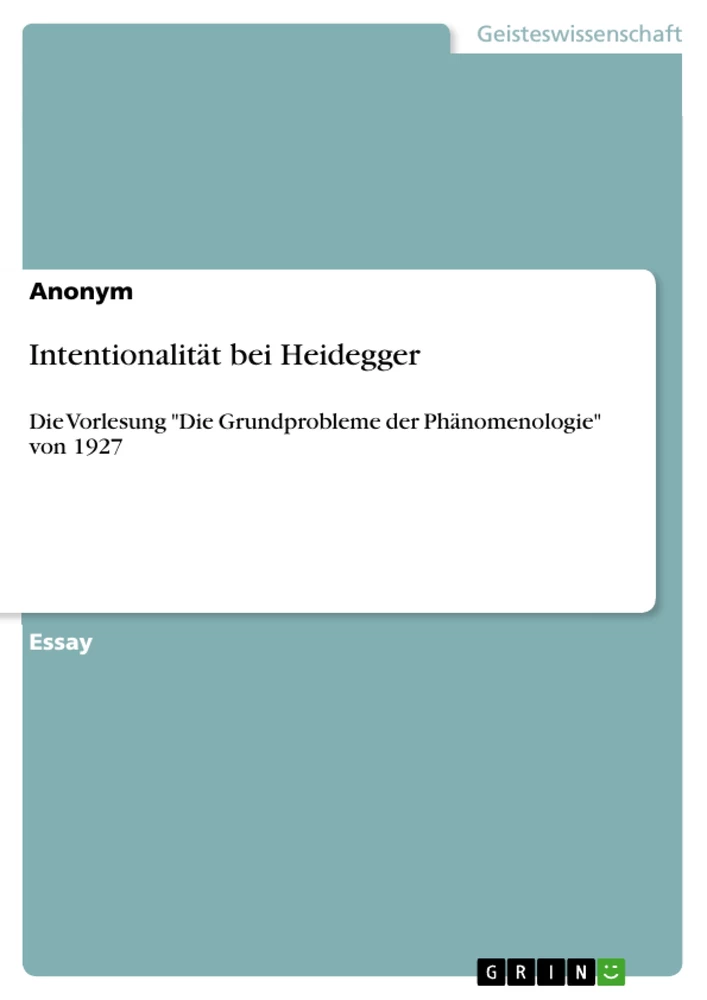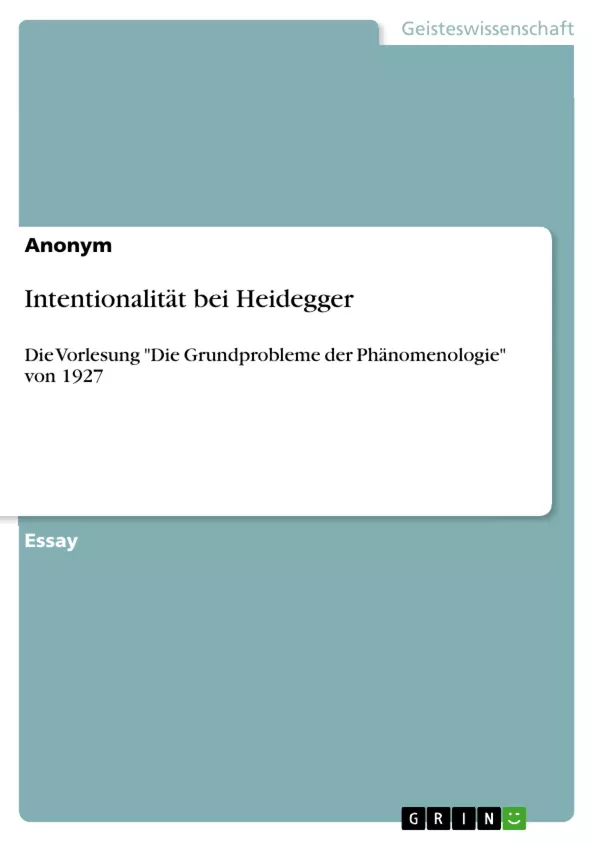Als Intentionalität wurde in der Scholastik die Struktur der Gerichtetheit bezeichnet. Sie spricht von ihr nur bezüglich des Willens. Sie besagt nicht mehr, als dass der Wille (voluntas) sich auf ein Gewolltes richtet.
Erst Franz Brentano hat in Die Psychologie vom empirischen Standpunkt von 1874 die Intentionalität wieder in den Gesichtskreis des philosophischen Denkens gebracht. Ihm war sie das Klassifizierungsmerkmal aller psychischen Erlebnisse. Nicht nur der Wille würde laut Brentano die Struktur des Sichrichtens-auf aufweisen, sondern alle Verhaltungen des Menschen: das Vorstellen, Urteilen und das Lieben und Hassen.
In der Auseinandersetzung mit Brentano sorgt der Problemgehalt der von ihm nicht recht begründeten Intentionalität für eine partielle Abkopplung von der ursprünglichen Absicht Brentanos, der in Abgrenzung gegen Wundt und dem experimentellen Standpunkt der empirischen Psychologie ihre eigene Methode begründen und damit ihr einen eigenen Platz sichern wollte.
In dieser Hinsicht ist die Phänomenologie von Brentano weitestgehend bestimmt und beeinflusst. Insbesondere einer der Schüler Brentanos, Edmund Husserl, befasste sich in den Logischen Untersuchungen mit dem Wesen der Intentionalität. Dessen Schüler wiederum, Martin Heidegger, stellt sich gegen die vorangegangenen Interpretationen der Intentionalität.
Es wird zunächst versucht, Heideggers Kritik an der Deutung der Intentionalität darzulegen, um über die Aufweisung, wie die Intentionalität nicht verstanden werden könne, auf den Kern Heideggers eigener Interpretation zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Missdeutungen der Intentionalität
- 3. Heideggers Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht Heideggers Kritik an der traditionellen Interpretation der Intentionalität, wie sie insbesondere von Brentano und Husserl verstanden wurde. Ziel ist es, Heideggers eigene Auffassung der Intentionalität darzulegen und ihre Bedeutung für sein Verständnis des Daseins zu beleuchten.
- Heideggers Kritik an Brentanos und Husserls Intentionalitätsverständnis
- Die Rolle der Intentionalität im Kontext von Heideggers Daseinsanalytik
- Heideggers Auseinandersetzung mit dem Subjekt-Objekt-Dualismus
- Das Verhältnis von Intentionalität, Zeitlichkeit und Transzendenz
- Die ontologische Bedeutung der Intentionalität für Heideggers Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Intentionalität ein, beginnend mit ihrem Verständnis in der Scholastik und ihrer Wiederbelebung durch Brentano. Sie beschreibt Brentanos Einfluss auf die Phänomenologie und den Gegenpol, den Heidegger in seiner Interpretation der Intentionalität darstellt. Der Essay skizziert den methodischen Ansatz, Heideggers Kritik an bisherigen Interpretationen darzulegen, um schließlich zu seinem Verständnis der Intentionalität vorzudringen.
2. Missdeutungen der Intentionalität: Dieses Kapitel analysiert Heideggers Kritik an zwei zentralen Missverständnissen der Intentionalität in der Philosophie. Die "verkehrte Subjektivierung" sieht die Intentionalität als etwas, das dem Subjekt erst durch das Objekt zukommt, während Heidegger sie als Grundstruktur des Daseins begreift. Die "verkehrte Objektivierung" versteht die Intentionalität als eine Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, während Heidegger sie als konstitutives Merkmal des Daseins selbst, welches immer schon auf etwas gerichtet ist, betont. Die Ausführungen werden anhand des Phänomens der Wahrnehmung veranschaulicht, wobei hervorgehoben wird, dass die Wahrnehmung nicht auf ein immanentes Erlebnis gerichtet ist, sondern stets auf das Objekt selbst. Heidegger argumentiert, dass die Intentionalität die ontologische Bedingung der Möglichkeit jeglicher Transzendenz darstellt.
3. Heideggers Fragestellung: Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Heideggers zentrale Fragestellung bezüglich der Intentionalität. Ausgehend von der Feststellung, dass das Dasein immer schon bei den Dingen verweilt, betont Heidegger die ontologische Notwendigkeit, dies zu begründen. Die Intentionalität wird als spezifische Transzendenz des Daseins verstanden, die untrennbar mit der Zeitlichkeit verknüpft ist. Heidegger postuliert, dass das Dasein nur deshalb intentional ist, weil es in seinem Wesen durch die Zeitlichkeit bestimmt ist. Der Zusammenhang zwischen Zeitlichkeit und Intentionalität bildet den Ausgangspunkt für weitere ontologische Untersuchungen in Heideggers Werk, wie sie in "Sein und Zeit" und "Die Grundprobleme der Phänomenologie" vertieft werden.
Schlüsselwörter
Intentionalität, Heidegger, Brentano, Husserl, Dasein, Phänomenologie, Zeitlichkeit, Transzendenz, Subjekt-Objekt-Problem, Ontologie, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zu: Heidegger und die Intentionalität
Was ist der Gegenstand dieses Essays?
Der Essay untersucht Martin Heideggers Kritik an der traditionellen Interpretation der Intentionalität, wie sie insbesondere von Franz Brentano und Edmund Husserl vertreten wurde. Das Ziel ist es, Heideggers eigene Auffassung der Intentionalität darzulegen und ihre Bedeutung für sein Verständnis des Daseins zu beleuchten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Der Essay behandelt Heideggers Kritik an Brentanos und Husserls Intentionalitätsverständnis, die Rolle der Intentionalität in Heideggers Daseinsanalytik, Heideggers Auseinandersetzung mit dem Subjekt-Objekt-Dualismus, das Verhältnis von Intentionalität, Zeitlichkeit und Transzendenz sowie die ontologische Bedeutung der Intentionalität für Heideggers Philosophie.
Wie ist der Essay strukturiert?
Der Essay gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Missdeutungen der Intentionalität und ein Kapitel, das sich mit Heideggers zentraler Fragestellung zur Intentionalität befasst. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was sind die zentralen Kritikpunkte Heideggers an Brentano und Husserl?
Heidegger kritisiert die "verkehrte Subjektivierung", die die Intentionalität dem Subjekt erst durch das Objekt zukommen lässt, und die "verkehrte Objektivierung", die die Intentionalität als Beziehung zwischen Subjekt und Objekt versteht. Heidegger begreift Intentionalität hingegen als Grundstruktur des Daseins, welches immer schon auf etwas gerichtet ist.
Welche Rolle spielt die Zeitlichkeit in Heideggers Verständnis der Intentionalität?
Heidegger verbindet Intentionalität untrennbar mit der Zeitlichkeit. Das Dasein ist nur deshalb intentional, weil es in seinem Wesen durch die Zeitlichkeit bestimmt ist. Dieser Zusammenhang bildet den Ausgangspunkt für weitere ontologische Untersuchungen in Heideggers Werk.
Welche ontologische Bedeutung hat die Intentionalität für Heidegger?
Heidegger betrachtet die Intentionalität als spezifische Transzendenz des Daseins und als ontologische Bedingung der Möglichkeit jeglicher Transzendenz. Sie ist ein konstitutives Merkmal des Daseins selbst, welches immer schon auf etwas gerichtet ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Essays wichtig?
Schlüsselbegriffe sind Intentionalität, Heidegger, Brentano, Husserl, Dasein, Phänomenologie, Zeitlichkeit, Transzendenz, Subjekt-Objekt-Problem und Ontologie.
Wie wird Heideggers Verständnis der Wahrnehmung in den Essay eingebunden?
Heideggers Ausführungen zur Wahrnehmung veranschaulichen seine Kritik an traditionellen Intentionalitätsverständnissen. Die Wahrnehmung ist nicht auf ein immanentes Erlebnis gerichtet, sondern stets auf das Objekt selbst, was die ontologische Bedingung der Möglichkeit jeglicher Transzendenz darstellt.
Wo findet man weiterführende Informationen zu Heideggers Philosophie?
Weiterführende Informationen finden sich in Heideggers Werken "Sein und Zeit" und "Die Grundprobleme der Phänomenologie".
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Intentionalität bei Heidegger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205172