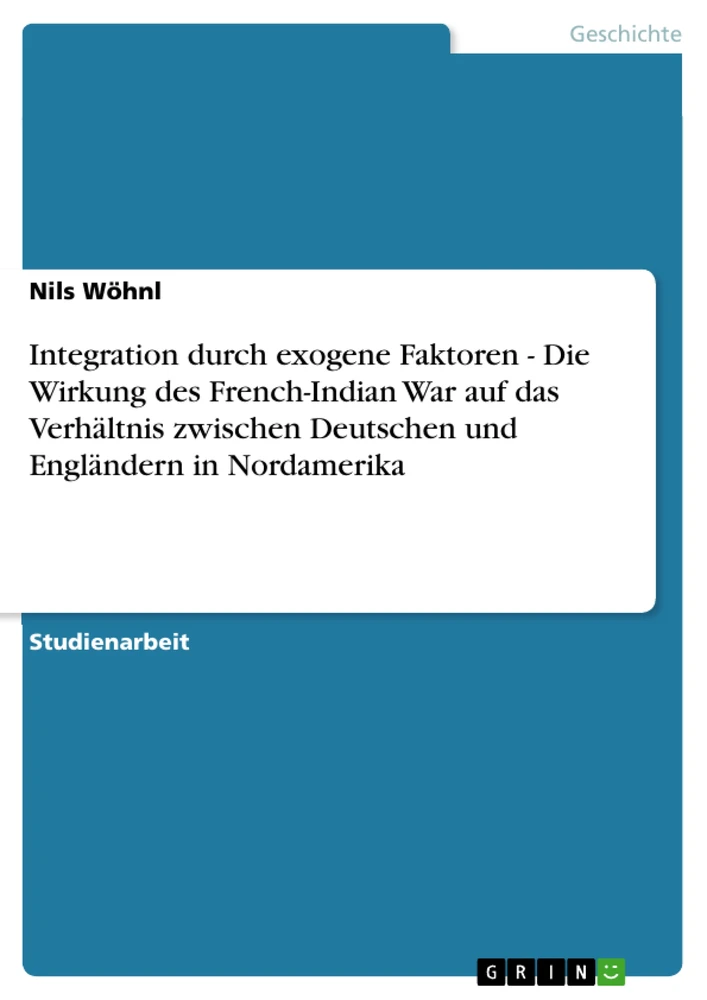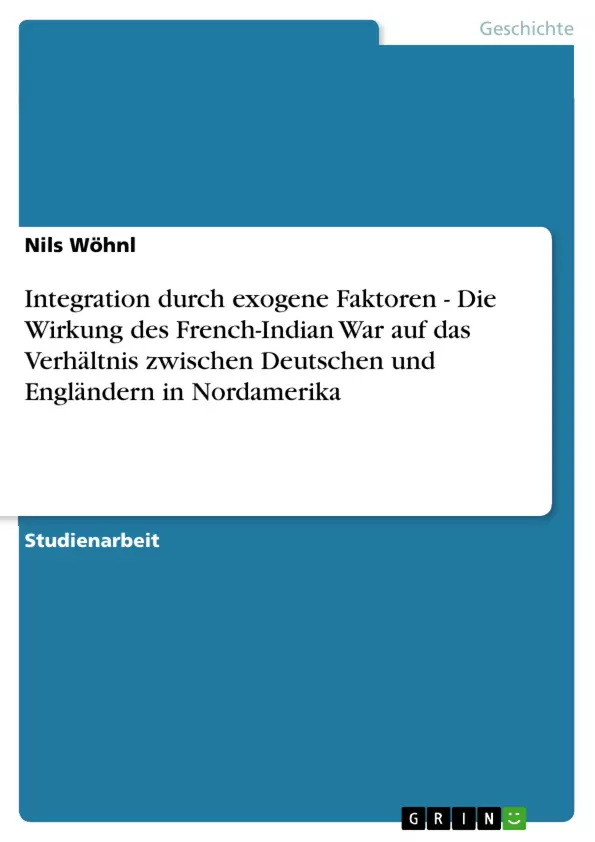Wann entwickelte sich das „Wir-Gefühl“ der Kolonisten der Neuen Welt?
Der Gründungsmythos der Vereinigten Staaten von Amerika beruht auf der Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1776 und dem patriotischen Kampf gegen das Mutterland im American Revolutionary War. Aber dies konnte nicht über Nacht zur Integration aller ethnischen und religiösen Gruppierungen innerhalb der 13 Kolonien führen.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die ersten Schritte des Prozesses der Bildung eines Nationalbewusstseins anhand der Integration der heute genauso wie im 18. Jahrhundert bedeutsamen Großgruppe deutschstämmiger Amerikaner zu untersuchen. Ihr Verhältnis zur Mehrheit, den aus England stammenden Kolonisten, steht dabei im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Nationalstaatsbildung und Integration
- Die deutschstämmige Bevölkerung in den nordamerikanischen Kolonien
- Konflikte um Lebensraum im Vorfeld des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika. Die Indianer werden zu Feinden
- Herstellung von Verteidigungsbereitschaft. Die Deutschen verweigern sich Franklins Plänen
- „Es ist mir gelungen, die (...) angrenzenden (...) Provinzen (...) zu verheeren (...).“ Der äußere Feind zwingt die Krone zum Eingreifen sowie Engländer und Deutsche zur Einheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration deutschstämmiger Amerikaner im 18. Jahrhundert und deren Verhältnis zu englischstämmigen Kolonisten. Im Fokus steht die Frage, welche Faktoren zur Spaltung oder zur Integration beitrugen und wie sich das Bild der Deutschen bei den englischen Kolonisten entwickelte. Der Siebenjährige Krieg in Nordamerika dient als zentraler Fallbeispiel.
- Nationalstaatsbildung und Integration in den nordamerikanischen Kolonien
- Die deutschstämmige Bevölkerung in Nordamerika und ihre Migrationsmotive
- Der Einfluss des Siebenjährigen Krieges auf das Verhältnis zwischen Deutschen und Engländern
- Die Rolle von Benjamin Franklin im Kontext der deutsch-englischen Beziehungen
- Faktoren der Integration und Desintegration deutschstämmiger Amerikaner
Zusammenfassung der Kapitel
Nationalstaatsbildung und Integration: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung eines nationalen Wir-Gefühls unter den Kolonisten in Nordamerika. Es hinterfragt, wie aus zersplitterten Kolonien mit unterschiedlichen Interessen eine Nation entstand und welche Rolle der Siebenjährige Krieg (French and Indian War) dabei spielte. Der Fokus liegt auf der Integration deutschstämmiger Amerikaner und ihrem Verhältnis zur englischen Mehrheit. Benjamin Franklin wird als wichtige Quelle und Repräsentant der englischen Mehrheit vorgestellt, wobei dessen ambivalentes Bild der Deutschen im Laufe des 18. Jahrhunderts beleuchtet wird. Die Hypothese lautet, dass gemeinsame Bedrohungen, wie der Krieg, das Nationalbewusstsein stärken konnten, während Niederlagen zur Ausgrenzung führten.
Die deutschstämmige Bevölkerung in den nordamerikanischen Kolonien: Dieses Kapitel beschreibt die deutschsprachige Einwanderung nach Nordamerika zwischen 1700 und 1800. Es analysiert die "push" und "pull" Faktoren, die zur Auswanderung führten. Religiöse Gründe werden als weniger bedeutsam dargestellt, im Gegensatz zu wirtschaftlichen Faktoren wie Landknappheit und die Verfügbarkeit von günstigem Ackerland in Nordamerika. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Zusammensetzung der deutschstämmigen Bevölkerung und ihre Hintergründe.
Konflikte um Lebensraum im Vorfeld des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika. Die Indianer werden zu Feinden: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden)
Herstellung von Verteidigungsbereitschaft. Die Deutschen verweigern sich Franklins Plänen: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden)
„Es ist mir gelungen, die (...) angrenzenden (...) Provinzen (...) zu verheeren (...).“ Der äußere Feind zwingt die Krone zum Eingreifen sowie Engländer und Deutsche zur Einheit: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden)
Schlüsselwörter
Integration, Nationalstaatsbildung, Deutschstämmige Amerikaner, Siebenjähriger Krieg (French and Indian War), Benjamin Franklin, Kolonialgeschichte Nordamerikas, Ethnische Beziehungen, Migrationsgeschichte, Push- und Pull-Faktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Integration deutschstämmiger Amerikaner im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration deutschstämmiger Amerikaner im 18. Jahrhundert und deren Verhältnis zu englischstämmigen Kolonisten. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die zur Spaltung oder Integration beitrugen, und der Entwicklung des Bildes der Deutschen bei den englischen Kolonisten. Der Siebenjährige Krieg in Nordamerika dient als zentrales Fallbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Nationalstaatsbildung und Integration in den nordamerikanischen Kolonien, die deutschstämmige Bevölkerung in Nordamerika und deren Migrationsmotive, den Einfluss des Siebenjährigen Krieges auf das Verhältnis zwischen Deutschen und Engländern, die Rolle von Benjamin Franklin, und Faktoren der Integration und Desintegration deutschstämmiger Amerikaner.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Nationalstaatsbildung und Integration, der deutschstämmigen Bevölkerung in den nordamerikanischen Kolonien, Konflikten um Lebensraum vor dem Siebenjährigen Krieg (inkl. der Rolle der Indianer), der Herstellung von Verteidigungsbereitschaft und dem Widerstand der Deutschen gegen Franklins Pläne, und schließlich die Rolle des äußeren Feindes (Siebenjähriger Krieg) im Hinblick auf die Einigung von Engländern und Deutschen. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Rolle spielt der Siebenjährige Krieg?
Der Siebenjährige Krieg dient als zentrales Fallbeispiel, um die Integration und das Verhältnis zwischen deutschstämmigen und englischstämmigen Kolonisten zu untersuchen. Er wird als möglicher Faktor betrachtet, der entweder zur Stärkung des Nationalbewusstseins durch gemeinsame Bedrohungen oder zur Ausgrenzung bei Niederlagen beigetragen hat.
Welche Bedeutung hat Benjamin Franklin in dieser Arbeit?
Benjamin Franklin wird als wichtige Quelle und Repräsentant der englischen Mehrheit vorgestellt. Seine ambivalente Sicht auf die Deutschen im Laufe des 18. Jahrhunderts wird untersucht.
Welche Faktoren führten zur Einwanderung der Deutschen nach Nordamerika?
Die Arbeit analysiert die "Push" und "Pull" Faktoren der deutschen Einwanderung. Wirtschaftliche Faktoren wie Landknappheit in Europa und die Verfügbarkeit von günstigem Ackerland in Nordamerika werden als wichtiger erachtet als religiöse Gründe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Integration, Nationalstaatsbildung, Deutschstämmige Amerikaner, Siebenjähriger Krieg (French and Indian War), Benjamin Franklin, Kolonialgeschichte Nordamerikas, Ethnische Beziehungen, Migrationsgeschichte, Push- und Pull-Faktoren.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit postuliert, dass gemeinsame Bedrohungen, wie der Siebenjährige Krieg, das Nationalbewusstsein stärken konnten, während Niederlagen zur Ausgrenzung deutschstämmiger Amerikaner führten.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Es sind Zusammenfassungen für die Kapitel "Nationalstaatsbildung und Integration" und "Die deutschstämmige Bevölkerung in den nordamerikanischen Kolonien" vorhanden. Für die restlichen Kapitel fehlen die Zusammenfassungen im vorliegenden Auszug und müssen anhand des vollständigen Textes erstellt werden.
- Quote paper
- Nils Wöhnl (Author), 2012, Integration durch exogene Faktoren - Die Wirkung des French-Indian War auf das Verhältnis zwischen Deutschen und Engländern in Nordamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205033