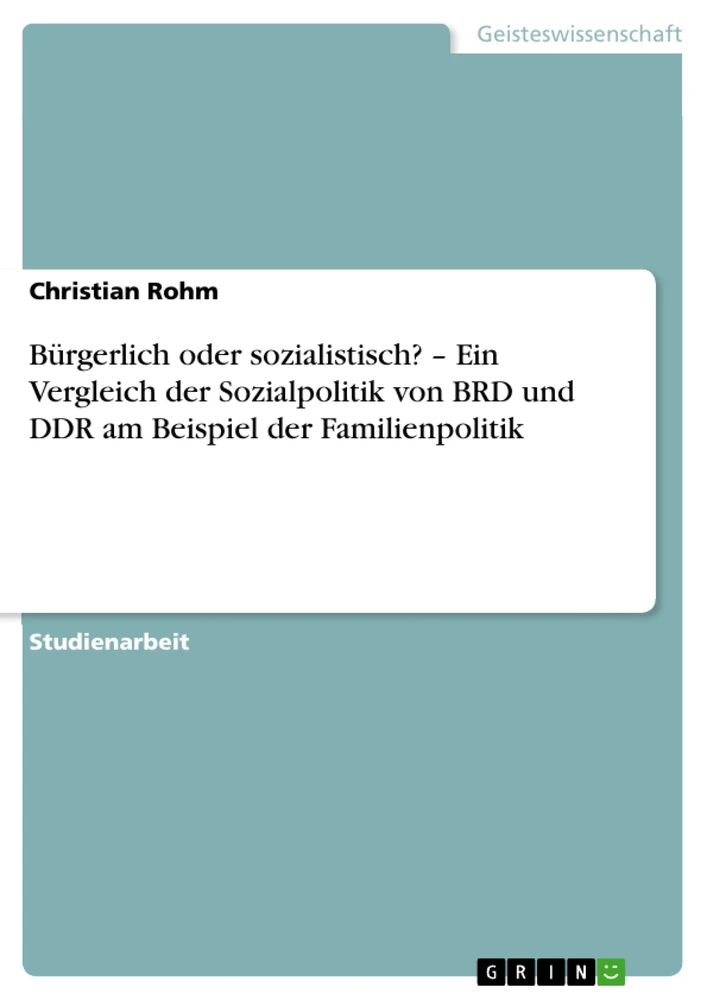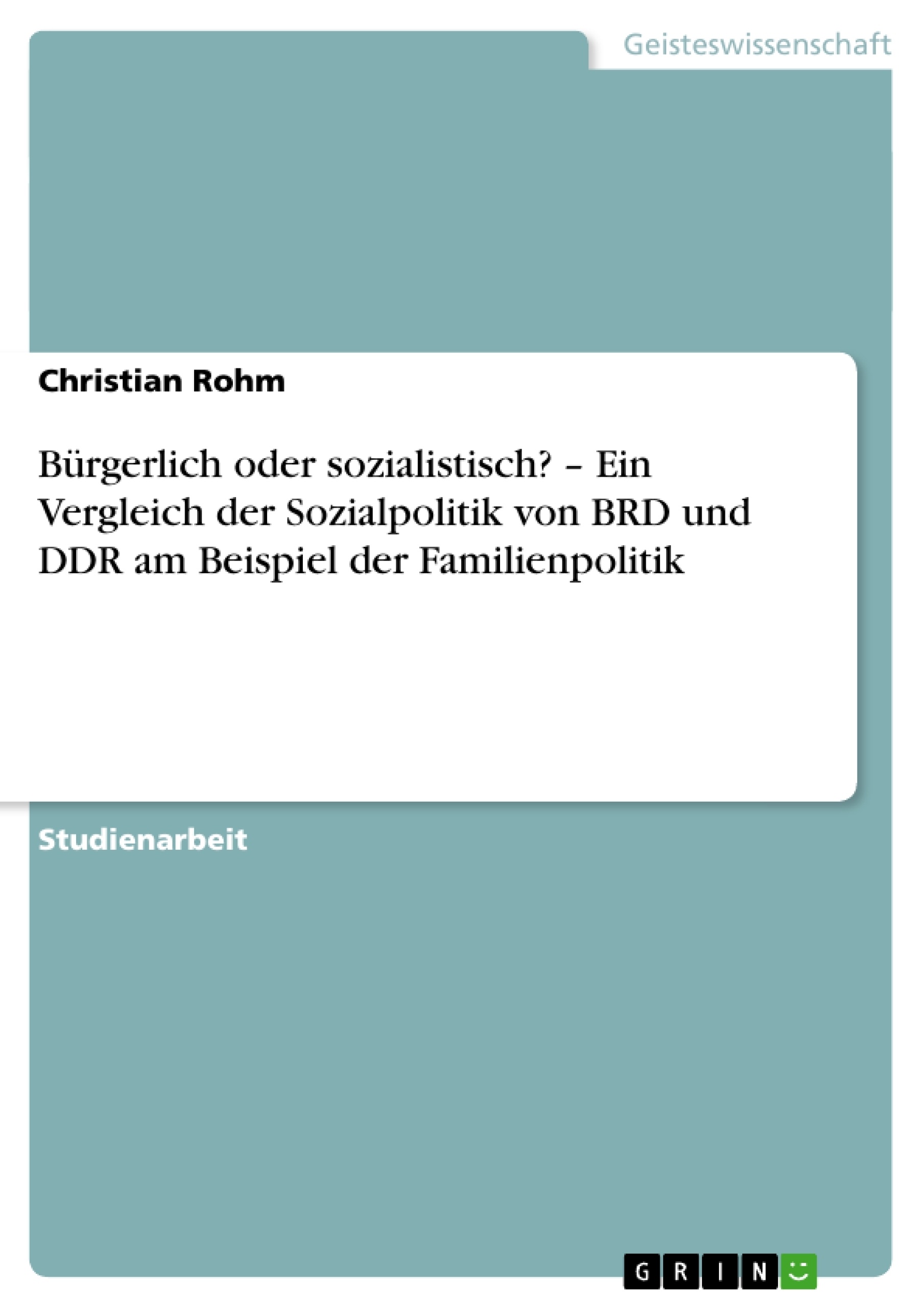Bis zum heutigen Tage bewerten viele Bürger der neuen Bundesländer die Sozialpolitik als die beste Errungenschaft der ehemaligen DDR und zugleich als richtungsweisend für die Politik im vereinigten Deutschland (vgl. z.B. Grundmann 1993). Neben der Arbeitsplatzsicherheit wurde insbesondere die Familienpolitik des SED-Staates mehrfach als besonders wirksam eingestuft, wobei das Lob keineswegs nur von DDR-Autoren oder westdeutschen Befürworten des ostdeutschen Sicherungssystems geäußert wurde (vgl. Schmidt 2004: 98). So lobt beispielsweise Lampert die DDR-Familienpolitik dafür, dass sie „umfassender und differenzierter ausgebaut war und in der Summe sowie gemessen an der ökonomischen Leistungsfähigkeit der DDR positiver zu bewerten ist als die Familienpolitik der Bundesrepublik“ (Lampert 1996: 106) und ist der Meinung, dass sie mit ihrem „gut abgestimmten Mittelsystem“ (Lampert 1990: 78) ihre Ziele weitgehend erreicht habe. Doch trifft die positive Bewertung der DDR-Sozialpolitik tatsächlich zu oder entstammt sie eher einem verklärten Blick auf die Vergangenheit?
Um diese Frage zu beantworten, werden in der vorliegenden Arbeit die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik hinsichtlich ihrer jeweiligen Sozialpolitik gegenübergestellt. Da ein vollständiger Vergleich den Rahmen der Arbeit sprengen würde, wird mit der Familienpolitik ein prominentes Teilgebiet der Sozialpolitik herausgegriffen, das anhand der beiden Staaten exemplarisch miteinander verglichen wird. Die Wahl für dieses Teilgebiet bietet sich an, da sich die DDR-Familienpolitik einer weit verbreiteten Sichtweise zufolge vor allem durch die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf auszeichnete – ein auch in den aktuellen politischen Debatten stets präsentes Thema, da der Politik in der Bundesrepublik häufig vorgeworfen wird, sie würde zu wenig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf tun.
In Kapitel 2 werden zunächst der Begriff „Sozialpolitik“ kurz definiert und anschließend die – unterschiedlichen – Grundprinzipien der Sozialpolitik in den beiden deutschen Staaten vorgestellt. Kapitel 3 rückt mit der Familienpolitik einen speziellen Teilbereich der Sozialpolitik in den Mittelpunkt und versucht, die spezifischen Merkmale der Familienpolitik in der Bundesrepublik und der DDR einander gegenüberzustellen. In Kapitel 4 werden die gewonnenen Erkenntnisse kritisch betrachtet und diskutiert, bevor schließlich ein Fazit gezogen und ein kurzer Ausblick gegeben wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundzüge und Grundprinzipien der Sozialpolitik
- 2.1 Definition des Begriffs „Sozialpolitik“
- 2.2 Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.3 Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik
- 3. Politikfeldanalyse: Familienpolitik
- 3.1 Familienpolitik der Bundesrepublik Deutschland
- 3.2 Familienpolitik der Deutschen Demokratischen Republik
- 4. Diskussion, Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am Beispiel der Familienpolitik. Ziel ist es, die gängige positive Bewertung der DDR-Familienpolitik kritisch zu hinterfragen und empirisch zu überprüfen. Der Fokus liegt auf dem Zeitraum von 1949 bis 1990.
- Definition und Grundprinzipien der Sozialpolitik in BRD und DDR
- Vergleich der Familienpolitik in BRD und DDR
- Analyse der jeweiligen Ziele und Maßnahmen der Familienpolitik
- Bewertung der Wirksamkeit der Familienpolitik beider Systeme
- Gegenüberstellung der jeweiligen Erfolge und Defizite
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der empirischen Haltbarkeit der positiven Bewertung der DDR-Sozialpolitik, insbesondere der Familienpolitik, in den Mittelpunkt. Sie begründet die Auswahl der Familienpolitik als Vergleichsfeld aufgrund ihrer prominenten Rolle in der öffentlichen Debatte und der gängigen positiven Wahrnehmung in Ostdeutschland. Die Arbeit strukturiert ihren Aufbau und skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs.
2. Grundzüge und Grundprinzipien der Sozialpolitik: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sozialpolitik“ und beschreibt die unterschiedlichen Grundprinzipien und Zielsetzungen der Sozialpolitik in der BRD und der DDR im Zeitraum von 1949 bis 1990. Es werden die jeweiligen Konzepte und ihre Auswirkungen auf die soziale Struktur und die gesellschaftliche Entwicklung der beiden Staaten beleuchtet. Der Fokus liegt auf den grundlegenden Unterschieden in den ideologischen Ansätzen und den daraus resultierenden politischen Maßnahmen.
3. Politikfeldanalyse: Familienpolitik: Dieses Kapitel vergleicht die Familienpolitik der BRD und der DDR. Es analysiert die spezifischen Merkmale der Familienpolitik in beiden Staaten, beleuchtet die jeweiligen Maßnahmen zur Unterstützung von Familien und die damit verbundenen Ziele. Der Vergleich konzentriert sich auf die unterschiedlichen Strategien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und deren Auswirkungen auf die soziale Lage von Familien.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Familienpolitik, BRD, DDR, Vergleich, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ostdeutschland, Westdeutschland, Sozialstaat, SED-Staat, empirische Forschung.
FAQ: Vergleich der Sozial- und Familienpolitik in der BRD und DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), fokussiert auf die Familienpolitik im Zeitraum von 1949 bis 1990. Sie hinterfragt kritisch die gängige positive Bewertung der DDR-Familienpolitik und überprüft diese empirisch.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Grundprinzipien der Sozialpolitik in beiden Staaten, vergleicht deren Familienpolitik, analysiert Ziele und Maßnahmen, bewertet die Wirksamkeit und stellt Erfolge und Defizite gegenüber.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundzügen und Grundprinzipien der Sozialpolitik in BRD und DDR, ein Kapitel zur Politikfeldanalyse der Familienpolitik in beiden Staaten und abschließend eine Diskussion, ein Fazit und einen Ausblick.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die kritische Hinterfragung und empirische Überprüfung der positiven Bewertung der DDR-Familienpolitik. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Familienpolitik beider Systeme und der Analyse ihrer Wirksamkeit.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, um die Familienpolitik der BRD und der DDR zu analysieren und zu bewerten. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz detaillierter.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sozialpolitik, Familienpolitik, BRD, DDR, Vergleich, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ostdeutschland, Westdeutschland, Sozialstaat, SED-Staat, empirische Forschung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz beschreibt. Es folgen Kapitel zu den Grundprinzipien der Sozialpolitik und einer detaillierten Analyse der Familienpolitik in beiden Staaten. Die Arbeit schließt mit Diskussion, Fazit und Ausblick.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Der betrachtete Zeitraum erstreckt sich von 1949 bis 1990.
Warum wird die Familienpolitik als Vergleichsfeld gewählt?
Die Familienpolitik wird aufgrund ihrer prominenten Rolle in der öffentlichen Debatte und der gängigen positiven Wahrnehmung in Ostdeutschland als Vergleichsfeld ausgewählt.
- Quote paper
- Christian Rohm (Author), 2010, Bürgerlich oder sozialistisch? – Ein Vergleich der Sozialpolitik von BRD und DDR am Beispiel der Familienpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205013