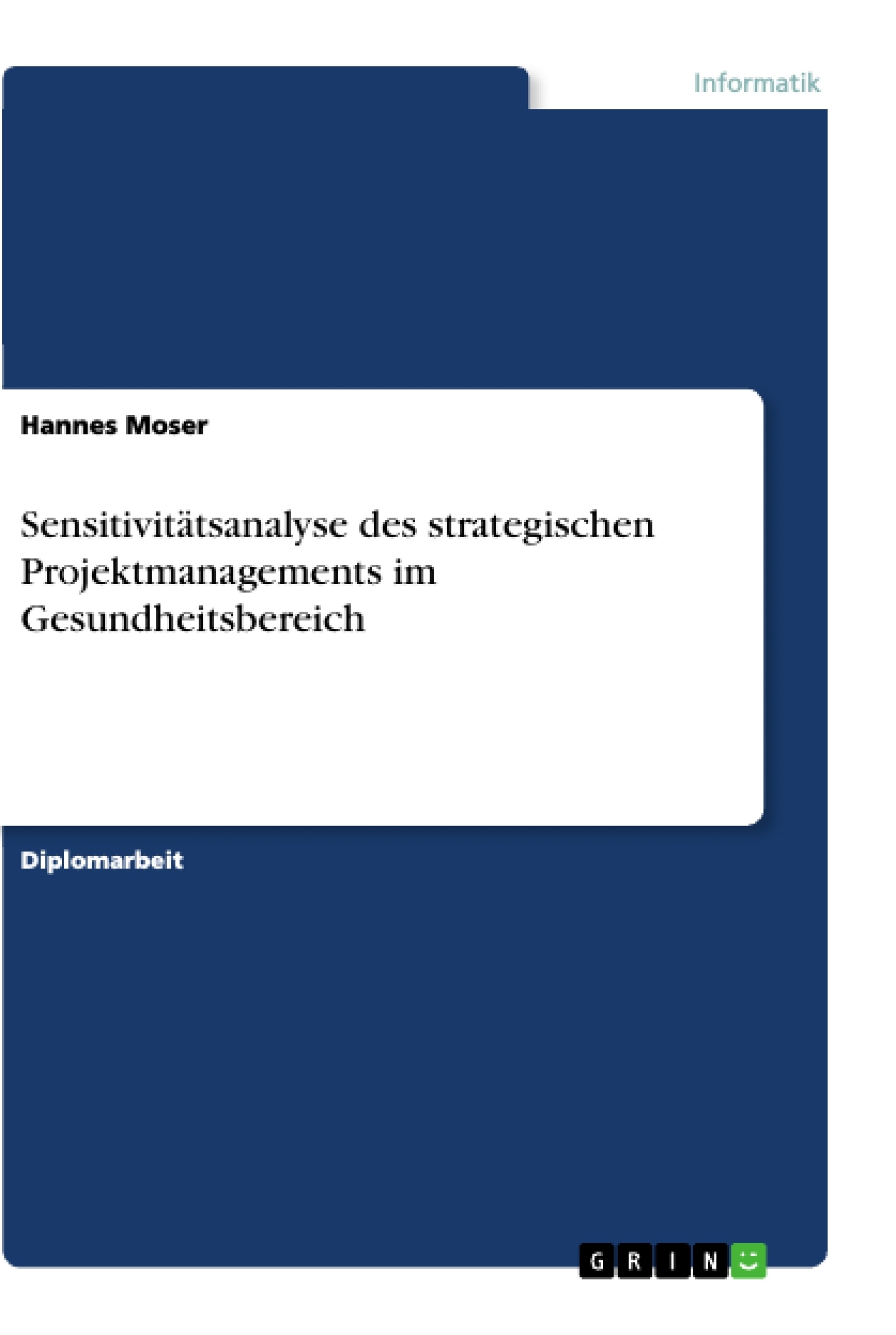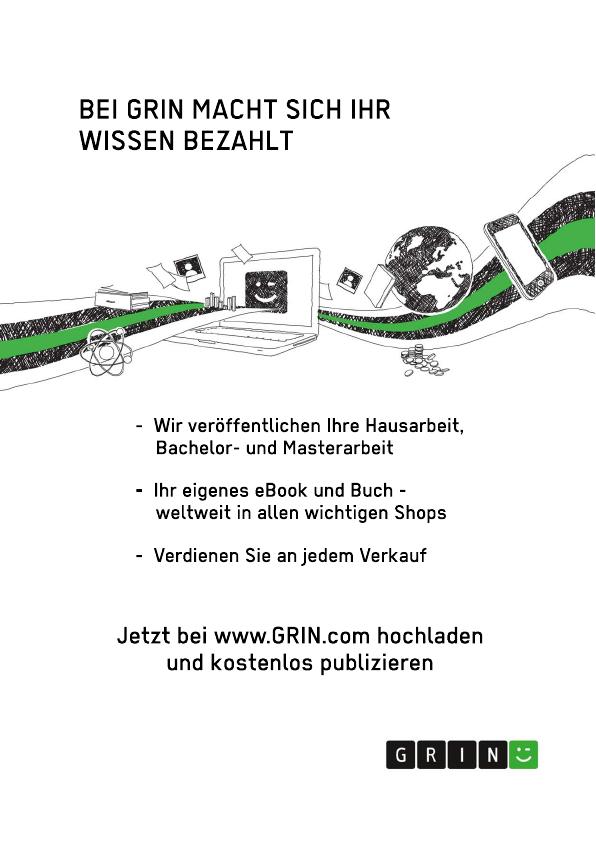Der Operationsbetrieb stellt im klinischen Bereich einen erheblichen Kostenfaktor dar; ca. 15% der Gesamtkosten entstehen bei der Planung, Durchführung und im Umfeld des Operationsbereiches.
Daher besteht seitens der Administration der Wunsch, einerseits kosteneinsparende und andererseits effizienzsteigernde Vorteile zu realisieren, ohne dabei die Qualität der medizinischen Leistung zu beeinträchtigen bzw. diese noch zu effektivieren.
Neben der tatsächlichen Aufgabenstellung, nämlich der Einführung einer integrierten Softwarelösung für den Operationsbereich, sollen in dieser wissenschaftlichen Arbeit ganz gezielt die während des Projektmanagements und der Implementierung auftretenden Besonderheiten aufgezeigt, hinterfragt, mitberücksichtigt und letztendlich auf die spezielle Situation des Gesundheitsbereiches gesehen, implementiert werden.
Alle herausgearbeiteten und für den medizinischen Sektor relevanten Bereiche werden genau beschrieben und analysiert. Ebenso soll für die auftretenden Probleme – soweit möglich – ein Lösungsansatz geboten werden.
Als genereller Leitfaden für das gesamte Projekt dient das Phasenschema nach Haux [HaLa98] (eine Vorstellung erfolgt in Kap. 10.4.3). Ähnliche Modelle finden sich beispielsweise bei Heinrich [Hein96] oder Heilmann [Heil00] (vorgestellt in Kap. 3.2). Die Implementierung des Projektes erfolgt nach dem erstgenannten Schema. Der Aufbau dieser wissenschaftlichen Arbeit orientiert sich nur grob an der beschriebenen Vorgehensweise, das Kapitel strategisches Projektmanagement soll nur Überblicksweise behandelt werden.
Der wichtigere Punkt für die Sensitivitätsanalyse (SA) sind die im Laufe der Projektdurchführung auftretenden Besonderheiten, die nur im Gesundheitsbereich relevant sind, bzw. sich im Gesundheitsbereich von anderen Bereichen (z.B. Industrie) unterscheiden; sie sollen genau hinterfragt und untersucht werden um der besonderen Sensitivität des Gesundheitswesens Rechnung zu tragen. Neben einer allgemeinen Definition des Begriffs im Kapitel 4 wird im Anschluss an jedes Kapitel nochmals erläutert, warum gerade dieser Bereich in der SA Beachtung gefunden hat.
Ein weiteres Augenmerk soll auf Konzepten der Medizininformatik liegen und auf dessen Besonderheiten gegenüber herkömmlichen Informatik – Strategien.
Inhaltsverzeichnis
1. Wissenschaftlicher Hintergrund
1.1. Definition des zu untersuchenden Problems
1.2. Geplante Vorgehensweise zur Lösung des Problems
1.3. zu erwartendes Ergebnis
2. Einleitung
3. Begriffsdefinitionen
3.1. Strategisches Management
3.1.1. Begriffsdefinition
3.1.2. Herausforderungen im Strategischen Management
3.2. Projektmanagement
3.2.1. Softwarelebenszyklus
3.2.2. Phasenkonzept
4. Sensitivitätsanalyse
4.1. Technologiemanagement und Fortschritt
4.2. Die Methode des Vernetzten Denkens
4.2.1. Definition eines Systems
4.2.2. Gesamtheitlich – ganzheitlich
4.2.3. Die Notwendigkeit vernetzten Denkens
4.3. Die Sensitivitätsanalyse
4.3.1. Durch die Sensitivitätsanalyse zum Sensitivitätsmodell
4.3.2. Ein Beispiel
4.3.3. Zusammenfassung.
4.4. Entwicklung des Systemansatzes von Vester
4.4.1. Komplexität
4.4.2. Verschiedene Systemansätze
4.4.3. Der System-Ansatz von Frederic Vester
4.5. Implikationen für das weitere Vorgehen
5. Das Sensitivitätsmodell „IT – Projekt management im Gesundheitsbereich“
6. Medizinische Informatik
6.1. Begriffsdefinitionen
6.1.1. Definition „medizinische Informatik“
6.1.2. Interdisziplinarität
6.1.3. Anwendungsorientierung
6.2. derzeitiger Stand der medizinischen Informatik
6.3. Sensitivitätsanalyse – medizinische Informatik
7. Institutionen des Gesundheitswesens
7.1. Prinzipien der Gesundheitsversorgung
7.2. Grundzüge der LKF in Österreich
7.2.1. Einleitung
7.2.2. Die Fallpauschalen
7.3. Medizinische Informatik im Gesundheitswesen
7.3.1. Einsatz von Informationstechnologie
7.3.2. Medizinische Anwendungssysteme
7.3.3. Patientenkarten
7.3.4. Infrastruktur
7.3.5. Perspektiven
7.4. Sensitivitätsanalyse – Institutionen des Gesundheitswesens
8. Medizinische Dokumentation
8.1. Grundlagen medizinischer Dokumentation
8.2. Medien der medizinische Dokumentation
8.2.1. Konventionelle Patientenakte
8.2.2. Elektronische Patientenakte
8.2.3. Aktenarchiv
8.3. Medizinische Dokumentation im Routinebetrieb
8.3.1. Klinische Basisdokumentation
8.3.2. weitere klinische Dokumentationen.
8.3.3. Nutzungspotentiale der klinischen Basisdokumentation
8.4. Medizinische Begriffsordnungen
8.5. Medizinische Ordnungssysteme und deren Anwendung
8.6. Sensitivitätsanalyse – medizinische Dokumentation
9. Entscheidungsunterstützende Systeme und wissenbasierte Methoden in der Medizin
9.1. Begriffsbestimmung und Abgrenzung
9.1.1. Entscheidungen in der Medizin
9.1.2. Wissen in der Medizin
9.1.3. Kategorisierung entscheidungsunterstützender Ansätze
9.1.4. Definition: Klinisches Entscheidungsunterstützungssystem
9.2. Integrationsaspekte
9.3. Rechnergestützte Wissensverarbeitung
9.3.1. Künstliche Intelligenz und KI – Ansätze
9.3.2. Symbolische Wissensrepräsentation
9.4. Sensitivitätsanalyse – Entscheidungsunterstützung
10. Krankenhausinformationssysteme
10.1. Grundlegende Begriffe und Definitionen
10.1.1. Krankenhausinformationssystem
10.1.2. Nutzer von Krankenhausinformationssystemen
10.1.3. Güte von Krankenhausinformationssystemen
10.1.4. Erstellung von Krankenhausinformationssystemen
10.1.5. Zusammenfassung
10.2. Aufgaben eines Krankenhauses
10.2.1. Primäre Aufgaben
10.2.2. Unterstützende Aufgaben
10.3. Management von Krankenhausinformationssystemen
10.3.1. Begriffsbestimmung
10.3.2. Strategisches KIS – Management
10.3.3. Taktisches KIS – Management
10.3.4. Operatives KIS – Management
10.4. Sensitivitätsanalyse – Krankenhausinformationssysteme
11. Patientenintegration in medizinische Informationskreisläufe
11.1. Stellung des Patienten im Gesundheitswesen und in der Medizin
11.2. Patientenkarten und Professional Cards
11.3. Patienteninformierung
11.3.1. Allgemeines
11.3.2. Ursachen mangelnder Patienteninformierung
11.3.3. Multimediale computerunterstützte Realisierung
11.4. Sensitivitätsanalyse – Patientenintegration
12. Telematik im Gesundheitswesen
12.1. Grundlegende Begriffe und Definitionen
12.2. Telematik im österreichischen Gesundheitswesen
12.3. Telematik für das Gesundheitsmanagement
12.3.1. Patientenorientierte Versorgungsprozesse
12.3.2. Qualitätsmanagement
12.4. Sensitivitätsanalyse – Telematik
13. Medizinisches Qualitätsmanagement
13.1. Grundlagen des Qualitätsmanagements
13.2. Beiträge zum medizinischen Qualitätsmanagement
13.3. Modelle für das Qualitätsmanagement
13.3.1. DIN EN ISO 9000ff
13.3.2. EFQM – Modell
13.4. Medizinische Informatik und Qualitätsmanagement
13.5. Informationsbereitstellung und Kommunikation im Krankenhaus
13.5.1. Interne Elemente
13.5.2. Externe Elemente
13.6. Werkzeuge zur Datenerhebung
13.6.1. Papierfragebögen
13.6.2. Fragebögen mit IT – Unterstützung
13.6.3. Anforderungen an Online – Werkzeuge
13.7. Nicht – technische Voraussetzungen des Qualitätsmanagements
13.8. Sensitivitätsanalyse – Qualitätsmanagement
1. Wissenschaftlicher Hintergrund
1.1. Definition des zu untersuchenden Problems
Der Operationsbetrieb stellt im klinischen Bereich einen erheblichen Kostenfaktor dar; ca. 15% der Gesamtkosten der Univ. Klinik Innsbruck entstehen bei der Planung, Durchführung und im Umfeld des Operationsbereiches. Im Jahr 2001 wurden in 58 Operationssälen 40044 Operationen durchgeführt [HaLe02]. Dabei fielen für den OP – Bereich Gesamtkosten in der Höhe von 60,28 Mio. Euro an [HeMe03].
Daher besteht seitens der Administration der Wunsch, einerseits kosteneinsparende und andererseits effizienzsteigernde Vorteile zu realisieren, ohne dabei die Qualität der medizinischen Leistung zu beeinträchtigen bzw. diese noch zu effektivieren.
Neben der tatsächlichen Aufgabenstellung, nämlich der Einführung einer integrierten Softwarelösung für den Operationsbereich, sollen in dieser wissenschaftlichen Arbeit ganz gezielt die während des Projektmanagements und der Implementierung auftretenden Besonderheiten aufgezeigt, hinterfragt, mitberücksichtigt und letztendlich auf die spezielle Situation des Gesundheitsbereiches gesehen, implementiert werden.
Alle herausgearbeiteten und für den medizinischen Sektor relevanten Bereiche des strategischen Projektmanagements werden genau beschrieben und analysiert; und um die Zusammenhänge der einzelnen Bereiche untereinander sowie deren Interaktion zu erkennen, wird eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Ebenso soll für die auftretenden Probleme des Projektmanagements – soweit möglich – ein Lösungsansatz geboten werden.
1.2. Geplante Vorgehensweise zur Lösung des Problems
Als genereller Leitfaden für das gesamte Projekt dient das Phasenschema nach Haux [HaLa98] (eine Vorstellung erfolgt in Kap. 10.3.3). Ähnliche Modelle finden sich beispielsweise bei Heinrich [Hein96] oder Heilmann [Heil00] (vorgestellt in Kap. 3.2). Die Implementierung des Projektes erfolgt nach dem erstgenannten Schema. Der Aufbau dieser wissenschaftlichen Arbeit orientiert sich nur grob an der beschriebenen Vorgehensweise, das Kapitel strategisches Projektmanagement soll nur Überblicksweise behandelt werden.
Die Arbeit soll vielmehr zwei Hauptthemen umfassen:
- Die Sensitivitätsanalyse (SA) soll die Zusammenhänge die für ein IT – Projekt im Gesundheitswesen zu untersuchenden Bereiche aufzeigen. Es soll deren Verflechtung untereinander sowie deren Interaktion mit Stakeholdern im Gesundheitsbereich dargestellt und analysiert werden. Die im Laufe einer Projektdurchführung auftretenden Besonderheiten, die nur im Gesundheitsbereich relevant sind, bzw. sich im Gesundheitsbereich von anderen Bereichen (z.B. Industrie) unterscheiden; sollen genau hinterfragt und untersucht werden um der besonderen Sensitivität des Gesundheitswesens Rechnung zu tragen. Neben einer allgemeinen Definition des Begriffs in Kapitel 4, sowie der Vorstellung des erarbeiteten Modells in Kapitel 5 wird im Anschluss an jedes Kapitel; in denen Elemente des Projektmanagements untersucht werden; nochmals erläutert, warum gerade dieser Bereich in der SA Beachtung gefunden hat und wie die Ergebnisse des Modells zu interpretieren sind.
- Elemente des IT – Projektmanagements, sowie deren spezielle Ausprägung im Gesundheitsbereich sollen vorgestellt, einer Analyse unterzogen und ihre Stellung innerhalb des Sensitivitätsmodells geklärt werden.
Der erste Teil setzt sich neben theoretischen Konzepten in verschiedenen Bereichen, die sich aus der oben beschriebenen Definition des zu untersuchenden Problems ergeben (Kapitel 3, 4 und 6).auch mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Sensitivitätsmodell (Kapitel 5) und den Rahmenbedingungen der Institutionen des Gesundheitswesens (Kapitel 7) auseinander.
Im zweiten Teil (Kapitel 8 bis 13) werden typische Bereiche, die im IT – Projektmanagement im Gesundheitswesen auftreten, behandelt. Ebenso werden verschiedene Konzepte vorgestellt, die für das strategische Projektmanagement relevant sind und zur Problemlösung herangezogen werden können.
Im Anhang wird exemplarisch die im Laufe des Projektes durchgeführte Modellierung des Bereiches der OP – Organisation (analog der in Kapitel 10 vorgestellten UML) dargestellt.
Die Kapitel sind wie folgt eingeteilt:
- Kapitel 2 stellt eine einleitende Betrachtung zum Thema „ Kosten im Gesundheitswesen “ dar. Der steigende Kostendruck, der mittlerweile auch im Gesundheitswesen sehr stark spürbar ist, ist bekanntermaßen einer der Hauptgründe für ein effizientes Projektmanagement einerseits und dem verstärkten Einsatz von Informationsmanagement andererseits.
- Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit theoretischen Konzepten zum strategischen Projektmanagement in der Wirtschaftsinformatik. Es soll ein Überblick über die Aufgaben des strategischen Projektmanagement gegeben werden, ebenso ein grober Überblick die Gründe, warum ein effizientes, ganzheitliches Projektmanagement gerade im Gesundheitsbereich unabdingbar ist. Ergänzt durch Verweise auf die Literatur wird dieses Kapitel so kurz als möglich gehalten, da Abhandlungen zum Thema Projektmanagement auf der einen Seite zahlreich existieren und auf der anderen Seite das nicht das Hauptthema dieser wissenschaftlichen Arbeit sein soll.
- Im Kapitel 4 wird auf die Sensitivitätsanalyse eingegangen; neben theoretischen Konzepten (Technologiemanagement, Vernetztes Denken, Systemansatz von Vester, …) wird anhand eines praktischen Beispiels die Erstellung einer Sensitivitätsanalyse nach Vester beschrieben.
- Die in Kapitel 4 dargestellte Methode wird dann in Kapitel 5 dazu verwendet, das Sensitivitätsmodell „IT – Projektmanagement im Gesundheitsbereich“ zu konstruieren.
- Kapitel 6 befasst sich mit medizinischer Informatik allgemein; mit Begriffsdefinitionen, der Entstehung der und dem derzeitigen Stand der verschiedenen Bereiche der medizinischen Informatik.
- Das Kapitel 7 beleuchtet grob die Institutionen des Gesundheitswesens und deren Verflechtung mit der medizinischen Informatik.
- Im Kapitel 8 geht es um medizinische Dokumentation und deren Ziele, Arten, Qualität und Medien. Weiters wird die medizinische Dokumentation im Routinebetrieb beleuchtet und analysiert.
- Das Kapitel 9 geht auf die Problematik von Wissensbasierten Systemen und Entscheidungsunterstützung in der Medizin. Es wird erläutert, wie die Integration in ein Informationssystem erfolgen und wie rechnerunterstützte Wissensverarbeitung in der Medizin umgesetzt werden kann.
- Kapitel 10 behandelt das Thema Krankenhausinformationssysteme, deren Aufgabe, deren Modellierung und die Möglichkeit Krankenhausinformationssysteme zu managen.
- Im Kapitel 11 werden Möglichkeiten gesucht, den Patienten in medizinische Informationskreisläufe zu integrieren bzw. Ansätze aufgezeigt, die Patienteninformierung mit IT zu unterstützen.
- Die Telematik im Gesundheitswesen, deren Rahmenbedingungen und deren Ausprägungen werden im Kapitel 12 beleuchtet.
- Im Kapitel 13 wird eines der Hauptziele der Arbeit, nämlich das Qualitätsmanagement analysiert. Neben den Grundlagen werden Modelle des medizinischen Qualitätsmanagements beschrieben, sowie die Möglichkeit einer Integration in die medizinische Informatik und der dafür benötigten Werkzeuge aufgezeigt.
1.3. zu erwartendes Ergebnis
Durch die Beschreibung der „sensitiven Bereiche“ für ein IT – Projektmanagement im Gesundheitsbereich soll für zukünftige Projekte eine ganze Reihe von Verbesserungen, sowohl aus medizinischer, kostenrechnerischer, administrativer als auch patientenorientierter Sichtweise realisiert werden können.
Wie und ob diese im gewünschten Ausmaß realisiert werden können, hängt nicht zuletzt aufgrund der Sensitivität des Gesundheitswesens auch von den aufgeworfenen und untersuchten Besonderheiten eben dieses Bereiches ab.
Ob es nun beispielsweise der Fortschritt in der Informationstechnologie, die duale Sichtweise (medizinische und administrative Sicht), die besonderen Datenschutzbestimmungen und andere gesetzliche Vorgaben oder der Patient sind, die ebendiese Besonderheiten des Projektmanagements in diesem Bereich ausmacht; diese Punkte sollen untersucht werden und das Gerüst für diese Arbeit bilden.
Ob durch die objektorientierte Sichtweise des Projektes Frameworks (Lösungsmuster) geschaffen werden können, die sich generell für andere Projekte in diesem Bereich anwenden lassen, oder ob die Geschäftsprozesse und Benutzerwünsche im geplanten Ausmaß in die Implementierung miteinfließen können, wird die Untersuchung ebenso zeigen wie die besondere Stellung und Situation des Informationsmanagements (IM) bzw. des IM – Projektmanagements im Gesundheitswesen.
Die Arbeit soll dann als Orientierungshilfe für ähnliche Projekte in diesem Bereich dienen, bzw. die Besonderheiten der Medizininformatik aufzeigen, da es im deutschsprachigen Raum dazu kaum Literatur gibt.
2. Einleitung
Der Kostendruck im Gesundheitswesen. Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene steigt; angesichts immer weiter steigender Kosten im Gesundheitswesen; der Druck auf die Einrichtungen des Gesundheitswesens, um die Patientenversorgung effizienter zu gestalten.
So wie in anderen Branchen auch, hat man in den Krankenhäusern erkannt, dass die Verarbeitung, Übermittlung und Speicherung von Informationen einerseits sehr hohe Kosten verursacht, andererseits aber auch ein großes Potential zur Optimierung von Abläufen birgt, d.h. bei der Patientenversorgung, bei Personalmanagement und gegebenenfalls auch bei Forschung und Lehre im Krankenhaus.
„Kein Land Europas leistet sich ein teureres Gesundheitssystem als Österreich, fast 11 Prozent des BIP werden dafür aufgewendet – 1999 waren es knapp 21,8 Mrd. Euro, und die Kosten steigen immer noch weiter. Wir haben – bezogen auf die Bevölkerungszahl – die meisten Spitalsbetten, die häufigsten Einweisungen in Spitäler und mehr teure Untersuchungsgeräte, Magnetfeldresonanzanlagen oder Computertomographen.“ [Brau02] Brauner, Gesundheits- und Sozialreferent der Industriellenvereinigung sieht eine Verschwendung von Geldmitteln: „Unser System ist zu spitalslastig. Die teuerste Form der Medizin kommt überproportional zum Einsatz. Aber es gibt starke Widerstände etwas zu ändern.“
„Die Wahrscheinlichkeit bei einem Linienflug zu sterben, liegt bei eins zu 3 Millionen. Das Risiko, dass man durch einen Behandlungsfehler im Spital stirbt, ist eins zu 400. Trotz strengster Hygienevorschriften infizieren sich 10 bis 15 Prozent der Patienten im Spital selbst“ sagt Univ. – Prof. Christian Köck [Köck02] Er meint weiters, dass steigende Kosten ab einem bestimmten Punkt keinen zusätzlichen Nutzen bringen würden. Durch die immer weiter steigenden Kosten wird ein wesentlicher Teil des Geldes für überflüssige Leistungen ausgegeben, die dem Patienten nicht bringen, aber sehr teuer sind. Dazu kommt noch die Verschwendung durch Doppeluntersuchungen oder Informationsverluste (z.B. zwischen Hausarzt und Krankenhaus, aber auch innerhalb einzelner Organisationseinheiten innerhalb des Krankenhauses). Es fehle an Qualitätskontrolle und Wettbewerb.
Auch Dr. Heinrich Brauner sieht das so [Brau02]: „Die Verluste durch Doppelgleisigkeiten und mangelnde Informationsweitergabe machen 10 bis 15 Prozent der Gesamtkosten im Gesundheitssystem aus. Könnte man nur die Hälfte davon einsparen, wären die Krankenkassen saniert.“
2002 waren erstmals alle neuen Gebietskrankenkassen defizitär. Dass die Kosten mit der Gesundheit der Bevölkerung wenig zu tun haben, zeigen Vergleiche. In Österreich gibt es um 20 Prozent mehr Spitalseinweisungen als in Deutschland, und um 140 Prozent mehr als in den Niederlanden. Aber auch innerhalb Österreichs selbst sind die Unterschiede verblüffend. In Kärnten sind die stationären Kosten je Einwohner fast doppelt so hoch wie im Burgenland und 60 Prozent höher als in Niederösterreich. Die Antwort dafür könnte sein, dass es in Kärnten sie meisten Akutbetten je 1000 Einwohner gibt. Die Kosten dafür tragen die Krankenkassen bis zu einer Höchstgrenze, darüber hinaus zahlt der Spitalserhalter; also der Steuerzahler [Weid02].
Aus diesen Ausführungen kann man erkennen, dass sehr wohl Kosteneinsparungspotentiale im Gesundheitswesen vorhanden sind, aber aufgrund der speziellen Situation nur mit einer gewissen „Sensitivität[1] “ an die Sache herangegangen werden kann. Erfolgreiche IT – Projekte im Gesundheitswesen kann man nur umsetzen, wenn man die Situation in diesem Sektor kennt und auch schon ganzheitlich in IT – Projekten beachtet, da sich aufgrund der Situation für die Beteiligten im Krankenhaus oftmals die Frage stellt, warum in der gespannten finanziellen Lage noch die Kosten (und Mühen) eines IT – Projektes in Kauf genommen werden sollen.
3. Begriffsdefinitionen
3.1. Strategisches Management
3.1.1. Begriffsdefinition
„Strategisches Management soll als Ausdruck einer evolutionären Führungskonzeption Unternehmen in ihrer Höherentwicklung vorantreiben“ [Kirs97].
Krüger definiert: „Strategisch sind alle Fragen und Probleme, die nachhaltig die Erfolgsposition und Erfolgspotenziale der Unternehmung berühren“ [Krüg00].
Der Strategiebegriff stammt aus dem Griechischen (stratos = Heer, agos = Führer) und bezeichnet die Kunst der Heeresführung. Carl von Clausewitz zieht als Erster Parallelen zwischen Militär und Wirtschaft. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts führen von Neumann und Morgenstern den Strategiebegriff aus einem mathematisch – spieltheoretischen Kontext in die Wirtschaftstheorie ein [Kirs97].
Strategisches Management als eigenständige wissenschaftliche Disziplin hat sich erst später entwickelt. Begriffe wie Business Policy, Long Range Planning und Strategische Planung kann man als Vorgänger des Strategischen Managements bezeichnen. Budgetierung, Langfristige Planung, Unternehmensstrategien stehen somit für Ansätze des strategischen Managements, im Rahmen derer immer wieder neue Methoden der Unternehmensplanung entwickelt werden.
3.1.2. Herausforderungen im Strategischen Management
Obwohl die Prognose der Zukunft für jedes Unternehmen mitunter ein Problem darstellt, müssen immer wieder Aussagen darüber getroffen werden, welche Veränderungen im Umfeld zu erwarten sind und wie mit diesen Veränderungen im Sinne des Geschäftserfolges umzugehen sei. Zentrale Herausforderungen ergeben sich hier durch die Vielfalt von Ereignissen, deren Mehrdeutigkeit sowie die Schwierigkeit, komplexe Probleme in überschaubare Einheiten zu zerlegen (für eine schematische Darstellung siehe Abbildung 1) [Kirs97].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: „Herausforderungen im Strategischen Management“ [Kirs97]
Im Umgang mit diesen immer wiederkehrenden Herausforderungen sind strategische Managemententscheidungen in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass sie längerfristige Ziele ins Auge fassen, die durch mittel- und kurzfristige Ansätze und Methoden realisiert werden sollen. Hier kommt der Strategieverwirklichung eine zentrale Bedeutung zu. Denn nur wenn aus Strategien Handeln wird tritt der angepeilte Geschäftserfolg ein [Anwa02].
Strategische Planung beinhaltet im Wesentlichen die Schritte Umweltanalyse, Unternehmensanalyse, strategische Optionen, strategische Wahl und strategische Programme. Nicht mehr Gegenstand der strategischen Planung ist der Prozess der Strategieverwirklichung. Dieser ist jedoch für den Erfolg jeder strategischen Planung von entscheidender Bedeutung. Strategisches Management beinhaltet also im Wesentlichen die Ausdehnung strategischer Aktivitäten über den reinen Planungsprozess hinaus.
Ziel des Strategischen Managements ist es, die strategische Orientierung des Unternehmens im Tagesgeschäft nachhaltig zu verankern, damit – wie bereits erwähnt – aus Strategien Handeln wird [Anwa02].
Das traditionelle Strategische Management ist noch durch die strategische Kontrolle zu ergänzen, die als selbstständiges Steuerungsinstrument den Planungsprozess kritisch absichernd begleitet.
Diese Punkte sind in Abbildung 2: „Strategische Planung und Strategisches Management“ dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: „Strategische Planung und Strategisches Management“ [Anwa02]
3.2. Projektmanagement
Die allgemeinen Regeln des Projektmanagements, die älter sind als die computergestützte Informationsverarbeitung, gelten auch für IT – Projekte [Burg99], [MaBe00]. Demnach sind IT – Projekte (aus der Sicht der betroffenen Institution) einmalige Vorhaben mit hoher Komplexität, die innovatives Vorgehen erfordern, deren Start und Ende terminiert, deren Ressourcen begrenzt und die mit Risiken verbunden sind. Sie erfordern Multiprojektmanagement, weil sie einerseits um einen gemeinsamen Ressourcenpool konkurrieren und andererseits inhaltlich miteinander verknüpft sind. Damit verbunden ist die Projektpriorisierung, d.h. die Bestimmung der Reihenfolge, in der konkurrierende Projekte im Zeitablauf umgesetzt werden sollen.
3.2.1. Softwarelebenszyklus
Ein IT Projekt kann einzelne Informations- und Kommunikationssysteme (Entwicklungs-, aber auch größere Wartungs- und Reengineering – Projekte), übergreifende Inhalte (z.B. Unternehmensdatenmodellierung, Standardisierung und Vernetzung von Systemen) oder IT interne Vorhaben (z.B. Optimierung von Abläufen in der IT – Abteilung oder Einführung neuer Softwareentwicklungsmethoden) zum Ziel haben. IT – Projekte sind demzufolge eng mit Software bzw. Information Engineering verzahnt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: „Softwarelebenszyklus” [Heil00]
Die Abbildung 3: „Softwarelebenszyklus” stellt Projektlaufzeit, Software – Lebenszyklus und ihre zeitliche Folge dar. Das Projektvorfeld bildet eine Wochen bis Jahre umfassende Vorlaufzeit, in der Vorüberlegungen zu einem potenziellen Projekt angestellt und bei hinreichender Konkretisierung Vorstudien erarbeitet werden. Die Projektlaufzeit erstreckt sich zwischen Projektstart und –ende, sie ist in die Phasen Projektplanung, Projektsteuerung und Projektabschluss gegliedert. Projektabschlusskontrollen zählen teilweise zur Projektabschlussphase (z.B. Fortschreibung von Erfahrungsdaten und -kennzahlen), können aber auch erst während der Nutzungszeit anfallen (z.B. Überprüfung des Eintritts der prognostizierten Wirtschaftlichkeit). Der Software – Lebenszyklus beginnt mit dem Projektstart, endet aber erst bei Außerbetriebnahme des Produkts, das Projektziel war. Systemplanung und -entwicklung dieses Produkts liegen parallel zur Projektlaufzeit. Wie die variable Länge des Projektvorfeldes variiert auch die Dauer der anschließenden Nutzungszeit. Sie zählt im Allgemeinen nach Jahren und umfasst den laufenden Betrieb des Produkts, seine Wartung und Weiterentwicklung sowie erforderliche Reverse- und Reengineering – Aufgaben [Heil00].
3.2.2. Phasenkonzept
Grundidee des Phasenkonzepts ist die Reduzierung von Komplexität durch Aufteilung in überschaubare(re) Teilschritte, an deren Ende jeweils eine Überprüfung (Meilenstein) der erreichten Zwischenziele mit anschließender Freigabe der nächsten Phase bzw. Rückgabe zur Überarbeitung oder Projektabbruch steht [Heil00]. Traditionell entsprechen den Phasen Projektplanung, -steuerung und -abschluss fachliche Planungs- und Entwicklungsphasen, deren Untergliederung im Detail von Unternehmen zu Unternehmen variiert. Projektplanung setzt einen fachlichen Grobentwurf voraus, Projektsteuerung läuft parallel zum fachlichen und technischen Feinentwurf und zur Realisierung sowie Einführung des Produkts. Dem Projektabschluss entspricht die Übergabe in den laufenden Betrieb.
Zur Verteilung der Projektlaufzeit auf die einzelnen Phasen besteht Konsens darüber, dass vielfach zu schnell mit der Umsetzung erster Entwürfe begonnen und damit unnötiger Mehraufwand verursacht wird. Höherer Planungsaufwand kann nicht nur Realisierungs-, sondern auch Betriebs- und Wartungskosten substituieren – allerdings mit dem Nachteil, dass diese Substitution erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet und dadurch hinter den zunächst anfallenden, höheren Planungskosten optisch zurücktritt. Das so genannte Wasserfallmodell der Softwareentwicklung [Boeh95] bot ab Ende der 60er Jahre eine Antwort auf die 1968 erstmals so benannte Softwarekrise. Es zerlegte den Projektablauf in Phasen und schloss Rückkopplungsmöglichkeiten zwischen diesen ein. Mit zunehmender Komplexität von IT Projekten wurden evolutionäre bzw. inkrementelle Entwicklungsmodelle wie das Spiral Model von Boehm [Boeh95] vorgeschlagen, die ein Produkt in mehreren Durchläufen einer Entwicklungsspirale (jeweils mit den Teilschritten: Bestimmung von Zielen, Alternativen und Beschränkungen; deren Evaluierung über Risikoanalyse und Prototypenentwicklung; Umsetzung; Planen des nächsten Umlaufs der Spirale) vervollständigen.
Ein weiteres Modell zur Projektplanung samt genauerer Betrachtung wird in Kap. 10.3.3 vorgestellt.
4. Sensitivitätsanalyse
4.1. Technologiemanagement und Fortschritt
Innovationen, die zu neuen Technologien führen, setzen neues Wissen in Naturwissenschaft und Technik voraus. Dieses Wissen wird in der Regel durch Grundlagenforschung auf neue Erkenntnisse ohne Anwendungsbezug ausgerichtet. Angewandte Forschung klärt die Anwendungsbedingungen. Die anschließende experimentelle / konstruktive Entwicklung nutzt die Ergebnisse der angewandten Forschung und kombiniert bereits bekannte Erkenntnisse und Prinzipien.
Neue Technologien setzen vielfach bereits einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess über die Technikfolgen in Gang, noch bevor sie im ökonomischen Sinn als Fortschritt betrachtet werden können; denn dieser liegt erst dann vor, wenn die Innovation am Markt soweit verbreitet ist, dass der Wachstum- bzw. Kostensenkungseffekt höher ist als die Steigerung des Inputs.
Die Technikfolgenabschätzung kann dabei arbeitsplatz-, funktionsbezogen oder auf betrieblicher Ebene erfolgen. Auf Branchenebene oder gesamtwirtschaftlich müssen die Technikfolgen der zu untersuchenden Technik von anderen Einflüssen isoliert werden können. Wissenschaftliche Technikfolgenabschätzung setzt voraus, dass die Folgen der Technik auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. D.h. akzeptierte Theorien oder empirische Befunde [Rein02] Die direkten wirtschaftlichen Technikfolgen beziehen sich dabei auf die Anzahl und Qualifikation der Beschäftigten, Art und Niveau der Investitionen, Art, Menge und Preis der erzeugten Produkte, Wettbewerbsveränderungen etc.
Die Abschätzung weiterer Technikfolgen erfordert die Integration entsprechender Wissenschaften (Psychologie, Soziologie, Medizin,...)
Auf betrieblicher Ebene stellen sich im Rahmen des Technologiemanagements mehr oder weniger dieselben Fragen in folgenden Situationen:
- experimentelle und konstruktive Entwicklungen für Verbesserungen an Produkten,
- Nutzbarmachung neuer Technologien für Verbesserungen im Erstellungsprozess für die „herkömmliche Produktlinie“,
- Einsatz neuer Technologien zur effizienteren Steuerung der betrieblichen Prozesse.
Auch hier besteht das Problem, dass die genaue Abschätzung der Folgen umso schwieriger wird, je neuartiger die Änderungen sind. Da die Informationstechnologie einerseits, aber auch die Medizin andererseits einem raschen Wandel und Fortschritt unterliegt, ist bei Projekten in diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit geboten.
Eine Methode, die in komplexeren Entscheidungssituationen Klarheit bringen kann ist die Sensitivitätsanalyse (SA) nach Frederic Vester, die auf den folgenden Seiten beschrieben wird [Rein02].
4.2. Die Methode des Vernetzten Denkens
Der Methode des Vernetzen Denkens liegt ein ganzheitlicher, systemischer Ansatz zugrunde, der im Folgenden durch Beispiele erläutert wird. Für eine weiterführende wissenschaftliche Analyse der Systemplanung sei an dieser Stelle auf [Hein96] verwiesen.
4.2.1. Definition eines Systems
Systeme bestehen aus vielen verschiedenen Teilen, so genannten Systemelementen, die jedoch nicht wahllos nebeneinander liegen, sondern in einer bestimmten Struktur, Ordnung und Organisation miteinander vernetzt sind [Vest91]. Ein System zeichnet sich dadurch aus, dass jede Änderung / jeder Eingriff Auswirkungen auf das System als Ganzes hat.
Nehmen wir als Beispiel das System „Fußballspiel“: 22 Spieler und ein Ball. Jedoch ist dieses System nicht abgeschlossen. Denn es ist eine Grundvoraussetzung für jedes lebensfähige System, dass es mit seiner „Umwelt“ in Kontakt steht. Beim Fußballspiel sind dies z.B. die Trainer, Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, das Publikum etc. Je nachdem, welche Fragestellung zu beantworten ist, wird der Schwerpunkt auf bestimmte relevante Informationen gelegt, die dann weitere Entscheidungen beeinflussen. Jeder Fußballtrainer betrachtet zunächst einmal das Spiel seiner Mannschaft als Ganzes und wird dann über gewisse Entscheidungen nachdenken. Der Linearstratege wechselt die Stürmer aus, wenn keine Tore fallen. Der vernetzt denkende Trainer sieht, dass es auch daran liegen kann, dass aus dem Mittelfeld keine Unterstützung für den Sturm kommt usw.
Betrachten wir Eingriffe von außen ins System einer Mannschaft, z.B. die rote Karte. Entweder geht ein „Jetzt-erst-recht“ – Ruck durch die Mannschaft und 10 Spieler gewinnen ein verloren geglaubtes Spiel oder es kommt der totale Einbruch. Auf jeden Fall passiert etwas und jeder auf dem Platz ist von den Änderungen betroffen.
Jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes Tier, ist ein System. Diese Systeme bestehen jeweils aus verschiedenen Systemelementen (z.B. Organe bzw. Pflanzenteile), die eine spezifische Aufgabe haben und zum Erhalt des Ganzen beitragen. Jeder Eingriff hat Auswirkungen auf das Ganze.
Auch der Mensch ist ein System, bestehend aus Systemelementen (Organe, Gliedmaßen etc.), die ihrerseits wieder als Subsysteme (bestehend aus verschiedenen Zellen) angesehen werden können. Je nach Fragestellung sind nur bestimmte Informationen über die Teile wichtig. So interessiert z.B. den Fußballtrainer beispielsweise die Ausdauer, das Sprintvermögen und die Geschicklichkeit am Ball. Der Sportmediziner aber ist am Lungenvolumen, an der Anzahl roter Blutkörperchen oder am Zustand der Kreuzbänder interessiert. Und auch beim Menschen gilt, Störungen an Teilen des Systems spürt der ganze Organismus. Er wird krank.
Es mag zunächst abstrakt klingen, aber die gesamte Realität, die uns umgibt, ist im Grunde genommen ein komplexes System, das seinerseits wieder aus unzähligen Subsystemen usw. besteht. Nicht nur Fußballspiele oder Lebewesen sind Systeme. Beispielsweise ist eine Volkswirtschaft ebenso ein System wie ein bestimmter Industriezweig, die raumplanerische Situation im Umfeld einer Großstadt, usw.
Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das größte System, in dem wir alle leben, in das unzählige Subsysteme integriert sind und das schon seit etwa 4 Mrd. Jahren funktioniert, ist die Biosphäre [Vest91]. Gerade in jüngster Zeit treten die Auswirkungen früherer Eingriffe immer stärker ins Bewusstsein, beispielsweise der Treibhauseffekt.
Die Analyse eines Systems und das Handeln in einem vernetzten System erfordern vernetztes Denken. Dabei muss das Ziel sein: Stärkung der Überlebensfähigkeit eines Systems und nicht quantitatives Wachstum. Vernetztes Denken ist ebenso Voraussetzung zur genauen Abschätzung von Folgen insbesondere weitreichender Entscheidungen innerhalb eines Unternehmens. Wie im Sinne ganzheitlicher Problemlösung hier vorgegangen werden kann wird im Weiteren aufgezeigt.
4.2.2. Gesamtheitlich – ganzheitlich
Oft werden die Begriffe „gesamtheitlich“ und „ganzheitlich“ nicht korrekt unterschieden. Dazu die folgende Gegenüberstellung:
- Gesamtheitlich: Es werden Einzelaspekte eines Systems und deren einzelne Auswirkungen betrachtet. Anschließend erfolgt eine einfache Summierung.
- Ganzheitlich: Wichtig ist in erster Linie das Verhalten aller Teile zusammen als Ganzes. Beziehungen und Verknüpfungen zwischen den Elementen sind wichtiger als Details, die nur bei Relevanz für das Systemverhalten betrachtet werden.
4.2.3. Die Notwendigkeit vernetzten Denkens
Ganzheitliches, systemisches Denken und Handeln ist in komplexen Systemen erforderlich; auch und gerade beim Thema Technologiemanagement. Neue Technologien lassen sich nicht nur auf monetäre Größen reduzieren. Bei Entscheidungen müssen alle relevanten Gegebenheiten berücksichtigt werden. Man darf sich nicht getrennt voneinander mit einigen wenigen Aspekten oder gar nur einem einzigen beschäftigen.
Vielmehr gilt es, alle relevanten Einflussfaktoren (Systemelemente) und insbesondere deren Zusammenwirken zu durchleuchten.
Der aus der Chaosforschung bekannte Schmetterlingseffekt, nach dem die Luftbewegungen
eines Schmetterlings in Peking einige Wochen später Sturmsysteme über New York beeinflussen kann [BrPe01], [Glei90], zeigt die unglaublich komplexen Zusammenhänge; kleine Ursache, große Wirkung. Die vielfältigen Abhängigkeiten und Vernetzungen machen die Reaktionen des Systems nicht prognostizierbar.
Die Chaosforschung hat hier einen Berührungspunkt zur Sensitivitätsanalyse. Beides beschäftigt sich mit Zusammenhängen, die von der „normalen“ deterministisch orientierten Naturwissenschaft aufgrund der Komplexität nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Kleinste Änderungen in den Eingangsgrößen können zu „unvorhersehbaren“ Reaktionen bei den Ausgangsgrößen führen. Das darf aber nicht zu der Annahme führen, dass Sensitivitätsanalyse und Chaostheorie unmittelbar miteinander in Verbindung stehen würden. Beide beschäftigen sich jedoch mit der Komplexität und mit der Vernetzung realer Vorgänge. In der Chaosforschung werden in der Tat sehr komplizierte Gleichungssysteme zur Beschreibung von Systemen entwickelt. Diese Systeme bestehen aus einer Verflechtung komplizierter Beziehungen, die aber grundsätzlich mit mathematischen Gleichungen erfasst werden können.
Die Sensitivitätsanalyse beschäftigt sich jedoch mit Systemen bei denen der Mensch, menschliche Empfindungen und menschliches Verhalten eine Rolle spielen. Hier kommt man bei weiteren Betrachtungen mit Grundschulmathematik aus. Es geht um Systeme, bei denen Menschen Entscheidungen treffen aufgrund von Empfindungen, Aufklärung, Wissen etc. Bei diesen Systemen hängt die Zuverlässigkeit von Prognosen auch von der Berücksichtigung zahlreicher psychologischer Aspekte ab. Dietrich Dörner [Dörn89] beispielsweise hat sich intensiv mit menschlichem Verhalten in komplexen Situationen beschäftigt. Durch die Analyse von realen Entwicklungen, von menschlichem Verhalten bei eingetretenen Katastrophen (z.B. Tschernobyl) und anhand von Planspielen und Tests zeigt Dörner, dass der Mensch nicht nur bei kurzfristigen Entscheidungen in komplexen Situationen Fehler macht, sondern erst recht nicht mehr die mittel- und langfristigen Auswirkungen seiner Entscheidungen einschätzen kann.
Vesters Methode der Sensitivitätsanalyse bietet als Antwort darauf ein Instrument an, das in der Lage ist, Vernetzungen zu visualisieren, die Überlebensfähigkeit von Systemen zu bewerten und langfristige Entwicklungen abschätzbar zu machen.
4.3. Die Sensitivitätsanalyse
Ausgehend von den mangelhaften klassischen Planungsansätzen in Unternehmen, in der Regionalplanung und in der Entwicklungshilfe wurde von Frederic Vester die Sensitivitätsanalyse entwickelt [Vest80]. Dieses ist ein kybernetisches Verfahren, das erstmals die Erfassung und Bewertung komplexer Systeme ermöglicht, indem ein Sensitivitätsmodell des betrachteten Systems erstellt wird.
Herkömmliche Verfahren beschränken sich auf das Erfassen der zu untersuchenden Einzelobjekte, wohingegen die Sensitivitätsanalyse die besonders wichtigen Wechselwirkungen und die Berücksichtigung weiterer, mit dem zu betrachtenden System vernetzter Lebensbereiche möglich macht. Qualitative und quantitative Einflüsse können durch die Sensitivitätsanalyse verarbeitet werden.
Die Vorgehensweise bei der Sensitivitätsanalyse baut auf dem Prinzip der Mustererkennung (pattern recognition) auf [Vest89]:
Blickt man die „Abbildung 4: Pattern Recognition“ scharf an, erkennt man abgegrenzte Quadrate in diversen Graustufen. Man ahnt vielleicht, dass es sich hierbei um ein Gesicht handeln könnte. Und genau wie beim scharfen Anblicken dieses Bildes verfahren herkömmliche Planungsansätze. Man beschäftigt sich mit einzelnen Details und jeder kann ganz genau Auskunft erteilen über sein Quadrat. Aber was sich hinter dem Ganzen verbirgt wird oftmals nicht erkannt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Pattern Recognition [Vest89]
Bei der Erstellung eines Sensitivitätsmodells geht man nun genau entgegengesetzt vor. Die Details, also die genauen Grauwerte und die scharfen Grenzen der Quadrate interessieren zunächst nicht. Was wichtig ist, sind die einzelnen Verknüpfungen, also die Übergänge, die Helligkeitsabstufungen zwischen den Quadraten und alle Quadrate als ein Ganzes. Unser Gehirn macht uns vor, wie das funktioniert. Durch Blinzeln, durch Absetzen der Brille oder durch Vergrößern der Entfernung zwischen Augen und Bild nehmen wir unserem Gehirn bewusst die Möglichkeit, scharfe Details zu erkennen: die Quadrate verschwimmen miteinander. Und plötzlich taucht ein viel deutlicheres Bild auf: Abraham Lincoln.
Hier hat unser Gehirn mit der Fähigkeit der so genannten „Mustererkennung“ gearbeitet. Die für das Erkennen des Bildes wichtigen und relevanten Informationen, also die Helligkeitsunterschiede über das ganze Bild, haben genügt, um ohne Detailkenntnis die Realität zu erkennen.
4.3.1. Durch die Sensitivitätsanalyse zum Sensitivitätsmodell
Bei der Sensitivitätsanalyse geht es also nicht darum, Details zu erkennen. Das Verhalten des Systems steht im Mittelpunkt.
Die Vorgehensweise kann grob folgendermaßen zusammengefasst werden [Vest80]:
Die Basis einer jeden Sensitivitätsanalyse bildet ein überschaubarer Satz von Variablen. Da in allen darauf folgenden Schritten mit diesen Variablen gearbeitet wird, ist eine sorgfältige Auswahl dieser Variablen unbedingt notwendig. Mehrere inhaltlich zusammengehörende Fakten werden meist unter einer einzigen Variablen vereinigt.
Die Methodik bei der Erstellung basiert auf Gruppenarbeit, wobei Teilnehmer aus den Reihen aller vom System Betroffenen und am System Beteiligten mitarbeiten sollten. Denn nur so kann ein ganzheitliches Bild der Wirklichkeit geschaffen werden. Zur Ermittlung der Einflussfaktoren sollte eine Kreativitätstechnik angewendet werden.
Damit alle relevanten Bereiche durch die erstellten Variablen berücksichtigt werden, ist es vorteilhaft, dass sich die Gruppe zunächst einmal eine Struktur erarbeitet, an der man sich bei der anschließenden Ermittlung der Variablen orientiert. Dies kann zum einen durch eine Orientierung an vorhandenen Modellen und Beispielen und dessen spezifische Übertragung auf die Problemstellung geschehen. Die zweite Möglichkeit ist, die Gruppe erarbeitet sich in methodischer Vorgehensweise diese Struktur selbst, indem zunächst einmal generell die denkbaren Einflussfaktoren ermittelt werden. Daraus kann dann die Gruppe wiederum die Einflussvariablen ermitteln, diese müssen nur die Voraussetzung erfüllen, dass sie quantifizierbar sind, d.h. größer oder kleiner werden können.
4.3.2. Ein Beispiel
Hier soll als Beispiel die Fragestellung dienen, welchen Einfluss die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auf die Situation eines Unternehmens am Markt hat. Das Beispiel wurde im Rahmen eines Workshops von Unternehmen der Elektroindustrie erarbeitet [Rein02][2]:
Nachdem zunächst eine Vielzahl von Einflussfaktoren ermittelt worden war (z.B. Betriebsklima, wirtschaftliche Situation des Unternehmens, Tarifpolitik, ...) wurden daraus Variablen abgeleitet. Variablen im Sinne einer Sensitivitätsanalyse müssen quantifizierbar sein, d.h. größer oder kleiner, zu- oder abnehmen können.
Somit liegt eine erste Variablensammlung vor, mit der begonnen werden kann, das Wirkungsgefüge in Form eines Netzwerks aufzubauen. Hierbei muss betont werden, dass die gesamte Sensitivitätsanalyse bis hin zum Sensitivitätsmodell ein iterativer Prozess ist. Das heißt während des nun folgenden Aufbaus des Wirkungsgefüges, den die Gruppe gemeinsam unter Moderation vornimmt, können neue Variablen hinzukommen und es kann sich ebenso zeigen, dass einzelne Variablen gar nicht benötigt werden. Außerdem können wiederholt Redefinitionen von einzelnen Variablen notwendig werden. Beim Aufbau des Wirkungsgefüges versucht man zunächst, den so genannten Grundkreislauf zu erstellen.
Dieser ist nun Schritt für Schritt auszubauen bis hin zum kompletten Netz (vgl. Abbildung 5: Sensitivitätsmodell – „Lohneinbuße bei Krankheit“), das als Sensitivitätsmodell die Realität unter der betrachteten Fragestellung widerspiegelt.
Man könnte im Bedarfsfall zusätzlich die einzelnen Pfeile mit einer „Übertragungsdauer“ und die Variablen mit einer „Reaktionszeit“ belegen. Somit können auch zeitliche Effekte erfasst werden.
Je nach Art der Einflussnahme einer Variablen auf eine andere werden die Einflüsse dementsprechend gekennzeichnet:
- eine Änderung der Variable A nimmt erhöhend Einfluss auf Variable B: + (grün dargestellt)
- eine Änderung der Variable A nimmt verringernd Einfluss auf Variable B: - (rot dargestellt)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Sensitivitätsmodell – „Lohneinbuße bei Krankheit“ [Rein02]
Als weiteres Analyseinstrument dient die Einflussanalyse. Hierbei werden die einzelnen Wechselwirkungen nach ihrer Stärke eingeschätzt:
1 = dünner Pfeil = schwache Wirkung
2 = mittel
3 = dicker Pfeil = starke Wirkung
Somit kann jeder Variable eine Aktivsumme (Summe aller Auswirkungen auf andere Variablen) und eine Passivsumme zugeordnet werden (vgl. Tabelle 1: Aktiv- und Passivsummen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Aktiv- und Passivsummen [Rein02]
Variablen mit einer hohen Aktivsumme sind Variablen, die insgesamt gesehen einen hohen Einfluss auf andere Variablen ausüben (d.h. entweder in hohem Maß auf andere Variablen bzw. auf viele andere Variablen wirken). Dementsprechend sind Variablen mit einer hohen Passivsumme einem hohen Einfluss durch andere Variablen ausgesetzt.
Aus Tabelle 1 lässt sich eine grafische Einflussanalyse ableiten, auf der der unterschiedliche Charakter der einzelnen Variablen sehr schnell zu erkennen ist (Abbildung 6: Grafische Einflussanalyse).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Grafische Einflussanalyse [Rein02]
4.3.3. Zusammenfassung.
Die Sensitivitätsanalyse arbeitet nach dem Unschärfeprinzip: das Wesentliche und für die Fragestellung wichtige zu erkennen ist wichtiger als alle Details des Untersuchungsbereiches.
Bei der Erstellung eines Sensitivitätsmodells kommt es darauf an, alle Sichtweisen einfließen zu lassen.
Vernetzungen komplexer Zusammenhänge werden sichtbar; auf dieser Basis können Entscheidungen besser vorbereitet werden.
Ein Sensitivitätsmodell ist auch als „Frühwarnsystem“ nutzbar.
4.4. Entwicklung des Systemansatzes von Vester
4.4.1. Komplexität
Man muss beim Begriff „Komplexität unterscheiden zwischen komplexer Struktur und komplexem Verhalten (Abbildung 7: Komplexität), entsprechend muss man seine Vorgehensweise wählen. Man erkennt sehr leicht, dass die Systeme, die sowohl eine komplexe Struktur als auch komplexe Verhaltensweisen aufweisen, am schwierigsten zu beherrschen sind.
Systeme werden insbesondere dann komplex, wenn das Verhalten von lebenden Organismen (z.B. Ökosysteme) oder menschliches Verhalten berücksichtigt werden muss. Insbesondere bei menschlichem (ir)rationalen Verhalten kommt man mit herkömmlichen Analyseinstrumenten oft nicht zum gewünschten Ergebnis [Rein02].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Komplexität [Rein02]
Komplexe Situationen haben folgende Charakteristik [Dörn89]:
- Viele, sich gegenseitig beeinflussende Faktoren
- Dynamisches Verhalten, das System wartet nicht wie ein Schachspieler auf den nächsten Zug sondern es „lebt“.
- Es kann nicht alles genau erkannt werden. Dörner vergleicht es mit Milchglas, durch das nur unscharfe Konturen sichtbar werden;
- Komplexe Systeme zeigen nichtlineares Verhalten; in einigen Bereichen sogar durchaus chaotische Züge.
Nach Dörner [Dörn89] werden beim Umgang mit komplexen Systemen am häufigsten folgende Fehler gemacht:
- Mangelhafte Zielbeschreibung: Das System wird so lange untersucht, bis man mit einfachen Eingriffen kurzfristige Erfolge verbuchen kann. Langfristiges und nachhaltiges Denken wird vernachlässigt. Dies führt häufig zu einem Reparaturdienstverhalten.
- Menschen neigen dazu, riesige Datenmengen zu sammeln, dieses werden aber nicht zueinander in Beziehung gesetzt oder miteinander verknüpft. Der kybernetische Charakter wird übersehen.
- Irreversible Konzentration auf ein bestimmtes Untersuchungsgebiet: Aufgrund einiger positiver Anfangserfolge durch bestimmte Maßnahmen fällt es außerordentlich schwer sich auch anderen Feldern zuzuwenden.
- Durch lineares Denken verursacht, werden Wechselwirkungen und indirekte Einflüsse übersehen.
- Oft neigen diejenigen, die Macht und Befugnisse haben, zu autoritärem Verhalten. Dieses provoziert versteckte Widerstände, deren Überwindung viel Energie kostet.
4.4.2. Verschiedene Systemansätze
In der Wissenschaft haben sich im Laufe der letzen Jahrzehnte verschiedene Systemansätze herausgebildet. Diese haben miteinander gemeinsam, dass Sie Systeme (mit mehr oder weniger mathematischem Aufwand) beschreiben und dass sie Hinweise und Werkzeuge liefern, das Systemverhalten zu analysieren und über dessen zukünftige Entwicklung Aussagen zulassen. Der Unterschied dieser verschiedenen Systemansätze liegt zum einen in den verschiedenen Wissenschaftsfeldern begründet, in denen sie angewendet werden und zum anderen darin, wie stark menschliches Verhalten berücksichtigt werden muss (z.B. Persönlichkeit, Denkweisen, Vorlieben, Wertesysteme, kulturelle Einflüsse etc.). Einige Systemansätze benötigen umfassende mathematische Instrumente (beispielsweise Systeme von Differentialgleichungen), z.B. Wieners Kybernetik – Ansatz oder die Allgemeine Systemtheorie von Bertalanffy [Ossm00]. Ebenso kennt die Psychologie einen systemischen Ansatz, um Kommunikation und soziale Interaktion zwischen Menschen zu beschreiben.
Der Systemansatz von Jay W. Forrester, der durch den Bericht „Grenzen des Wachstum“ an den Club of Rome 1972 bekannt wurde [Mead72]. Hierin wurden mathematische Modelle zum Wachstum der Menschheit und dessen Folgen entwickelt und diskutiert. Forrester beschreibt den Zusammenhang zwischen zwei Variablen durch detaillierte Funktionsgleichungen, aber er verwendet gleichzeitig Zeitintervalle zur Beschreibung für seine Betrachtung und rechnet nur von Zeitpunkt tn zu tn+1.
4.4.3. Der System-Ansatz von Frederic Vester
Der in dieser Arbeit beschriebene und verwendete Systemansatz von Frederic Vester ist ein ökologisch-biologischer Ansatz, da er sich – auch nach Aussage seines Begründers – am realen Verhalten lebender Organismen orientiert.
Die von Vester entwickelte Methode kann auf Systeme angewendet werden, die sich durch komplexe Strukturen und komplexes Verhalten auszeichnen. Menschliches Denken, Verhalten und menschliche Handlungsmuster lassen sich ebenso wie wirtschaftliche und soziale Beziehungen einbeziehen. Vesters Ansatz wurde erfolgreich angewendet zur unternehmerischen Strategieplanungen, Technikfolgenabschätzung, Entwicklungshilfeprojekte, Wirtschaftsentwicklung, Raum- und Umweltplanung, Verkehrsplanung etc.
Neben dem beschriebenen Beispiel (siehe Kapitel 4.3.2) sind eine Vielzahl von weiteren unterschiedlichen Anwendungen z.B. in [Vest99], [PrGo91] oder [UlPr88] nachzulesen.
Vester beschreibt die Zusammenhänge zwischen zwei Systemelementen nicht in Form mathematischer Gleichungen sondern mit Hilfe einfacher „wenn – dann“ – Beziehungen. Es wird lediglich zwischen gleichgerichteten und gegengerichteten Wechselwirkungen unterschieden. Tatsächlich genügt diese einfache Beschreibung, um das dynamische Verhalten von Systemen zu beschrieben. Die genaue Erfassung von Daten ist zweitrangig, wichtig ist das Verhalten. Es spielt keine Rolle, ob z.B. 500000 Pkw mehr oder weniger im Jahre 2005 auf den Straßen unterwegs sind, wenn die Treibstoffpreise fallen, wichtig ist zu wissen, dass die Zahl der Pkw drastisch ansteigen wird. Im Sinne von Vester genügt für diese eine Wechselbeziehung (innerhalb des sehr komplexen Systems „Verkehr“) die Beschreibung „wenn die Treibstoffpreise fallen, wird die Zahl der Pkw zunehmen“. Dieses ist eine von mehreren wesentlichen Beziehungen innerhalb dieses Systems. Die Stärke von Vesters Ansatz liegt u.a. darin, dass nicht erheblicher Aufwand vergeudet wird, um sich mit der Formulierung einer Differentialgleichung zu beschäftigen, die hinterher zur Lösung nur noch mehr Aufwand verursacht. Ein zweiter Grund zum Versicht auf genaue Funktionsgleichungen liegt darin, dass die Zusammenhänge in solchen
Systemen, auf denen Vesters Ansatz angewendet werden kann, von vorne herein so komplex sind, dass sie gar nicht erfasst werden können. Das gilt insbesondere für menschliche Denk und Verhaltensmuster. Es werden bewusst unscharfe Formulierungen gewählt; z.B. „wenn der Professor öfter zu spät kommt, dann werden auch die Studenten unpünktlicher“. Was ist öfter, was bedeutet zu spä t, was bedeutet nachlässiger ? Mathematisch können diese Aussagen nicht erfasst werden, in Vesters Modell ist diese Aussage ganz einfach zu formulieren (siehe dazu Abbildung 8: Einfache Formulierung unscharfer Zusammenhänge bzw. Abbildung 5: Sensitivitätsmodell – „Lohneinbuße bei Krankheit“).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Einfache Formulierung unscharfer Zusammenhänge [Rein02]
Die genaue Vorgehensweise bei der Modellerstellung ist sehr gut beispielsweise in [Vest99] beschrieben. Es handelt sich um einen rekursiven Prozess, bei dem im Wesentlichen die folgenden neun Schritte zu berücksichtigen sind:
1. Systembeschreibung;
2. Erfassung der Einflussgrößen;
3. Prüfung auf Systemrelevanz;
4. Hinterfragung der Wechselwirkungen;
5. Bestimmung der Rolle im System;
6. Untersuchung der Gesamtvernetzung;
7. Kybernetik einzelner Szenarien;
8. Wenn-dann-Prognosen und Policy – Tests;
9. Systembewertung und Strategie.
In Abbildung 9: Erstellungsprozess eines Sensitivitätsmodells ist die rekursive und sich mehrfach korrigierende Erstellung eines Sensitivitätsmodells dargestellt. Definitionen und Beschreibungen werden immer wieder aufgrund der neuesten Ergebnisse nachgelagerter Arbeitsschritte erweitert, ergänzt, modifiziert, hinzugefügt, gestrichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Erstellungsprozess eines Sensitivitätsmodells [Rein02]
4.5. Implikationen für das weitere Vorgehen
Die Beziehungen zwischen den Parametern eines Entscheidungsmodells (in diesem Fall das IT – Projektmanagement im Gesundheitswesen) und deren Auswirkungen auf die Lösung eines Entscheidungsproblems, kurz die Sensitivitätsanalyse, wurde und wird bisher bei zahlreichen Entscheidungsmodellen nicht oder nur wenig ausführlich behandelt, obwohl sie für die Anwendungsmöglichkeit zweifellos von großer Wichtigkeit ist [Eigi88].
Aus der im vorigen Kapitel beschriebenen Vorgehensweise für die Erstellung eines Sensitivitätsmodells wird eine SA nach dem Ansatz von Vester für das IT – Projektmanagement im Gesundheitsbereich durchgeführt.
Es wurde nach der beschriebenen Vorgehensweise (siehe Abbildung 9: Erstellungsprozess eines Sensitivitätsmodells) von der Projektgruppe ein Set von Variablen für den genannten Untersuchungsbereich erstellt; das Set und das Wirkungsgefüge wird im folgenden Kapitel 5 dargestellt.
Danach erfolgt eine Eingrenzung auf Bereiche des strategischen Projektmanagements (im in Kapitel 5 vorgestellten Modell werden alle relevanten Bereiche der medizinischen Informatik erfasst); diese werden dann in den nachfolgenden Kapiteln aus Sicht des Projektmanagements im Gesundheitsbereich analysiert und beschrieben. Am Ende jedes Kapitels wird das Ergebnis der SA für den behandelten Bereich zusammenfassend nochmals dargestellt.
Auf mathematische Ausprägungen der Sensitivitätsanalyse wie sie z.B. oft im Rahmen der linearen Programmierung[3] oder in der Haushalts- und Produktionstheorie[4] Anwendung finden wird bewusst verzichtet, da für den konkreten Untersuchungsbereich die Methode von Vester aus den genannten Gründen als die Geeignetste erscheint.
5. Das Sensitivitätsmodell „IT – Projekt management im Gesundheitsbereich“
Analog zu der im vorigen Kapitel 4.4.3 beschriebenen Vorgehensweise wurde in Anlehnung an Lehmann [LeMe02] in Zusammenarbeit mit Vertretern des Gesundheitswesens (im Folgenden vereinfacht als „Projektgruppe“ bezeichnet) ein Sensitivitätsmodell entwickelt, das alle relevanten Bereiche für das IT – Projektmanagement im Gesundheitsbereich und deren Wechselwirkung umfasst.
Im Sinne des ganzheitlichen Bezuges der Analyse – wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben – wurden weiters fünf Stakeholder identifiziert (siehe Abbildung 10), die auf Projekte im Gesundheitsbereich Einfluss nehmen können [Shor01].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Stakeholder bei Projekten im Gesundheitswesen nach Shortliffe [Shor01]
Für das Gesamtmodell wurde das folgende Variablenset definiert:
1. medizinische Informatik *
- Wurzeln (Organisationslehre, medizinische Dokumentation, maschinelle Datenverarbeitung, medizinische Statistik)
- derzeitiger Stand (Modellierung biologische Systeme, medizinische Robotik, Integration des Patienten, Telemedizin, Lehr- und Lernsysteme, Qualitätsmanagement)
2. Institutionen des Gesundheitswesens *
- Gesundheitsversorgung
- Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung (LKF)
- medizinische Informatik im Gesundheitswesen
3. Medizinische Dokumentation *
- Grundlagen (Ziele, Arten, Qualität)
- Medien
- medizinische Dokumentation im Routinebetrieb
- medizinische Begriffsordnungen
- medizinische Ordnungssysteme und deren Anwendung
4. Entscheidungsunterstützende Systeme und wissensbasierte Methoden *
- Entscheidungen
- Wissen
- Integrationsaspekte
- rechnergestützte Wissensverarbeitung
5. Modellierung biologischer Systeme
6. Medizinische Statistik
- Studien in der Medizin
- Auswertungen
7. Medizinische Signalverarbeitung
- Auswertung
- Verarbeitung
- Klassifikation
- Interpretation
8. Medizinische Bildverarbeitung
- Speicherung und Kommunikation
- Visualisierung
- Bearbeitung
- Klassifikation
9. Computergestütze Chirurgie
- Computergestütze OP – Planung
- Computergestütztes Operieren
10. Krankenhausinformationssysteme *
- Modellierung von KIS
- Referenzmodelle
- Aufgaben eines Krankenhauses
- Management von KIS (strategisch, taktisch, operativ)
11. Integration des Patienten *
- Stellung des Patienten
- Patientenkarten
- Patienteninformierung
12. Telematik im Gesundheitswesen *
- Telemedizin
- Teleausbildung
- Telematik für medizinische Forschung
- Telematik für das Gesundheitsmanagement
13. medizinische Lehr- und Lernsysteme
- Nutzergruppen
- Anforderungen
- Zugang
- Einsatzumgebung
14. Qualitätsmanagement *
- Beiträge zum QM (klinische Ökonomik, evidenzbasierte Medizin, Messung der Lebensqualität)
- Modelle
- Informatik und Qualitätsmanagement
- Informationsbereitstellung und Kommunikation
- Werkzeuge zur Datenerhebung
- nicht technische Voraussetzungen
15. Rechtliche Aspekte
- Medizinproduktegesetz (MPG)
- Risikomanagement
- Human Factors Engineering
Das Wirkungsgefüge der einzelnen Variablen untereinander wird in Abbildung 11 dargestellt.
Eine Einschränkung dieser Arbeit geht dahin, dass die fett dargestellten und mit einem * gekennzeichneten Variablen im weiteren Verlauf der Arbeit aus Sicht des strategischen Projektmanagements genauer analysiert werden. Für eine weiterführende Recherche der nicht behandelten Punkte sei beispielsweise auf [LeMe02] oder Shortliffe [Shor01] verwiesen.
Es wurde außerdem auf die Darstellung der Art der Einflussnahme (positiv oder negativ, wie sie im Beispielfall in Kapitel 4.3.2 aufgeführt ist) bewusst verzichtet. Ebenso wurden Einflüsse der Stakeholder untereinander nicht berücksichtigt.
Die Stakeholder und deren Einflüsse sind im Modell rot dargestellt. Variablen, die im Lauf der Arbeit noch analysiert werden sind in Gelb gehalten, nicht behandelte Variablen in Grün. Die Variablen sind im Modell rechts oben mit ihrer jeweiligen Nummer versehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Sensitivitätsmodell „IT - Projektmanagement im Gesundheitsbereich“ (eigene Darstellung)
Die Aktiv- und Passivsummen der einzelnen Variablen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Aktiv- und Passivsummen (eigene Darstellung)
P … Patient
S … Steuerzahler
R … Regulierende Eingriffe (Staat)
I … Industrie / Versicherungen
M … Mitarbeiter
Daraus lässt sich die grafische Einflussanalyse ableiten:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Grafische Einflussanalyse (eigene Darstellung)
Eine Analyse der Sensitivität des jeweiligen Bereiches erfolgt – wie bereits erwähnt – jeweils zusammenfassend im Anschluss an die Betrachtungen aus Sicht des Projektmanagements in den einzelnen Kapiteln.
6. Medizinische Informatik
Der Einsatz von Konzepten und Techniken der Informatik und Informationstechnologie hat in der Medizin eine große, kontinuierlich zunehmende Bedeutung. Medizinische Versorgung auf qualitativ hochwertigem Niveau ist heute ohne die systematische Informationserfassung, -aufbereitung und -verarbeitung nicht mehr möglich. Beispiele hierfür sind Verfahren der digitalen Bildverarbeitung, ohne die keine Magnetresonanztomographien eines Patienten angefertigt oder interpretiert werden könnten; oder Datenbanksysteme zur computergestützten Archivierung von Patientenakten, die heute in fast jedem Krankenhaus eingesetzt werden [KöMe02]. Um diesen vielfältigen Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten gerecht zu werden, hat sich in den 1970er Jahren die „medizinische Informatik“ als Fachdisziplin herausgebildet [Reic70]. Sie versammelt unter einem Dach das Wissen aller Disziplinen, die zur informationstechnologischen Unterstützung der Medizin beitragen. Heute ist sie in Forschung und Lehre etabliert, ihre Methoden und Werkzeuge haben Einzug in Krankenhäuser und Arztpraxen gehalten [Reic73].
Die Rahmenbedingungen und Anweisungen für Projekte bezieht die Medizininformatik vor allem aus Konzepten der Wirtschaftsinformatik, die strategische Leitlinien vorgibt und den Projektablauf mittels Vorgaben koordinieren soll.
6.1. Begriffsdefinitionen
6.1.1. Definition „medizinische Informatik“
Hans – Jürgen Seelos definiert „medizinische Informatik“ als die Wissenschaft von der Informationsverarbeitung und der Gestaltung informationsverarbeitender Systeme in der Medizin und im Gesundheitswesen [Seel97]. Sie verfolgt das Ziel, die Mediziner bei der Behandlung der Patienten zu unterstützen sowie Einrichtungen im Gesundheitswesen und diagnostische und therapeutische Geräte mit Methoden der Informationstechnologie
- zu analysieren,
- zu simulieren,
- zu entwickeln und
- zu betreiben.
In dieser Definition von Seelos werden der interdisziplinäre und der anwendungsorientierte Charakter dieses mittlerweile etablierten und eigenständigen Fachgebietes der Medizin bzw. Informatik deutlich.
6.1.2. Interdisziplinarität
Die medizinische Informatik umfasst die systematische Verarbeitung von Informationen in der Medizin durch die Modellierung von informationsverarbeitenden Systemen, wobei eigenständige Methoden aus den Fachdisziplinen
- der Informatik (z.B. Laufzeitoptimierung von Algorithmen zur Echtzeitanwendung)
- der Mathematik (z.B. Kryptographie zur Datenverschlüsselung)
- der Biometrie (z.B. Kaplan – Meier – Statistiken zur Analyse von Überlebenszeiten)
- der Ingenieurswissenschaften (z.B. Systementwicklung für einen Chirurgieroboter)
- der Naturwissenschaften (z.B. Strömungslehre zur Blutflussmessung)
- der Wirtschaftswissenschaften (z.B. Budgetierung der Krankenhausleitung)
- der Rechtswissenschaften (z.B. Mehrfachzeichnung von Arztbriefen) sowie
- der medizinischen Informatik selbst (z.B. Visualisierungstechniken zur Operationsplanung)
angewandt werden und die praktische Systemrealisierung wesentlich durch den Einsatz von Computern erfolgt.
6.1.3. Anwendungsorientierung
Durch die Anwendung formaler Methoden und Konzepte der Wirtschaftsinformatik und den Einsatz moderner Informations– und Kommunikationstechnologien unterstützt die medizinische Informatik
- Struktur
- Prozess
- Ergebnis und
- Präsentation
der Gesundheitsversorgung sowohl in theoretischen, vor allem aber auch in praktischen Aspekten.
Entsprechend breit gefächert sind die Anwendungsgebiete der modernen medizinischen Informatik, die von der Krankenhausverwaltung, der Patientenbetreuung und –pflege, der Diagnostik und Therapie, der Ausbildung von Ärzten und Pflegern bis hin zur Unterstützung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten reichen.
6.2. derzeitiger Stand der medizinischen Informatik
Hier soll kurz ein Einblick in verschiedene Bereiche der medizinischen Informatik gegeben werden, um die breite Fächerung dieses Gebietes aufzuzeigen. Die für das Thema dieser Arbeit relevanten Bereiche werden zu späteren Zeitpunkten ausführlicher behandelt, die anderen Punkte der Vollständigkeit erwähnt.
[...]
[1] Eine Definition des Begriffes erfolgt in Kapitel 4
[2] Der Autor weißt darauf hin, dass das entstandene Modell aufgrund des begrenzten Zeitrahmens des Workshops sicherlich noch diskussionswürdig sei.
[3] Siehe dazu etwa bei Dinkelbach [Dink69], der drei Arten von Sensitivitätsanalysen anführt und diese mithilfe mathematischer Lösungsmöglichkeiten durchführt
[4] Siehe beispielsweise bei [Trie90]
- Quote paper
- Hannes Moser (Author), 2003, Sensitivitätsanalyse des strategischen Projektmanagements im Gesundheitsbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204931