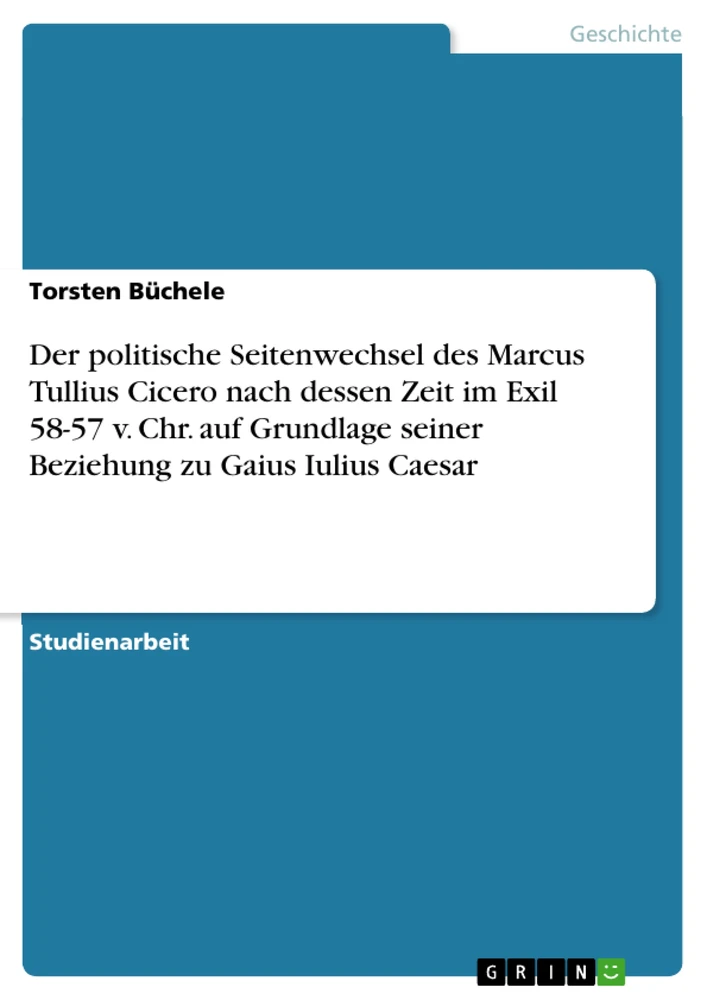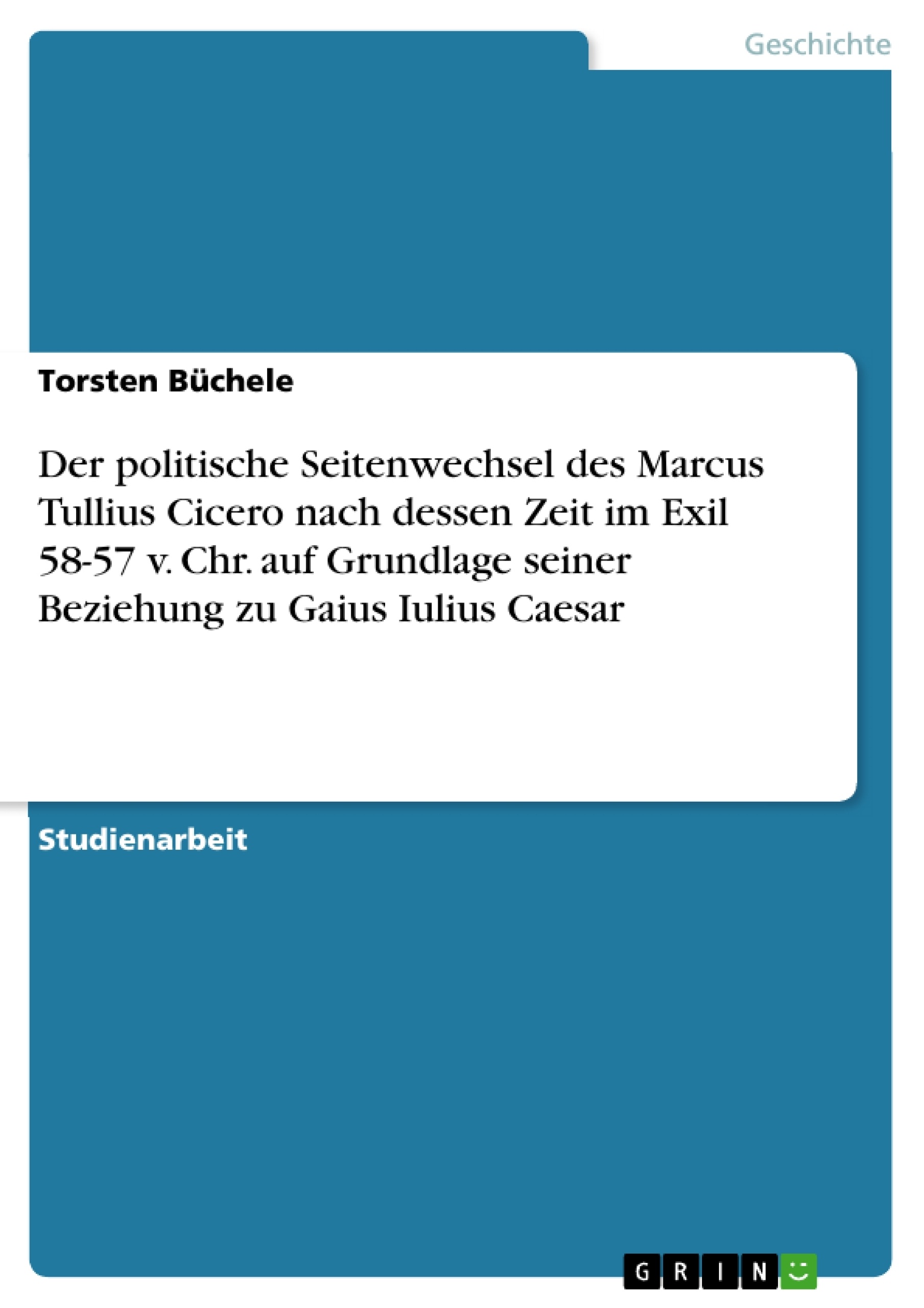Auszug aus der Einleitung
Kaum eine Person der römischen Antike ist heute bekannter als Gaius Iulius Caesar, kaum ein antiker Politiker besser erforscht. Während bei vielen seiner berühmten und bekannten Zeitgenossen, damals wie heute, ihre politischen Aktivitäten, ihre Reden und Schlachten im Mittelpunkt des Interesses standen, erfuhr und überlieferte man gerade von Caesar als Ausnahme auch viele Einzelheiten seines Privatlebens. Doch in manchen Dingen gibt Caesar auch heute noch Rätsel auf: Besonders seine Beziehung zum sechs Jahre älteren Marcus Tullius Cicero ist bis dato nicht zweifelsfrei geklärt. Gerade Ciceros Verhalten wirft Fragen auf: Vom Jugendfreund Caesars wandelte er sich augenscheinlich zu dessen politischem Feind - um während des Gallischen Kriegs wieder mit Caesar zu sympathisieren, im Bürgerkrieg sich auf Pompeius’ Seite zu schlagen, sich anschließend mit Caesars Gewaltherrschaft zu arrangieren und dessen Ermordung als herrliche Tat zu preisen! Wahrlich, auch Marcus Tullius Cicero gibt Rätsel auf. Mehrmals trieben ihn Stimmungsschwankungen einmal auf die populare, dann wieder auf die optimatische Seite. Was waren Ciceros Beweggründe für seine häufigen Politikwechsel? War es schlichtweg Opportunismus? Was hatte Ciceros politisch-philosophische Weltanschauung damit zu tun? Oder war es gar Caesars Charme, der Cicero immer wieder zweifeln ließ? Zusammengefasst möchte ich mich der Frage widmen: Was liegt Ciceros Stimmungsschwankungen und politischen Richtungswechseln in Bezug auf Caesar zugrunde? Mit dieser Frage möchte ich mich ganz speziell der wohl deutlichsten Wandlung Ciceros annehmen: Seiner Wandlung vom vormals überzeugten Optimaten zum Unterstützer des popular gesinnten Dreimännerbundes. Die politische Beziehung Cicero-Caesar soll, auch auf Grundlage der persönlichen Beziehung, zur Zeit des Gallischen Kriegs und der Herrschaft des Triumvirats, in Kapitel 3 gründlich durchleuchtet werden. In Zahlen ausgedrückt entspricht dies den Jahren 58-51 v. Chr: Aus Ciceros Sicht von der Flucht ins Exil bis zu seiner Abreise ins Prokonsulat nach Kilikien - aus Caesars Perspektive ungefähr vom Beginn bis zum Ende des Gallischen Krieges.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Verwirrende Verwandlungen – Eine Hinführung zur Beziehung Caesar-Cicero
- 2. Rückblickende Betrachtungen der Beziehung bis zum Jahr 58 v. Chr.
- 2.1 Rivalität in der frühen politischen Karriere
- 2.2 Cicero als Caesars Studiengenosse
- 3. Ciceros Einstellung zum herrschenden Dreibund in der Zeit des Gallischen Kriegs
- 3.1 Nachwirkungen des Exils
- 3.2 Die Wiederbelebung der alten Freundschaft
- 3.3 Caesars Reaktion auf Ciceros Schwierigkeiten in der Politik
- 3.4 Cicero als Caesars Handlanger: Unterwerfung oder Zusammenarbeit?
- 4. Ciceros Verhalten unter dem Triumvirat aus moderner Perspektive
- 5. Cicero: Opportunist oder Bewahrer der römischen Republik? – Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den politischen Seitenwechsel des Marcus Tullius Cicero nach seiner Zeit im Exil (58-57 v. Chr.), insbesondere seine veränderte Beziehung zu Gaius Julius Caesar. Der Fokus liegt auf der Analyse von Ciceros Motiven und der Entwicklung seiner politischen Positionierung im Kontext des gallischen Krieges und der Herrschaft des Triumvirats.
- Die Entwicklung der Beziehung zwischen Cicero und Caesar von der frühen Rivalität bis zur Zusammenarbeit.
- Die Analyse von Ciceros politischen Entscheidungen im Lichte seiner philosophisch-politischen Überzeugungen.
- Die Frage nach Opportunismus versus Prinzipientreue in Ciceros Handeln.
- Die Rolle des gallischen Krieges als Wendepunkt in der Beziehung Cicero-Caesar.
- Die Bewertung von Ciceros Verhalten unter dem Triumvirat.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Verwirrende Verwandlungen – Eine Hinführung zur Beziehung Caesar-Cicero: Dieses einführende Kapitel beleuchtet die komplexe und wechselhafte Beziehung zwischen Caesar und Cicero. Es hebt die Widersprüchlichkeit von Ciceros Verhalten hervor – vom Jugendfreund Caesars zum politischen Gegner und schließlich wieder zu einem, der sich mit Caesars Herrschaft arrangierte. Die Arbeit kündigt die detaillierte Untersuchung von Ciceros Wandel vom überzeugten Optimaten zum Unterstützer des Dreibunds an, wobei der Fokus auf die Zeit des Gallischen Krieges und der Herrschaft des Triumvirats gelegt wird. Die Einleitung betont die Bedeutung von Ciceros Briefen als Quellenmaterial und nennt die wichtigsten Biografen und Publizisten, deren Analysen in die Arbeit einfließen.
2. Rückblickende Betrachtungen der Beziehung bis zum Jahr 58 v. Chr.: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Beziehung zwischen Cicero und Caesar vor dem Exil Ciceros. Es beschreibt die anfängliche Rivalität in ihren frühen politischen Karrieren, die aus unterschiedlichen politischen Orientierungen resultierte: Cicero als Optimat, Caesar als Popular. Der Abschnitt hebt den politischen Kampf zwischen beiden in den 60er Jahren v. Chr. hervor, wobei Ciceros Konsulat im Jahr 63 und seine Opposition gegen Caesars populistische Politik im Vordergrund stehen. Trotz der anfänglichen Feindseligkeit deutet das Kapitel bereits auf die Nuancen der Beziehung hin und legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Entwicklungen.
3. Ciceros Einstellung zum herrschenden Dreibund in der Zeit des Gallischen Kriegs: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert Ciceros Verhalten während des gallischen Krieges und unter der Herrschaft des Triumvirats. Es untersucht die Nachwirkungen des Exils auf Ciceros politische Haltung und die sich entwickelnde Annäherung an Caesar. Die Kapitelteile beleuchten Ciceros Reaktionen auf Caesars Erfolge und die Herausforderungen, denen Cicero in der Politik begegnet, sowie die Frage nach dem Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen beiden. Die Analyse stützt sich auf Ciceros Korrespondenz, Reden und die Interpretationen von Cicero- und Caesar-Biografen.
4. Ciceros Verhalten unter dem Triumvirat aus moderner Perspektive: Dieses Kapitel bietet eine moderne Perspektive auf Ciceros Handeln unter dem Triumvirat. Es analysiert seine Entscheidungen und Motive vor dem Hintergrund der damaligen politischen Landschaft und unter Berücksichtigung des persönlichen Verhältnisses zu Caesar. Das Kapitel untersucht die komplexen Machtverhältnisse und die Herausforderungen, denen Cicero sich gegenübersah, um eine umfassende Bewertung seines Verhaltens zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Marcus Tullius Cicero, Gaius Iulius Caesar, Römische Republik, Optimaten, Popularen, Gallischer Krieg, Triumvirat, Exil, politische Beziehungen, Opportunismus, politische Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zu: Verwirrende Verwandlungen – Eine Hinführung zur Beziehung Caesar-Cicero
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die politische Beziehung zwischen Marcus Tullius Cicero und Gaius Julius Caesar, insbesondere Ciceros Wandel nach seinem Exil (58-57 v. Chr.) und seine Zusammenarbeit mit Caesar während des gallischen Krieges und der Herrschaft des Triumvirats. Der Fokus liegt auf Ciceros Motiven und der Entwicklung seiner politischen Positionierung.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Cicero und Caesar von deren frühen Karrieren bis zum Tod Ciceros, wobei der Schwerpunkt auf der Zeit nach Ciceros Exil (ab 57 v. Chr.) und der Periode des gallischen Krieges und des Triumvirats liegt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf Ciceros Briefen, Reden und den Interpretationen von Biografen und Publizisten, die sich mit Cicero und Caesar beschäftigt haben.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Beziehung zwischen Cicero und Caesar von der Rivalität zur Zusammenarbeit, analysiert Ciceros politische Entscheidungen im Kontext seiner philosophisch-politischen Überzeugungen, und befasst sich mit der Frage, ob Ciceros Handeln durch Opportunismus oder Prinzipientreue geprägt war. Die Rolle des gallischen Krieges als Wendepunkt und die Bewertung von Ciceros Verhalten unter dem Triumvirat werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Eine Einführung in die komplexe Beziehung zwischen Caesar und Cicero; 2. Ein Rückblick auf die Beziehung vor Ciceros Exil (bis 58 v. Chr.); 3. Ciceros Einstellung zum Triumvirat während des gallischen Krieges; 4. Eine moderne Perspektive auf Ciceros Verhalten unter dem Triumvirat; und 5. Ein Fazit, das Ciceros Handeln als Opportunismus oder Wahrung der Republik bewertet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Marcus Tullius Cicero, Gaius Iulius Caesar, Römische Republik, Optimaten, Popularen, Gallischer Krieg, Triumvirat, Exil, politische Beziehungen, Opportunismus, politische Philosophie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Ciceros politischen Seitenwechsel nach seinem Exil zu untersuchen und seine veränderte Beziehung zu Caesar zu analysieren. Sie möchte die Motive hinter Ciceros Entscheidungen beleuchten und seine politische Positionierung im Kontext der damaligen Ereignisse bewerten.
Welche Zusammenfassung der einzelnen Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über die behandelten Themen in jedem Kapitel. Kapitel 1 führt in die komplexe Beziehung ein, Kapitel 2 beleuchtet die frühen Phasen der Beziehung, Kapitel 3 analysiert Ciceros Verhalten während des gallischen Krieges, Kapitel 4 bietet eine moderne Perspektive auf sein Handeln unter dem Triumvirat, und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
- Quote paper
- Torsten Büchele (Author), 2011, Der politische Seitenwechsel des Marcus Tullius Cicero nach dessen Zeit im Exil 58-57 v. Chr. auf Grundlage seiner Beziehung zu Gaius Iulius Caesar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204755