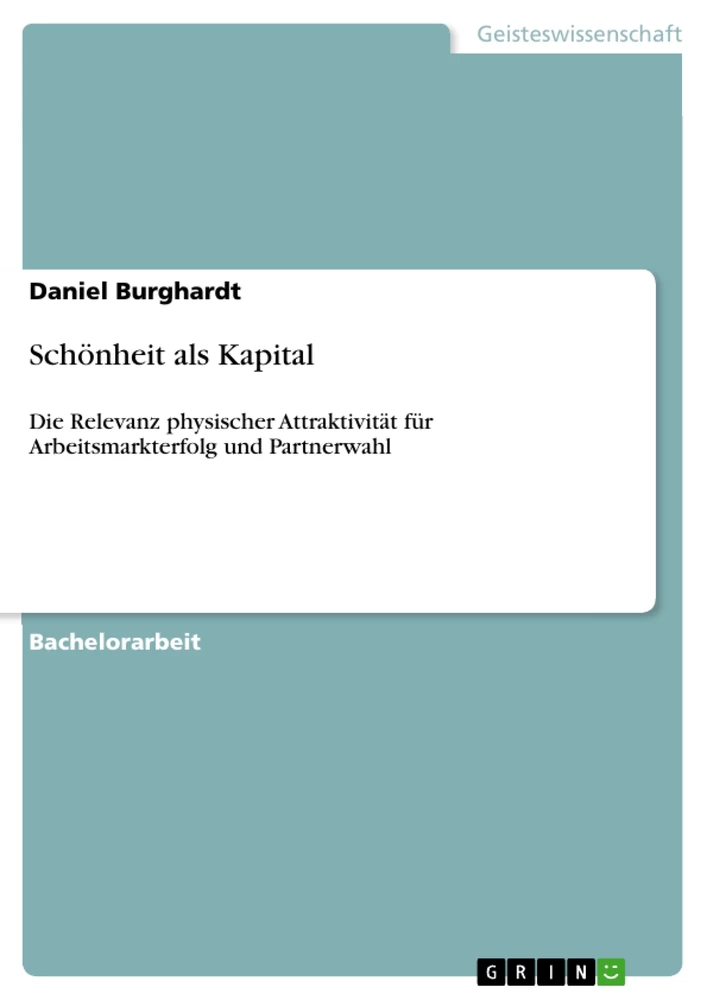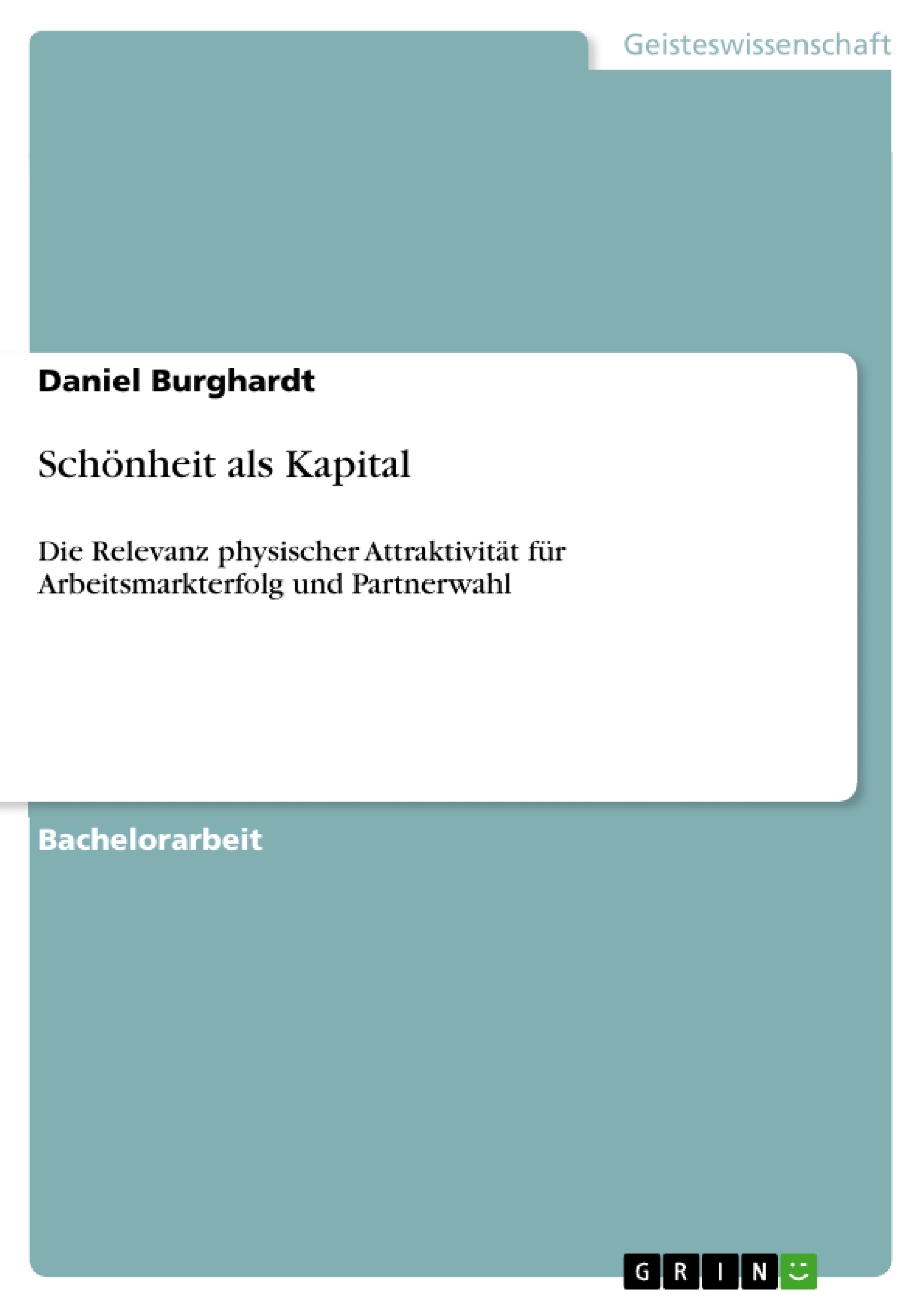Der Markt für Schönheitsindustrie wächst weltweit enorm an, wie man
anhand vieler Forschungsergebnissen sehen kann. Fitnesscenter erleben
seit einigen Jahren einen gewaltigen Aufschwung. Aktuell beläuft sich die
Mitgliederzahl der deutschen Fitnessclubs auf über sieben Millionen.
Davon trainieren laut einer Allensbach-Umfrage zur Häufigkeit des
Besuchs von Fitnessstudios über drei Millionen Mitglieder mehrmals
wöchentlich. 3,9 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die Fitness-
Branche 2010 in Deutschland (vgl. Statista 2012). Aber auch Kosmetikund
Pflegeprodukthersteller wie beispielsweise L‘Oreal verzeichnen immer
größere Gewinne (vgl. Handelsblatt 2012). Zusätzlich nahm die Anzahl
der Schönheits-OPs in den letzten Jahren auffällig zu (vgl. Viehöver 2011:
291). Allein im Jahr 2010 haben sich die Deutschen rund 117.000
Schönheitsoperationen sowie ca. 134.000 Faltenbehandlungen
unterzogen. Das teilte die Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie
Deutschland e.V. mit (vgl. GÄCD 2011). Dabei geben Schönheitschirurgen
an, dass sich ca. ein Drittel ihrer Patienten durch die Operationen bessere
Chancen in Beruf und Karriere erhoffen (vgl. Nienhaus/Hergert 2008).
Dieses Phänomen zeigt sich nicht allein bei Frauen, sondern auch immer
häufiger bei Männern (vgl. Degele 2007: 29). Letztere investieren vor
allem in den westlichen Industriestaaten immer mehr Zeit in ihre äußere
Erscheinung (vgl. Hakim 2011: 45). Infolgedessen zerbricht das bisherige
Klischee, Schönheit sei „Frauensache“. Es zeigt sich somit, dass es einen
Trend des „Sich-Schön-Machens“ gibt, der sich geschlechterunabhängig
in der Gesellschaft etabliert. Ökonomisches Kapital wird folglich immer
mehr versucht in körperliches Kapital zu transformieren. Woher kommt
aber dieser Trend bzw. wird er durch einen sichtbaren Erfolg in
verschiedenen Lebenssituationen verstärkt oder gar ausgelöst? Ergibt
sich durch körperliche Schönheit ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt oder bei
der Partnersuche? Um hierauf eine Antwort zu finden, stellt sich die Frage
welchen Stellenwert physische Attraktivität beim Arbeitsmarkterfolg und
der Partnerwahl einnimmt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Physische Attraktivität
- Physische Attraktivität bei Frauen
- Gesichtsmerkmale
- Körpermerkmale
- Physische Attraktivität bei Männern
- Gesichtsmerkmale
- Körpermerkmale
- Interpersonelle Konsequenzen durch Schönheit
- Haloeffekt
- Physische Attraktivität bei Frauen
- Bourdieus Kapitalformtheorie
- Körperliches Kapital
- Relevanz physischer Attraktivität
- Relevanz auf dem Arbeitsmarkt
- Einkommen
- Aufstiegschancen
- Bewerbung
- Relevanz bei der Partnerwahl
- Relevanz auf dem Arbeitsmarkt
- Schönheit als Kapital
- Fazit
- Ausblick
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Relevanz physischer Attraktivität für den Arbeitsmarkterfolg und die Partnerwahl anhand empirischer Daten aus nationalen sowie internationalen Studien zu untersuchen. Dabei wird Bourdieus Kapitalformmodell auf die Kapitalform „Schönheit" erweitert, um die Relevanz physischer Attraktivität in einem Vergleich der Kapitalformen zu ermöglichen.
- Die Relevanz physischer Attraktivität für den Arbeitsmarkterfolg, insbesondere in Bezug auf Einkommen, Aufstiegschancen und Bewerbungen.
- Die Bedeutung von physischer Attraktivität bei der Partnerwahl, unter Berücksichtigung der Dauer der Beziehung.
- Die Einordnung von Schönheit als Kapitalform im Kontext von Bourdieus Kapitalformtheorie.
- Die gesellschaftlichen Auswirkungen von Schönheit und der Trend des „Sich-Schön-Machens".
- Die Zukunft des Stellenwerts von Schönheit in der Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit definiert den sozialpsychologischen Begriff der „physischen Attraktivität" und beleuchtet die Merkmale, die Männer und Frauen als attraktiv empfinden. Dabei wird die Bedeutung von Gesichts- und Körpermerkmalen für die Attraktivitätsbewertung erläutert. Darüber hinaus werden die interpersonellen Konsequenzen von Schönheit, insbesondere der „Haloeffekt", untersucht, der zu positiven Eindrucksverzerrungen bei attraktiven Menschen führt.
Im zweiten Kapitel wird Bourdieus Kapitalformtheorie vorgestellt, wobei der Fokus auf dem „körperlichen Kapital" liegt. Es wird aufgezeigt, wie Bourdieu körperliches Kapital definiert und wie es zur Positionierung im sozialen Raum beiträgt. Die Bedeutung von Schönheit im Kontext von Bourdieus Kapitalformtheorie wird diskutiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der empirischen Forschung zur Relevanz physischer Attraktivität in zwei verschiedenen Lebenssituationen: dem Arbeitsmarkt und der Partnerwahl. Es werden verschiedene Studien analysiert, die die Auswirkungen physischer Attraktivität auf das Einkommen, die Aufstiegschancen und die Bewerbungssituation untersuchen. Darüber hinaus werden Studien zur Partnerwahlpräferenz und den Einfluss von Schönheit auf die Dauer der Beziehung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen physische Attraktivität, Schönheit, Arbeitsmarkterfolg, Partnerwahl, Bourdieus Kapitalformtheorie, körperliches Kapital, Haloeffekt, Schönheitshandeln, Geschlechterunterschiede, soziale Ungleichheit und die Zukunft des Stellenwerts von Schönheit.
- Quote paper
- Daniel Burghardt (Author), 2012, Schönheit als Kapital, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204512