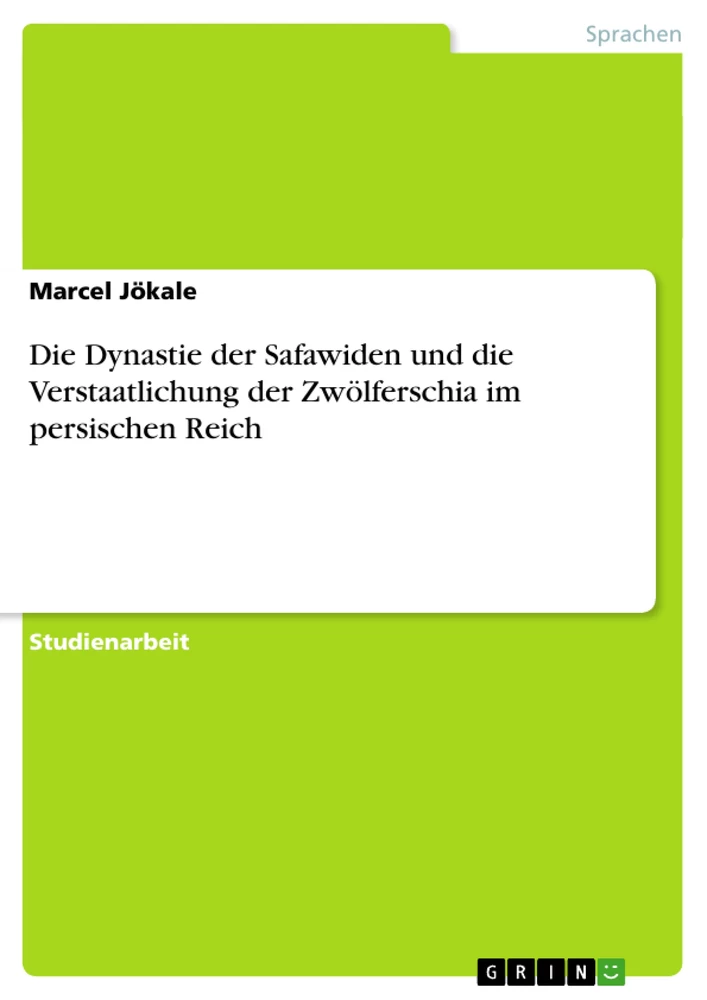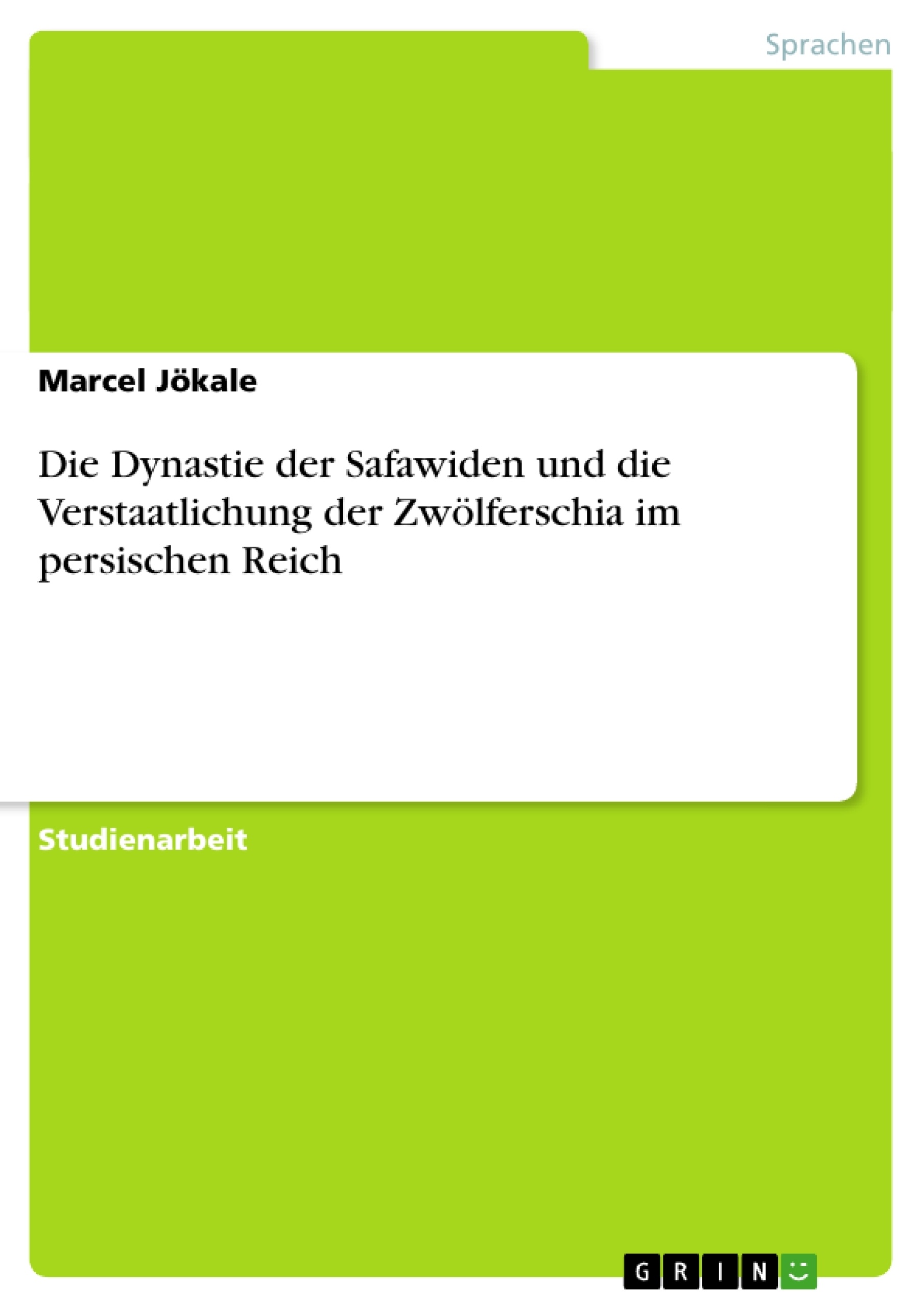Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung......................................................S.3
2.Die Zeit vor den Safawiden......................................S.4
2.1. Lage der Schia im islamischen Raum...........................S.4
3. Die Etablierung der Dynastie...................................S.5
3.1 Aufstieg unter Ismāʾïl.......................................S.5
4. Die Verstaatlichung der Zwölferschia...........................S.7
4.1 Der Schah als Vertreter des verborgenen Imams.................S.8
4.2 Bekenntnis der politischen Elite und
Verstaatlichung als Top-down Prozess.............................S.11
4.3 Herausbildung und Festigung eines schiitischen Klerus.......S.13
4.3.1 Der Ṣadr als zentrale Institution..........................S.14
4.4 Wirkung der Verstaatlichung auf die schiitischen Lehren......S.16
4.4.1 Renaissance schiitischer theologischer Literatur...........S.19
4.4.2 Philosophie der Isfahaner Schule..........................S.20
4.5 Mehrdimensionalität safawidischer Herrschaft.................S.22
5. Entwicklung der Ulama im safawidischen Staat bis 1722.........S.22
5.1 Politischer und wirtschaftlicher Einfluss der Geistlichkeit –
Der Klerus als eigener Machtfaktor......................................................S.22
5.2 Dualismus religiöser Herrschaft: Der Schah und die Mudschtahids.....................................................S.24
Fazit............................................................S.25
Literaturverzeichnis.............................................S.27
Eigenständigkeitserklärung.......................................S.28
1. Einleitung
Der heutige Iran ist bekannt dafür, der einzige gegenwärtige Staat zu sein, der zur gleichen Zeit sowohl den zwölferschiitischen Islam als Staatsreligion vertritt als auch von der Geistlichkeit des selben regiert wird. Dieses Phänomen ist in der Geschichte der Schia in diesem Ausmaß einzigartig. Es gab zwar bereits in der Vergangenheit Potentaten, die sich als schiitische Dynastien verstanden wie zum Beispiel die Bujiden (932–1062 im westlichen Iran und Irak), aber das Ausmaß in dem die Geistlichkeit hier konkrete Macht ausübt bleibt beispiellos.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zeit vor den Safawiden
- Lage der Schia im islamischen Raum
- Die Etablierung der Dynastie
- Aufstieg unter Ismā'ïl
- Die Verstaatlichung der Zwölferschia
- Der Schah als Vertreter des verborgenen Imams
- Bekenntnis der politischen Elite und Verstaatlichung als Top-down Prozess
- Herausbildung und Festigung eines schiitischen Klerus
- Der Şadr als zentrale Institution
- Wirkung der Verstaatlichung auf die schiitischen Lehren
- Renaissance schiitischer theologischer Literatur
- Philosophie der Isfahaner Schule
- Mehrdimensionalität safawidischer Herrschaft
- Entwicklung der Ulama im safawidischen Staat bis 1722
- Politischer und wirtschaftlicher Einfluss der Geistlichkeit - Der Klerus als eigener Machtfaktor
- Dualismus religiöser Herrschaft: Der Schah und die Mudschtahids
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verstaatlichung der Zwölferschia im persischen Reich unter der Dynastie der Safawiden. Sie untersucht, wie die Machtübernahme der Safawiden im 16. Jahrhundert die Entwicklung der schiitischen Gelehrsamkeit und die schiitische Orthodoxie selbst beeinflusste.
- Die politische und religiöse Lage in Zentralasien vor den Safawiden.
- Der Aufstieg der Safawiden-Dynastie und ihre Politik zur Verbreitung der Schia.
- Die Herausbildung und der wachsende Einfluss der schiitischen Geistlichkeit im safawidischen Staat.
- Die Folgen der Verstaatlichung der Religion für das theologische Legitimationsgerüst der Monarchie.
- Die Auswirkungen der staatlichen Förderung der Geistlichkeit auf die Glaubensvorstellungen im Safawidenreich.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung der Verstaatlichung der Zwölferschia im Iran und deren Einzigartigkeit in der Geschichte der Schia. Sie führt den Leser in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen der Verstaatlichung auf die schiitische Gelehrsamkeit und die schiitische Orthodoxie. Anschließend betrachtet das zweite Kapitel die Situation der Schia im islamischen Raum vor dem Aufstieg der Safawiden, wobei besonderes Augenmerk auf den „volkstümlichen Islam“ in Zentralasien gelegt wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Etablierung der Safawiden-Dynastie unter Schah Ismā'ïl und analysiert den Prozess der Verbreitung der Schia in der mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung. Der Schwerpunkt des vierten Kapitels liegt auf der Verstaatlichung der Zwölferschia und den Folgen für den schiitischen Klerus sowie die schiitischen Lehren. Es wird die Rolle des Schahs als Vertreter des verborgenen Imams sowie die Entwicklung des Şadr als zentrale Institution untersucht. Darüber hinaus wird der Einfluss der Verstaatlichung auf die schiitische Theologie, insbesondere die Renaissance der schiitischen Literatur und die Philosophie der Isfahaner Schule, beleuchtet. Schließlich beleuchtet das fünfte Kapitel die Entwicklung der Ulama im safawidischen Staat bis 1722, wobei der politische und wirtschaftliche Einfluss der Geistlichkeit sowie der Dualismus zwischen dem Schah und den Mudschtahids untersucht werden.
Schlüsselwörter
Safawiden, Zwölferschia, Iran, Verstaatlichung der Religion, schiitische Gelehrsamkeit, schiitische Orthodoxie, Klerus, Şadr, Isfahaner Schule, Mudschtahids.
- Arbeit zitieren
- Marcel Jökale (Autor:in), 2011, Die Dynastie der Safawiden und die Verstaatlichung der Zwölferschia im persischen Reich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204457