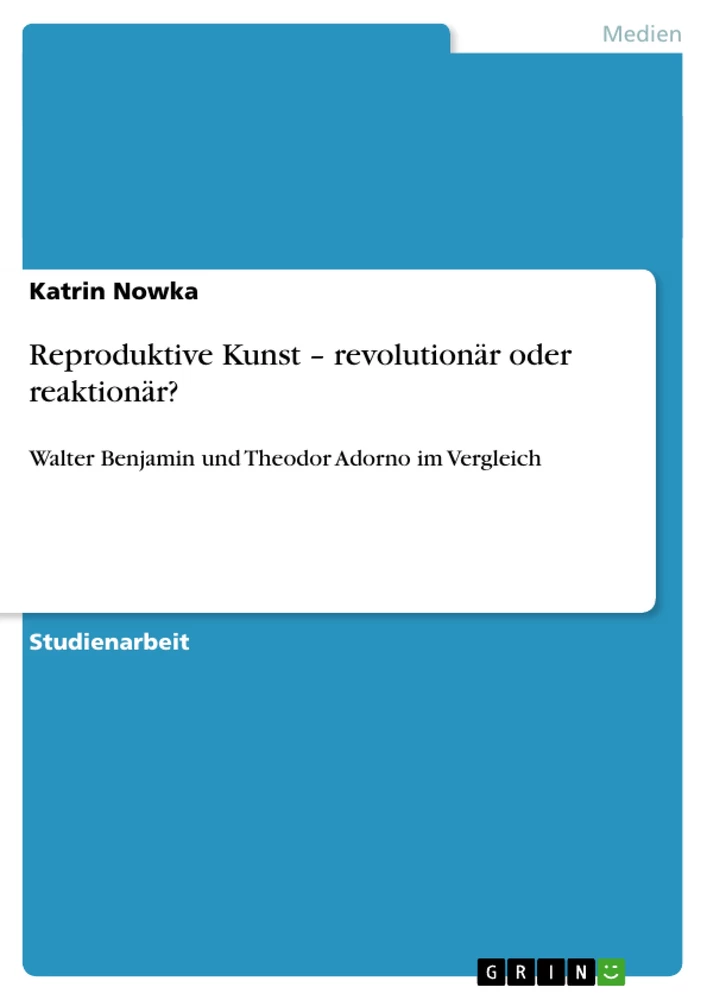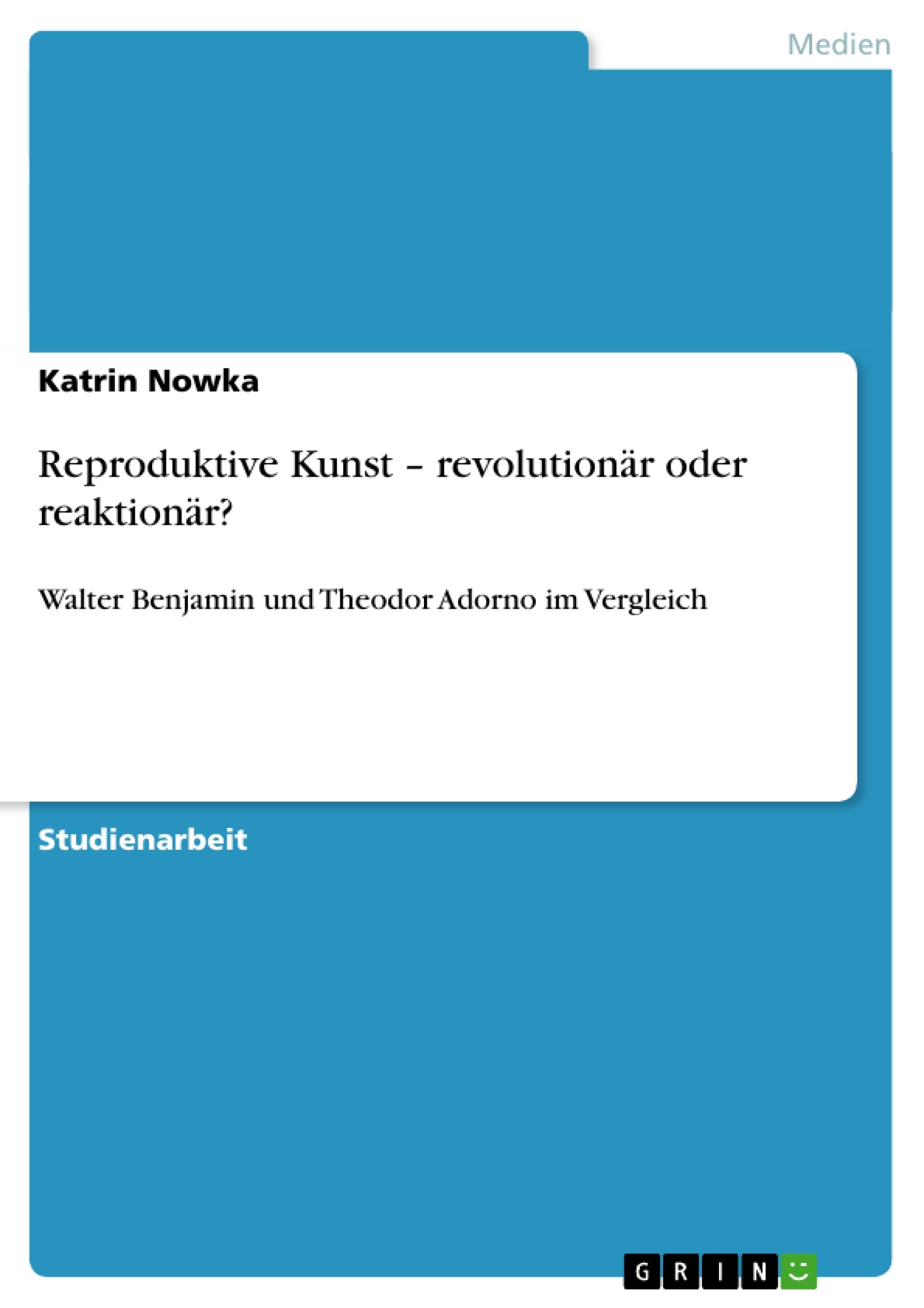In vorliegender Arbeit wird Benjamins Argumentation nachvollzogen und einer kritischen Untersuchung unterzogen. Dafür soll im Besonderen Adornos Gegenthese herangezogen werden. Dazu wird zuerst Benjamins Begriff der Aura aufgegriffen und hinterfragt. Danach steht der von Benjamin proklamierte Umbruch der Kunstwahrnehmung als Zeitgeist-Phänomen im Fokus der Untersuchung, weg von der Kontemplation, hin zur Zerstreuung. Dies führt im nächsten Schritt zum Kino, da Benjamin im Film das optimale Medium für diese neue Form der Kunstwahrnehmung sieht, und ihm revolutionäre Kraft zuspricht. Benjamin erkennt allerdings, dass die technisch reproduzierbaren Medien auch für faschistische Propaganda genutzt werden kann. Wie dem entgegenzutreten sei, wird im letzten Abschnitt über Benjamin geklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Walter Benjamin – „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“
- Der Begriff der „Aura“ und neue Wahrnehmungsformen
- Vom Kultwert zum Ausstellungswert
- Die neue Form der Kunstwahrnehmung – Zerstreuung im Film
- Ästhetisierung der Politik
- Musiksoziologie Adornos - Kritik an der Massenkultur
- Kritische Typologie
- Gesellschaftliche Funktion von Musik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gegensätzlichen Positionen von Walter Benjamin und Theodor Adorno zur technisch reproduzierbaren Kunst. Ziel ist es, Benjamins Argumentation im „Kunstwerk-Aufsatz“ nachzuvollziehen und im Vergleich mit Adornos Musiksoziologie kritisch zu beleuchten. Dabei werden die unterschiedlichen Auffassungen zur Bedeutung der „Aura“, zur Veränderung der Kunstwahrnehmung und zum Einfluss der Medien auf die Gesellschaft analysiert.
- Benjamins Konzept der Aura und ihr Verlust durch technische Reproduktion
- Der Wandel der Kunstwahrnehmung von Kontemplation zur Zerstreuung
- Die Rolle des Films als Medium der technischen Reproduktion bei Benjamin
- Adornos Kritik an der Massenkultur und der reproduzierten Kunst
- Vergleich der Positionen Benjamins und Adornos hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen technischer Reproduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden zentralen Figuren, Walter Benjamin und Theodor Adorno, sowie ihre Positionen zur technisch reproduzierbaren Kunst vor. Sie skizziert den Kontext der Frankfurter Schule und die Kritische Theorie, in die Benjamins „Kunstwerk-Aufsatz“ eingebettet ist. Die Arbeit kündigt die Analyse von Benjamins Argumentation und deren Gegenüberstellung mit Adornos Kritik an. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Denker und deren divergierenden Ansichten über die Auswirkungen der technischen Reproduzierbarkeit auf Kunst und Gesellschaft. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit einer vergleichenden Betrachtung, um die Komplexität des Themas zu erfassen.
Walter Benjamin – „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“: Dieses Kapitel analysiert Benjamins berühmten Aufsatz. Es behandelt die Entwicklung der Kunst im Kontext der technischen Reproduktion, wobei Benjamin den Verlust der Aura als positiven Aspekt für neue Formen der Kunstwahrnehmung interpretiert. Der Wandel von der Kontemplation zur Zerstreuung wird als revolutionäres Potential dargestellt, obwohl Benjamin die Gefahr der faschistischen Propaganda durch diese Medien anerkennt. Der Aufsatz wird im Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus betrachtet, der Benjamins Denken beeinflusst hat. Das Kapitel untersucht detailliert Benjamins Begriff der Aura und seine Auffassung vom Film als Medium der Reproduktion schlechthin.
Musiksoziologie Adornos - Kritik an der Massenkultur: Im Gegensatz zu Benjamin kritisiert Adorno die reproduzierte Kunst der Massenkultur scharf und sieht sie als bloße Konsumgüter der Kulturindustrie, die mit kapitalistischen Zielen verbunden sind. Dieser Abschnitt beleuchtet Adornos Musiksoziologie und seine Analyse der gesellschaftlichen Funktion von Musik im Kontext der Massenkultur. Der Schwerpunkt liegt auf der Gegenüberstellung von Adornos pessimistischer Sicht auf die technischen Reproduktionsmittel gegenüber Benjamins eher optimistischer Einschätzung. Der Vergleich der beiden Positionen hebt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Auswirkungen der Medien auf die Gesellschaft hervor.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Theodor Adorno, Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Technische Reproduzierbarkeit, Aura, Kunstwerk, Film, Fotografie, Massenkultur, Kulturindustrie, Kontemplation, Zerstreuung, Ästhetisierung, Politik, Musiksoziologie.
FAQ: Analyse der Positionen Benjamins und Adornos zur Technisch Reproduzierbaren Kunst
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert und vergleicht die gegensätzlichen Positionen von Walter Benjamin und Theodor Adorno zur technisch reproduzierbaren Kunst. Im Mittelpunkt steht der Vergleich ihrer Argumentationen und der Einfluss der technischen Reproduktion auf Kunst und Gesellschaft.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Hauptquellen sind Walter Benjamins Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und Theodor Adornos Musiksoziologie, insbesondere seine Kritik an der Massenkultur.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Benjamins Konzept der Aura und ihr Verlust durch technische Reproduktion, der Wandel der Kunstwahrnehmung von Kontemplation zur Zerstreuung, die Rolle des Films als Medium der technischen Reproduktion bei Benjamin, Adornos Kritik an der Massenkultur und der reproduzierten Kunst, sowie ein Vergleich der gesellschaftlichen Auswirkungen technischer Reproduktion nach Benjamin und Adorno.
Was ist Benjamins zentrale These im „Kunstwerk-Aufsatz“?
Benjamin sieht den Verlust der Aura durch technische Reproduktion nicht nur als negativ, sondern auch als potentiell positiv an. Er argumentiert, dass die Reproduzierbarkeit neue Formen der Kunstwahrnehmung ermöglicht und ein revolutionäres Potential birgt, auch wenn er die Gefahr faschistischer Propaganda durch diese Medien anerkennt.
Wie bewertet Adorno die technisch reproduzierte Kunst?
Im Gegensatz zu Benjamin kritisiert Adorno die reproduzierte Kunst der Massenkultur scharf. Er betrachtet sie als bloße Konsumgüter der Kulturindustrie, die mit kapitalistischen Zielen verbunden sind und die Autonomie der Kunst untergraben.
Wie wird der Film in der Analyse berücksichtigt?
Benjamin betrachtet den Film als das Medium der technischen Reproduktion schlechthin und analysiert seine Auswirkungen auf die Kunstwahrnehmung und die Gesellschaft. Adorno würde den Film wohl als Teil der von ihm kritisierten Kulturindustrie einordnen.
Welchen Stellenwert hat die Frankfurter Schule in dieser Arbeit?
Die Arbeit verortet Benjamins „Kunstwerk-Aufsatz“ im Kontext der Frankfurter Schule und der Kritischen Theorie, um die theoretischen Grundlagen seiner Argumentation zu beleuchten. Adorno war selbst ein wichtiger Vertreter der Frankfurter Schule.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Benjamins „Kunstwerk-Aufsatz“, ein Kapitel zu Adornos Musiksoziologie und ein Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Argumentationen beider Denker und vergleicht ihre Positionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Frankfurter Schule, Kritische Theorie, Technische Reproduzierbarkeit, Aura, Kunstwerk, Film, Fotografie, Massenkultur, Kulturindustrie, Kontemplation, Zerstreuung, Ästhetisierung, Politik, Musiksoziologie.
- Quote paper
- Katrin Nowka (Author), 2011, Reproduktive Kunst – revolutionär oder reaktionär?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204392