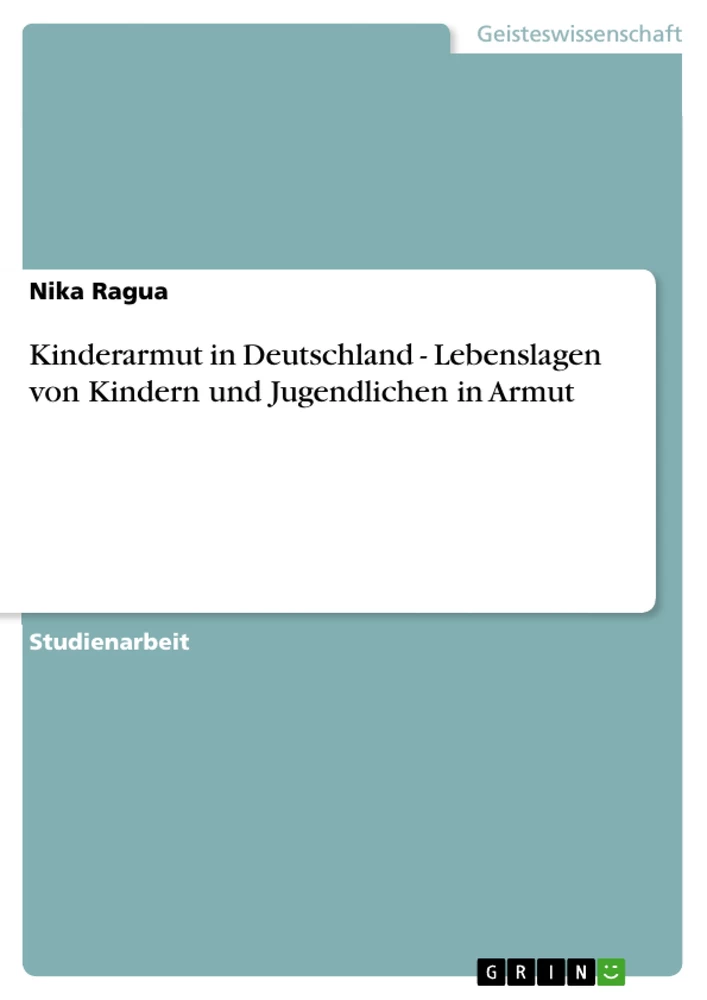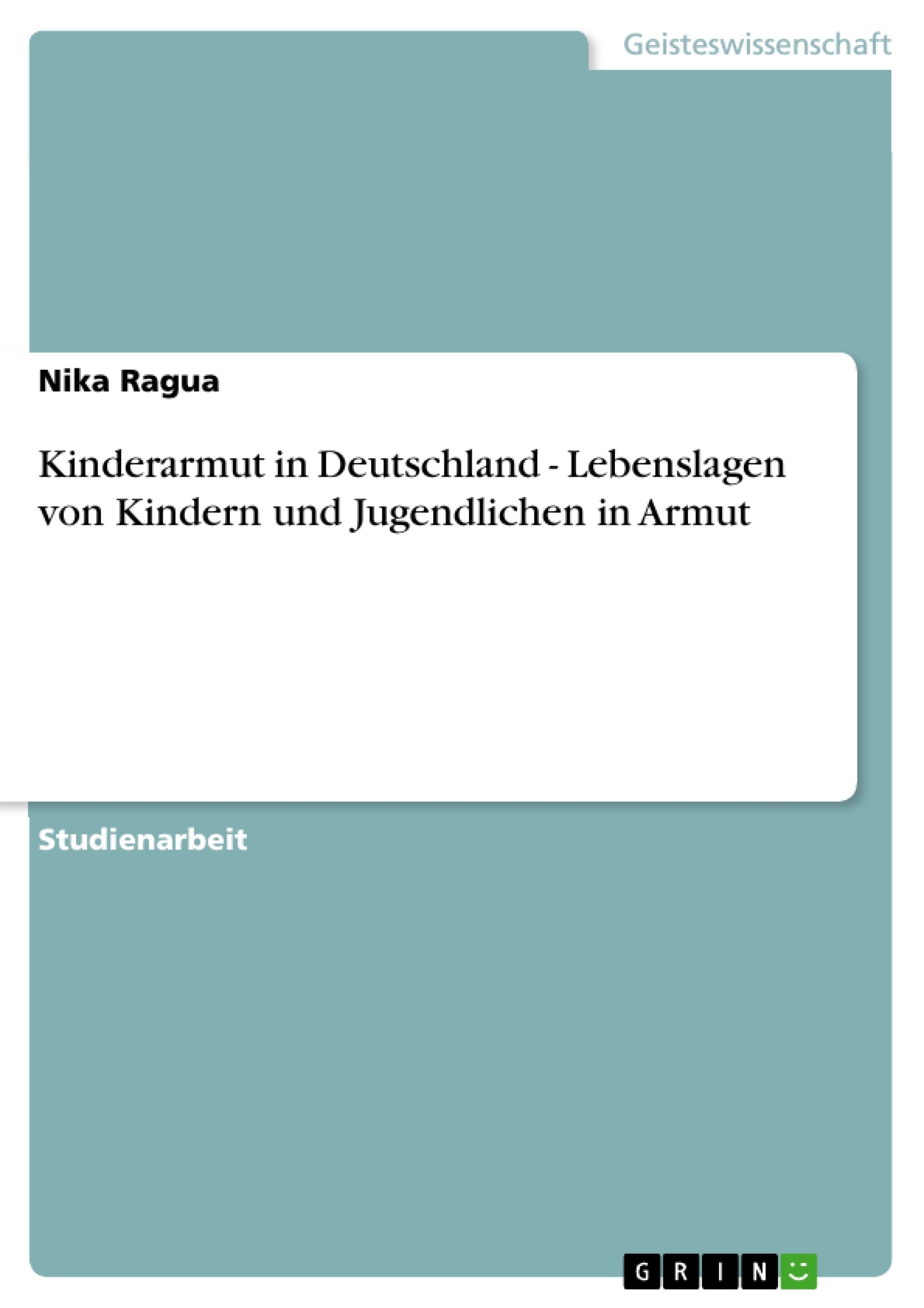Der Mythos, dass es Kinderarmut in Deutschland nicht geben könne, hielt sich bis in die neunziger Jahre und selbst für die Politik und Wissenschaft war die Armut in Deutschland ein eher vernachlässigter Themenbereich, obwohl bereits im Jahre 1976 Heiner Geißler mit der Veröffentlichung seines Buches „Die neue soziale Frage“ auf eine wachsende Armutstendenz hinwies. Es folgten eine Reihe von Armuts- und Sozialberichtserstattungen diverser Wohlfahrtsverbände, Kirchen u.a., die mit zunehmender Intensität auf das Thema hinwiesen. Seitdem Richard Hauser die „Infantilisierung der Armut“ im Jahre 1989 als neuen Armutstrend in Deutschland identifizierte, haben zahlreiche darauf folgende Untersuchungen eine spezifische Kinder- und Jugendarmut bestätigen können. So wurde u.a. im 10. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung Armut 1998 erstmals im Blickfeld des politischen Interessen breit analysiert. Mit dem Erscheinen des ersten Armuts- und Reichtumsbericht 2001 wurde die Diskussion über Armut und Reichtum publik gemacht und somit offiziell in das politische und gesellschaftliche Interesse gerückt. Neusten Statistiken zufolge sind Minderjährige die am meisten von Armut betroffene Gruppe. Zwar muss konstatiert werden, dass die Existenzgrundlagen der meisten Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien als gesichert gilt. Doch herrscht eine tiefe soziale Spaltung in der BRD, die sich auf die Lebenslagen der Kinder verschärfend auswirkt.
In dieser Hausarbeit sollen die Lebenslagen der Kinder aus ärmlichen Verhältnissen erläutert werden. So werden im Folgenden zunächst unterschiedliche Armutskonzepte dargestellt um dann auf die Ursachen und Ausmaße der Armut von Kindern und Jugendlichen einzugehen (Punkt 3.). Kinderarmut bedeutet jedoch vielmehr als ein Mangel an materiellen Ressourcen. Denn sie manifestiert sich in verschiedenen Lebensbereichen und führt zu vielfältigen Benachteiligungen, etwa im Bildungs-, Gesundheits-, Freizeit- und Wohnbereich, wie sie unter Punkt 4. näher erläutert werden. Abschließend werden im Fazit mögliche Konsequenzen und Handlungsansätze angedacht werden, die die Kinder- und Jugendarmut in Deutschland verringern könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Armutskonzepte
- 2.1 Absolute und relative Armut
- 2.2 Ressourcenansatz
- 2.3 Lebenslagenansatz
- 2.4 Ein kindbezogenes Armutskonzept
- 3. Infantilisierung der Armut
- 3.1 Ursachen der Armut von Kindern und Jugendlichen
- 3.2 Ausmaß der Armut von Kindern und Jugendlichen
- 4. Mögliche negative Auswirkungen von Armut auf Minderjährige
- 4.1 Auswirkungen auf das soziale Umfeld und die materielle Lage des Kindes
- 4.2 Auswirkungen auf die Eltern-Kind Beziehung
- 4.3 Gesundheit und Psyche
- 4.4 Bildung
- 4.5 Teufelskreis Armut?
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in Armut in Deutschland. Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Armutskonzepte zu erläutern, die Ursachen und das Ausmaß von Kinderarmut zu beleuchten und die möglichen negativen Auswirkungen auf die betroffenen Minderjährigen zu analysieren.
- Definition und Konzepte von Armut
- Ursachen von Kinderarmut in Deutschland
- Ausmaß und Verbreitung von Kinderarmut
- Auswirkungen von Armut auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Möglichkeiten der Armutsbekämpfung und -prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Mythos der Nicht-Existenz von Kinderarmut in Deutschland in den 90er Jahren dar und skizziert die Entwicklung des Bewusstseins für das Thema. Sie hebt die zunehmende Intensität der Diskussion seit den Arbeiten von Heiner Geißler und Richard Hauser hervor und führt in die Thematik der Hausarbeit ein, die sich mit den Lebenslagen armer Kinder auseinandersetzt und verschiedene Armutskonzepte, Ursachen, Ausmaße und Folgen beleuchtet.
2. Armutskonzepte: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ansätze zur Definition von Armut. Es unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut, erläutert den Ressourcenansatz (basierend auf Einkommensniveau) und den Lebenslagenansatz (betrachtet multidimensionale Unterversorgung). Schließlich wird ein kindbezogenes Armutskonzept vorgestellt, das Ressourcen und Lebenslagen kombiniert und die spezifischen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt.
3. Infantilisierung der Armut: Dieses Kapitel beleuchtet den Trend der „Infantilisierung der Armut“, der die zunehmende Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen von Armut beschreibt. Es analysiert die Ursachen dieser Entwicklung, wie beispielsweise die Arbeitslosigkeit der Eltern, Alleinerziehende und Probleme von Migrantenfamilien. Die Statistiken zeigen, dass Minderjährige die am stärksten von Armut betroffene Gruppe sind, obwohl die Existenzgrundlagen der meisten Kinder und Jugendlichen gesichert sind, besteht eine tiefe soziale Spaltung.
4. Mögliche negative Auswirkungen von Armut auf Minderjährige: Dieses Kapitel untersucht detailliert die negativen Folgen von Armut auf Kinder und Jugendliche. Es werden die Auswirkungen auf das soziale Umfeld (eingeschränkte Teilhabe, Isolation), die Eltern-Kind-Beziehung (Konflikte, Misshandlungen), die Gesundheit (physische und psychische Beeinträchtigungen) und die Bildung (eingeschränkte Bildungschancen, Schulversagen) ausführlich dargestellt. Der Teufelskreis der Armut wird ebenfalls diskutiert, der die intergenerationelle Weitergabe von Armut und Benachteiligung beschreibt.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Armutskonzepte, Lebenslagenansatz, Ressourcenansatz, Infantilisierung der Armut, Ursachen von Kinderarmut, Auswirkungen von Armut auf Kinder, Bildung, Gesundheit, soziale Ungleichheit, Deutschland, Sozialpolitik, Armutsbekämpfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kinderarmut in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in Armut in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Armutskonzepte, die Ursachen und das Ausmaß von Kinderarmut und analysiert die möglichen negativen Auswirkungen auf betroffene Minderjährige.
Welche Armutskonzepte werden behandelt?
Die Arbeit erläutert verschiedene Armutskonzepte, darunter absolute und relative Armut, den Ressourcenansatz (basierend auf Einkommensniveau) und den Lebenslagenansatz (betrachtet multidimensionale Unterversorgung). Ein besonderes Augenmerk liegt auf einem kindbezogenen Armutskonzept, das Ressourcen und Lebenslagen kombiniert und die spezifischen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt.
Welche Ursachen für Kinderarmut werden untersucht?
Die Hausarbeit analysiert verschiedene Ursachen von Kinderarmut in Deutschland, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit der Eltern, Alleinerziehende und Probleme von Migrantenfamilien. Sie beleuchtet den Trend der „Infantilisierung der Armut“, also die zunehmende Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen.
Wie wird das Ausmaß der Kinderarmut dargestellt?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zum Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland. Obwohl die Existenzgrundlagen der meisten Kinder und Jugendlichen gesichert sind, wird die tiefe soziale Spaltung und die Tatsache, dass Minderjährige die am stärksten von Armut betroffene Gruppe sind, hervorgehoben.
Welche negativen Auswirkungen von Armut auf Kinder und Jugendliche werden beschrieben?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert die negativen Folgen von Armut auf Kinder und Jugendliche. Dies umfasst Auswirkungen auf das soziale Umfeld (eingeschränkte Teilhabe, Isolation), die Eltern-Kind-Beziehung (Konflikte, Misshandlungen), die Gesundheit (physische und psychische Beeinträchtigungen) und die Bildung (eingeschränkte Bildungschancen, Schulversagen). Der Teufelskreis der Armut und die intergenerationelle Weitergabe von Armut und Benachteiligung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Armutskonzepte, Infantilisierung der Armut, Mögliche negative Auswirkungen von Armut auf Minderjährige und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlich beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderarmut, Armutskonzepte, Lebenslagenansatz, Ressourcenansatz, Infantilisierung der Armut, Ursachen von Kinderarmut, Auswirkungen von Armut auf Kinder, Bildung, Gesundheit, soziale Ungleichheit, Deutschland, Sozialpolitik, Armutsbekämpfung.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Armutskonzepte zu erläutern, die Ursachen und das Ausmaß von Kinderarmut zu beleuchten und die möglichen negativen Auswirkungen auf die betroffenen Minderjährigen zu analysieren.
- Quote paper
- Nika Ragua (Author), 2006, Kinderarmut in Deutschland - Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen in Armut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204271