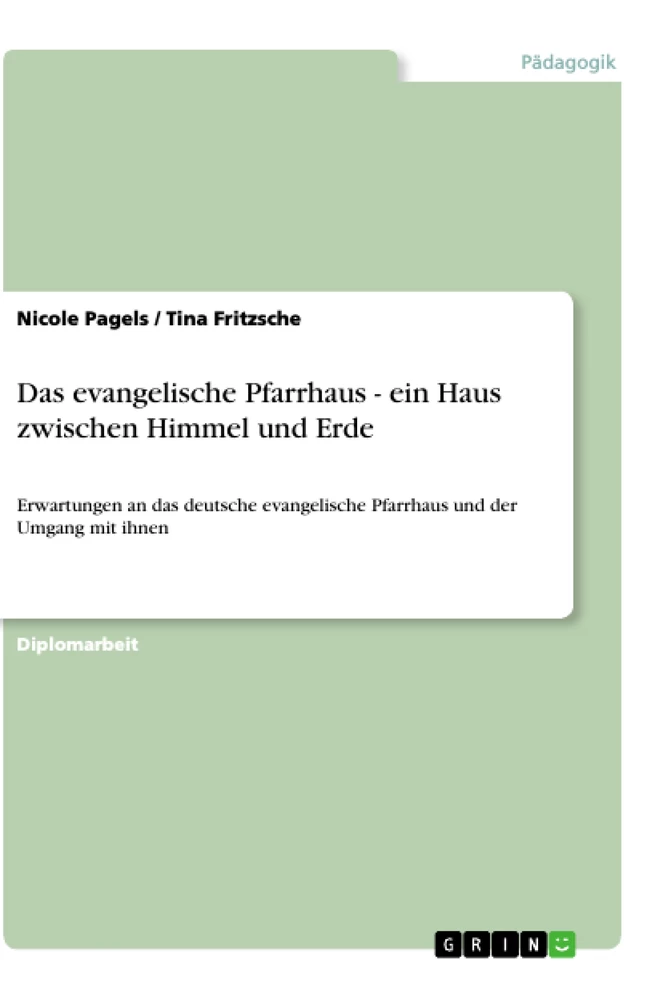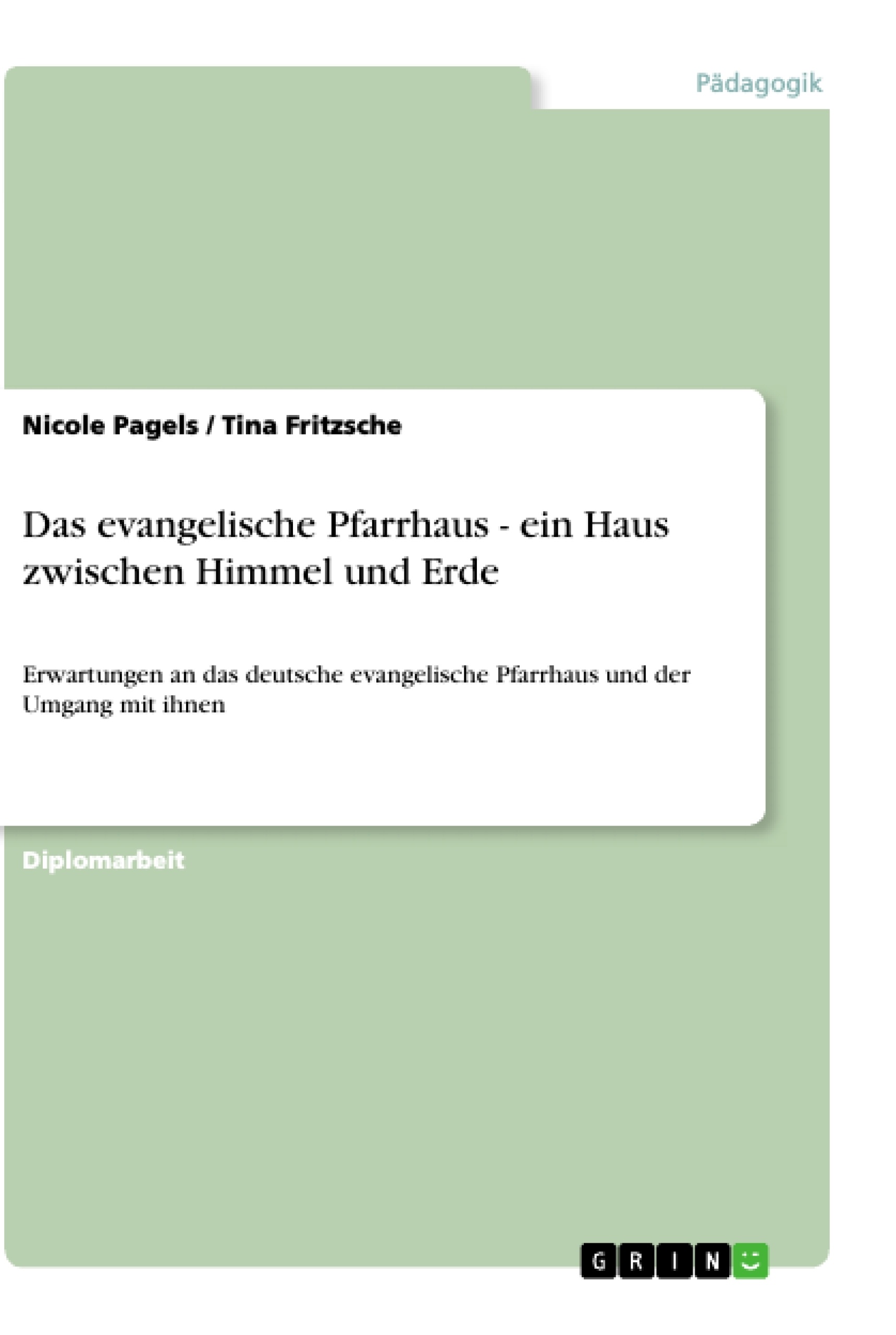Einleitung
Das evangelische Pfarrhaus ist eine Errungenschaft der Reformationszeit. Hier durften Ehe und Familie der Geistlichen offen ausgelebt werden und mussten nicht im Geheimen bleiben. Das Pfarrhaus hat viele Zeitepochen er- und durchlebt. Dabei hat es manche Änderungen akzeptiert und sich manchen verweigert. Es ist ein Haus, welches ein Sammelsurium an Traditionen in sich beherbergt.
Neben unzähligen Traditionen haben sich in der fast 500-jährigen Geschichte des Pfarrhauses auch verschiedene Erwartungen an dessen Bewohner summiert. In den unterschiedlichen Lebensphasen des Pfarrhauses sind verschiedene Aufgaben, Eigenschaften oder Merkmale der Pfarrhausbewohner wichtig gewesen, die dann meist in den allgemeinen Erwartungsschatz übernommen wurden und ihre Entstehungszeit überdauerten.
In der gegenwärtigen Zeit leben noch immer Menschen von Amts wegen in Pfarrhäusern. Sie leben dabei gleichzeitig in den Traditionen und der Gegenwart – sie stehen zwischen dem Erwartungsschatz und der modernen Lebenswelt.
Daraus ergibt sich die Frage: Inwieweit beeinflussen historisch gewachsene Erwartungen an das Pfarrhaus noch heute das Leben seiner Bewohner?
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorbetrachtung
Kapitel I: Die Erwartungen an das evangelische Pfarrhaus und die Suche nach ihrer Entstehung
1. Entstehungsgeschichte des evangelischen Pfarrhauses
2. Das Pfarrhaus
2.1. Das Pfarrhaus als Ort der Bildung
2.1.1. Theologische Bildung
2.1.2. Allgemeinbildung
2.1.3. Vererbbarkeit
2.1.4. Resümee Bildung
2.2. Das Pfarrhaus als Ort der Kultur
2.2.1. Beiträge zur Kultur
2.2.2. Resümee Kultur
2.3. Das Pfarrhaus als offene Burg
2.3.1. Sozialstation
2.3.2. Zufluchtsort
2.3.3. Resümee Das Pfarrhaus als offene Burg
3. Pfarrfamilie als Idealbild und Maßstab
3.1. Pfarrfamilie
3.1.1. Die etwas andere Familie?.
3.1.2. Resümee Pfarrfamilie
3.2. Pfarrfrau
3.2.1. Die etwas andere Frau?
3.2.2. Resümee Pfarrfrau
3.3. Pfarrehe
3.3.1. Die etwas andere Ehe?
3.3.2. Resümee Pfarrehe
3.4. Erziehung im Pfarrhaus
3.4.1. Die etwas andere Erziehung?
3.4.2. Resümee Erziehung
4. Fazit I
Kapitel II: Die heutigen Lebensumstände
1. Zeitliche Einteilung
1.1. Moderne und Postmoderne
1.2. Resümee Zeitliche Einteilung
2. Bevölkerungsentwicklung und Demographie
2.1. Demographischer Wandel
2.1.1. Geburten und Lebenserwartung
2.1.2. Alterung und Altersstruktur
2.1.3. Resümee Demographischer Wandel
2.2. Lebensbedingungen
2.2.1. Wohlstand und Armut
2.2.2. Bildung und Arbeit
2.2.3. Soziale Klassen, Schichten, Lagen und Milieus
2.2.4. Resümee Lebensbedingungen
3. Familie im Wandel
3.1. Familienleben
3.1.1. Gesellschaftliche Bedeutung
3.1.2. Resümee Familienleben
3.2. Wandel der Lebensstile
3.2.1. Rollenverhältnisse
3.2.2. Ehescheidung
3.2.3. Alternative Lebensstile gegenüber der Ehe
3.2.4. Resümee Wandel der Lebensstile
4. Fazit II
Kapitel III: Konfliktfelder zwischen Erwartungen und Lebensumständen
1. Konfliktfeld Pfarrfamilie
1.1. Modellfamilie vs. Familienmodelle
1.2. Universalität vs. Spezialisierung
1.3. Resümee Pfarrfamilie
2. Konfliktfeld Pfarrfrau
2.1. Pfarrdienst vs. Eigenständigkeit
2.2. Vorrang vs. Selbstentfaltung
2.3. Resümee Pfarrfrau
3. Konfliktfeld Pfarrehe
3.1. Amt vs. Privatleben
3.2. Persönliche Faktoren vs. Äußere Umstände
3.3. Resümee Pfarrehe
4. Konfliktfeld Bildung
4.1. Pfarrhaus als Bildungsgarant vs. Bildungslandschaft
5. Konfliktfeld Pfarrkinder
5.1. Vielkinderhaushalt vs. Geburtenrückgang
5.2. Bescheidenheit vs. Dazugehören
5.3. Bildungselite vs. Blick für andere
5.4. Pflichterfüllung vs. Freiwilliges Engagement
5.5. Resümee Pfarrkinder
6. Konfliktfeld Kultur
6.1. Kultur vs. Soziales Milieu
6.2. Kulturelle Bildung vs. Leistungsdruck
6.3. Resümee Kultur
7. Konfliktfeld Asyl
7.1. Immer erreichbar vs. Privates Familienleben
7.2. Offenheit vs. Sicherheitsgesellschaft
7.3. Resümee Asyl
8. Fazit III
Kapitel IV: Der Umgang mit den entstandenen Konfliktfeldern
1. Pfarrstellen und Ausbildung
1.1. Veränderungen im Pfarramt
1.1.1. Handlungsschritt Teildienste
1.1.2. Resümee Pfarrstellen
2. Leben im Pfarrhaus
2.1. Kontroversen
2.1.1. Residenzpflicht und Dienstwohnungspflicht
2.1.2. Präsenzpflicht und Erreichbarkeit
2.1.3. Anerkennung und Erleichterung des Pfarrhauslebens
2.1.4. Resümee Kontroversen
3. Pfarrfamilie
3.1. Rolle der Pfarrfamilie im Gemeindeleben
3.2. Modellhaftigkeit der Pfarrfamilie heute
3.3. Resümee Pfarrfamilie
4. Pfarrehe, Pfarrfrauen und Pfarrmänner
4.1. Rollenverständnis
4.1.1. Berufsleben
4.1.2. Privatleben
4.1.3. Familienleben
4.1.4. Resümee Rollenverständnis
4.2. Pfarrehe und Lebensstile
4.2.1. Kirche und Homosexualität
4.2.2. Umgang mit Homosexualität
4.2.3. Pfarramt und Homosexualität
4.2.4. Pfarrhaus und Homosexualität
4.2.5. Resümee Pfarrehe und Lebensstile
5. Fazit IV
Fazit
Literaturverzeichnis
Onlinequellenverzeichnis
Abbildungen
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
Abb. 7
Abb. 8
Anhang
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
Einleitung
Das evangelische Pfarrhaus ist eine Errungenschaft der Reformationszeit. Hier durften Ehe und Familie der Geistlichen offen ausgelebt werden und mussten nicht im Geheimen bleiben. Das Pfarrhaus hat viele Zeitepochen er- und durchlebt. Dabei hat es manche Änderungen akzeptiert und sich manchen verweigert. Es ist ein Haus, welches ein Sammelsurium an Traditionen in sich beherbergt.
Neben unzähligen Traditionen haben sich in der fast 500-jährigen Geschichte des Pfarrhauses auch verschiedene Erwartungen an dessen Bewohner summiert. In den unterschiedlichen Lebensphasen des Pfarrhauses sind verschiedene Aufgaben, Eigenschaften oder Merkmale der Pfarrhausbewohner wichtig gewesen, die dann meist in den allgemeinen Erwartungsschatz übernommen wurden und ihre Entstehungszeit überdauerten.
In der gegenwärtigen Zeit leben noch immer Menschen von Amts wegen in Pfarrhäusern. Sie leben dabei gleichzeitig in den Traditionen und der Gegenwart – sie stehen zwischen dem Erwartungsschatz und der modernen Lebenswelt.
Daraus ergibt sich die Frage: Inwieweit beeinflussen historisch gewachsene Erwartungen an das Pfarrhaus noch heute das Leben seiner Bewohner?
Für die Verfasserinnen besteht hier die These: Die jahrhundertealte Tradition des deutschen evangelischen Pfarrhauses unterscheidet sich so stark von den gegenwärtigen Lebensumständen, dass sich die gewachsenen Erwartungen an das Pfarrhaus mit diesen nicht vereinbaren lassen.
Bevor jedoch auf die oben genannte Frage eine konkrete Antwort gegeben werden kann, müssen kleinere Forschungsschritte unternommen werden, welche die verschiedenen Teilbereiche der Frage getrennt voneinander beleuchten.
Es muss gefragt werden, welche Erwartungen überhaupt in der Geschichte des evangelischen Pfarrhauses an dieses entstanden sind und wie die gegenwärtigen Lebensumstände aussehen. Außerdem muss untersucht werden, wo mögliche Konfliktfelder zwischen bestehenden Erwartungen und gegenwärtigen Lebensumständen entstehen und welcher Stellenwert ihnen in aktuellen Diskussionen eingeräumt wird. Dann kann erarbeitet werden, wie die beteiligten Diskussionspartner mit den Konflikten umgehen, welche Änderungen von aktueller Bedeutung sind und wo weiterhin Handlungsbedarf besteht.
Kapitel I fragt nach den Erwartungen an das evangelische Pfarrhaus und sucht nach möglichen Entstehungsumständen. Zu Beginn wird ein kurzer Einblick in die Entstehungsgeschichte des evangelischen Pfarrhauses gegeben. Anschließend werden die an das Pfarrhaus gerichteten Erwartungen in unterschiedlichen Themenbereichen vorgestellt.
Kapitel II beschäftigt sich mit den aktuellen Lebensbedingungen. An dieser Stelle ist es aufgrund der Vielfältig- und Vielgestaltigkeit des modernen Lebens notwendig, eine Eingrenzung vorzunehmen. Daher soll in Bezugnahme auf den ersten Teil der Arbeit im Besonderen auf die Bevölkerungsentwicklung und auf familiale sowie partner-schaftliche Lebensformen eingegangen werden.
Im Anschluss werden in Kapitel III beide Recherchen miteinander in Verbindung gebracht und unter dem Aspekt möglicher Spannungen untersucht. Daraus folgend werden thematische Konfliktfelder definiert.
Um nun herauszufinden, inwieweit die in den Konfliktfeldern beteiligten Erwartungen heute tatsächlich noch Einfluss haben, untersucht Kapitel IV gegenwärtige Diskussionen und die Standpunkte der beteiligten Diskussionspartner. Außerdem wird hier betrachtet, wie die Beteiligten mit Gegenmeinungen und -entscheidungen umgehen und in welchen Themenbereichen weiterhin Handlungsbedarf besteht.
Vorbetrachtung
Der Untertitel der Arbeit lautet: Erwartungen an das deutsche evangelische Pfarrhaus und der Umgang mit ihnen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die Nennung der territorialen Eingrenzung verzichtet. Wenn nicht anders vermerkt, ist dies jedoch in der Bezeichnung ‚evangelisches Pfarrhaus‘ impliziert.
Zudem wird sowohl im Untertitel als auch in der Arbeit selbst oft vom Pfarrhaus gesprochen, wenn die Pfarrhausbewohner gemeint sind. Das Pfarrhaus ist nur solange tatsächlich ein Pfarrhaus, wie es durch seine Bewohner geprägt und gestaltet wird und somit nicht von seinen Bewohnern zu trennen. Wenn nicht anders vermerkt, bezieht sich die Bezeichnung Pfarrhaus auf dessen Bewohner.
Das Kapitel IV der Arbeit beschäftigt sich mit gegenwärtigen Diskussionsständen. Da der Beginn und somit die grundlegenden Intentionen einiger derzeit aktueller Diskussionen bereits eine Weile zurück liegen, wird hier auch auf ältere Publikationen zurückgegriffen. Der größte Teil des verwendeten Materials bezieht sich auf die Jahre um die Jahrtausendwende bis heute.
Kapitel I stammt von Nicole Pagels, Kapitel II wurde von Tina Fritzsche verfasst. Alle anderen Kapitel und Abschnitte sind in gemeinsamer Arbeit entstanden.
Kapitel I: Die Erwartungen an das evangelische Pfarrhaus und die Suche nach ihrer Entstehung
Dieses erste Kapitel soll sich mit den Erwartungen an das evangelische Pfarrhaus beschäftigen. Dabei steht die These voran, dass die fast 500-jährige traditionsreiche Geschichte des Pfarrhauses viele und sehr unterschiedliche Erwartungen wachsen ließ. Dieses Kapitel soll einen genaueren Blick darauf werfen, welche Erwartungen entstanden sind und welche Umstände, geistige und geistliche Einflüsse diese geprägt haben. Der erste Teil soll einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte geben, wobei die doch sehr komplexen Zusammenhänge der Reformation in ihrer Entwicklung und ihren Auswirkungen nur in einem sehr engen Rahmen betrachtet werden können. Im zweiten Teil steht das Pfarrhaus als Ort der Bildung, der Kultur und des Asyls, sowie die Erwartungen an jenes in diesen drei Bereichen im Mittelpunkt. Der dritte und letzte Teil widmet sich den speziell an die Pfarrfamilie gerichteten Erwartungen. Die in dieser Arbeit behandelten Erwartungen stellen einerseits die wohl bedeutendsten, andererseits jedoch nur einen Bruchteil der vielfältigen Erwartungen dar, die landauf und landab an das Pfarrhaus gestellt wurden und werden. Bei allen Erwartungen handelt es sich um Ansprüche, die in der verwendeten Literatur entweder explizit genannt oder aus dem jeweiligen Gesamtkontext abgeleitet werden konnten.
1. Entstehungsgeschichte des evangelischen Pfarrhauses
Die Entstehungsgeschichte des evangelischen Pfarrhauses ist untrennbar mit den Geschehnissen der Reformation und deren theologischen Inhalten verbunden.
Die Reformation, deren bekanntester Vertreter wohl Martin Luther ist, resultierte vor allem aus dem Spannungsverhältnis zwischen Klerikern und Laien, welches dem gemeinen Volk die Krise der Gesellschaft im späten Mittelalter vor Augen führte.[1] Diese Krise umfasste dabei auch viele kirchenpolitische Missstände, die das gesellschaftliche Leben stark beeinflussten und daher „[…] immer wieder Gravamina (Beschwerden) insbesondere gegen den städtischen Klerus vorgetragen worden“[2]: so beispielsweise über die sittliche Untauglichkeit von Klerikern und Reformfehlschläge mehrerer Konzile des 15. Jahrhunderts[3] oder über die „[…] Bildungslosigkeit und [das] skandalöse Leben […]“[4] des geistlichen Standes. Ein Missstand, der die Entstehung des evangelischen Pfarrhauses im besonderen Maße beeinflusste, war das Zwangszölibat, welches die (katholische) Kirche ihren Geistlichen auferlegte. Obwohl aus biblischen Texten kein Eheverbot hervorgeht „[…] und den Gemeindevorstehern […] die Ehe empfohlen [wurde], […] gewann […] die Anschauung Einfluß, daß das ehelose Leben besser sei als die Ehe.“[5] Um diese Anschauung im klerikalen Stand durchzusetzen, musste es immer wieder neue einschneidende Vorschriften geben, um den Widerstand der Priester und Bischöfe gegen den zölibatären Lebensstil zu brechen. Diese erzwungene Ehelosigkeit hatte für die Kirche „[…] zwangsläufig schwere Mißstände zur Folge, die vielfach zu Tage traten und besonders am Vorabend der Reformation offenkundig waren.“[6] So klagte beispielsweise der Bischof von Meißen über die Konkubinatsverhältnisse[7] der Kleriker: „Unsere Pfarrer sind fast sämtlich Konkubinarien […].“[8] Luther und andere Reformatoren traten für die Abschaffung dieses erzwungenen Zölibats ein, weil sie keine Begründung für dieses in den biblischen Schriften sahen.[9] Damit war der Weg für die Heirat und die Familiengründung evangelischer Theologen frei und der Grundstein für die Entstehung eines evangelischen Pfarrhauses gelegt. Die tatsächliche Begründung des evangelischen Pfarrhauses reicht jedoch, wenn man es genau nimmt, in diesem Jahr 487 Jahre in die deutsche Vergangenheit zurück. Nicht bei vielen Entstehungsgeschichten lässt sich ein so genaues Anfangsdatum verzeichnen, wie beim evangelischen Pfarrhaus. Am 13. Juni 1525 heiratete der ehemalige Mönch Martin Luther die entlaufene Nonne Katharina von Bora. Durch diese nicht nur aus den papistischen Lagern, sondern teilweise auch im Freundeskreis Luthers mit ablehnenden bzw. kritischen Augen betrachtete Eheschließung, entsteht der „[…] erste[…] und bedeutendste[…] Prototyp […]“[10] des evangelischen Pfarrhauses.
„[Luther war] keineswegs der erste unter den reformatorischen Männern, der zu der Predigt des Wortes das eigene Vorbild fügte, um die Wahrheit zu bekräftigen, daß die Ehe Gottes heilige Ordnung, die Lehre, man solle nicht ehelich werden, des Teufels Betrug sei […].“[11]
Vor ihm waren bereits andere Pfarrer wie Johannes Bugenhagen, Justus Jonas und auch Ulrich Zwingli verheiratet.[12] Das Haus Luthers war jedoch das erste Pfarrhaus, von dem so genau berichtet wurde, wie das Zusammenleben vonstattenging und wie eine erste evangelische Haushaltsführung entwickelt wurde, die noch viele Generationen nach Luther das Pfarrhausleben prägen und beeinflussen sollte.
2. Das Pfarrhaus
Der Begriff des Pfarrhauses lässt sich auf unterschiedliche Weise definieren. Zum einen kann er das Pfarrhaus als Bauwerk bezeichnen und zum anderen kann er das Pfarrhaus als Institution mit seinen Funktionen und vor allem seinen Bewohnern bezeichnen. Im folgenden Abschnitt soll es um die Funktionen der Institution Pfarrhaus und um die Erwartungen, die in den jeweiligen Bereichen gestellt wurden und werden, gehen. Dabei sollen im Besonderen das Pfarrhaus als Ort der Bildung, der Kultur und des Asyls betrachtet werden.
2.1. Das Pfarrhaus als Ort der Bildung
Das Pfarrhaus als Ort der Bildung umfasst zwei unterschiedliche Dimensionen. Zum einen kann das Pfarrhaus als ein Ort gesehen werden, in dem Bildung angeboten und weitergegeben wurde und zum anderen lässt sich das Pfarrhaus als ein Ort festmachen, aus welchem Bildung hervorgegangen ist. In diesem Abschnitt sollen in drei verschiedenen Ebenen der Bildung unterschiedliche Erwartungen angesprochen werden.
2.1.1. Theologische Bildung
„Der spätmittelalterliche [vorreformatorische] Pfarrer verfügte häufig über einen geringen Bildungsstand, der ihn gerade instand setzte, die Messe zu lesen und kirchliche Riten zu vollziehen, auch die nötigen Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Der Aufgabe zu predigen war er [jedoch] oft nicht gewachsen.“[13]
Diese Einschätzung des vorreformatorischen Pfarrerstandes, die sich nicht nur auf die theologische, sondern auch auf die allgemeine Bildung des einfachen Pfarrers bezieht, spiegelt einen der vielen Missstände wider, welche die spätmittelalterliche Kirche belastete. Vermutlich traf diese Beurteilung nicht nur auf den niederen Klerus, sondern ebenfalls auf den höheren Klerus (Bischöfe und Äbte) zu.
Im Zuge der Reformation sollte sich neben den hierarchischen Strukturen der Kirche auch der Bildungstand der gewöhnlichen Pfarrer ändern, denn der nun neu herausgebildete Stand der evangelischen Pfarrer wurde wesentlich durch die Ausbildung derselben an den theologischen Fakultäten mitbestimmt.[14] Luther sah hier neben der elementaren Bedeutung des Priestertums aller Gläubigen die „[…] Notwendigkeit, einzelne zur öffentlichen Amtsausübung zu bestimmen, was konkret bedeutet, sie durch ein Studium auszubilden und sie in ihr Amt einzusetzen“[15], denn „[z]u den zentralen Forderungen der Wittenberger […] Reformation gehörte eine gründliche theol[ogische] Ausbildung aller künftigen Geistlichen.“[16] Durch diese Maßnahme begann sich die Schicht der geistlichen Obrigkeit, die zuvor hauptsächlich aus dem Adel bestand, auf die gelehrten Pfarrer zu verschieben.[17] Dies bedeutet allerdings nicht, dass nun umgehend alle neu eingesetzten Pfarrer zur Bildungselite gehörten. Kirchengeschichtler Wilhelm Kantzenbach unterscheidet hier zwischen den „sacerdotes litterati“ (studierte Pfarrer) und den „sacerdotes simplices“, der breiten Masse an Pfarrern, die nur über ein Minimum an Bildung verfügten.[18] Auch der Theologe Ernst Troeltsch berichtet von den unterschiedlichen Amtsmöglichkeiten eines reformatorischen Pfarrers:
„Der Priester wird zum Prediger; akademisch gebildet, mit eingehendster Bibelkenntnis ausgerüstet … wird er wenigstens in seinen Spitzen, in den Hofpredigern, Fakultätstheologen und Stadtpfarrern zum Beherrscher des geistigen Lebens.“[19]
Das hier von Seiten der Reformatoren angestrebte Ideal eines theologisch hervorragend gebildeten Pfarrers ließ sich nicht zum allgemeinen Standard erheben, wie verschiedene Visitationen, welche auch von der Kirchenobrigkeit durchgeführt wurden, in den nächsten Jahrhunderten immer wieder aufs Neue ausmachten.
Im 17. und gelegentlich auch noch im 18. Jahrhundert war der Bildungsstand der Geistlichen (vornehmlich der Landgeistlichen) beklagenswert niedrig.
„Da weder die Zulassungsbedingungen der Universitäten noch die Verweildauer oder die Anforderungen der Abschlußexamina geregelt waren, fanden die Kirchenvisitationen des 17. Jahrhunderts viele Pfarrer, die nicht ordentlich Lateinisch, geschweige denn Griechisch oder Hebräisch konnten, teilweise nicht einmal eine Bibel besaßen […].“[20]
Nun könnte man meinen, dass aufgrund solcher Angelegenheiten der Anspruch der Bevölkerung an einen theologisch gut gebildeten Pfarrer sinken würde. Es lässt sich hier jedoch eher das Gegenteil finden. Seit der Geburtsstunde wurde dem gebildeten Pfarrhaus ein hoher Stellenwert eingeräumt, auf das man ebenso wenig verzichten wollte, wie auf eine grundlegende theologische und bibelwissenschaftliche Ausbildung des Geistlichen.[21] Immer wieder gab es Beschwerden aus dem Pfarrvolk, dass der Pfarrer sich zu wenig um sein geistliches Amt und seine theologische Bildung kümmere, sondern vorrangig anderen Tätigkeiten nachging – so auch im 18. Jahrhundert.
„‚Ein Gelehrter und ein Bauer lassen sich in ihren Geschäften gar nicht vereinigen … ich kenne selbst einige … solche nichtswürdige Prediger …, welche sich mit der Besorgung ihrer Feldgüter beschäftigen und darüber alles, wozu sie noch da sind, wozu sie berufen sind, … versäumen. Sie sind mehr auf ihren Äckern und Wiesen als in ihren Studierstuben, öfters beim Pflug als beim Buch […].‘“[22]
Auch „[e]ine württembergische Landtagsschrift von 1797 äußerte ein ähnlich hartes Urteil […]: […] Man trifft daher unter der Geistlichkeit mehr Mathematiker, Statistiker [u.ä.] als selbstdenkende, rastlose Theologen.“[23] Andererseits gab es auch durchaus Gemeinden, in denen Pfarrer und Pfarrvolk sich durch die Beschäftigung des Pfarrers mit dem alltäglichen Tun des Pfarrvolkes näher kamen. Bevor im 19. Jahrhundert die feste Pfarrbesoldung eingeführt[24], der Zehnt abgeschafft und die großen Pfarrgüter in Pacht gegeben wurden[25], hatte die Pfarrfamilie ihre Mühe, finanziell über die Runden zu kommen. Sie war stets angewiesen auf die Landwirte aus ihrem Pfarrvolk, welche den Pfarrer für sein Amt mit dem Pfarrzehnt zu entlohnen hatte. „Pfarrzehnt und ‚Emolumente‘ bildeten das Naturalienband, das Pfarrhaus und Pfarrvolk verband.“[26] Um sein Überleben und das seiner Familie zu sichern, war der Pfarrer so immer öfter darauf angewiesen, sich selbst in der Landwirtschaft zu betätigen. Dieses zweite Standbein konnte verständlicherweise nicht ausgeführt werden, ohne das Erste, den eigentlichen Beruf als Pfarrer, zu beeinträchtigen. Auf der einen Seite forderte das Pfarrvolk die selbstständige Versorgung des Pfarrers, welche ihm einen hohen Zeitverlust für sein eigentliches Amt einbrachte, und auf der anderen Seite forderte es, dass ihr Pfarrer alle zum Amt gehörigen Aufgaben gewissenhaft erfüllt. So ist über den Pfarrstand zu lesen: „Im ganzen [sic] ist’s und bleibt’s ein harter Stand: wenig Brot, viel Kampf, Streit und Not.“[27]
Obwohl eine Vielzahl von Pfarrern – gewiss nicht alle, denn zu jeden Zeiten gab es herausragende Beispiele, welche mit mustergültiger Bildung, besonders auch im theologischen Bereich, glänzten – lange Zeit mit einer mittelmäßigen Bildung nicht an das reformatorische Ideal heranreichten, so ist dennoch der Bildungsunterschied zwischen Pfarrer und Pfarrvolk von der Reformationszeit bis ins 19. Jahrhundert stetig gewachsen. Damit vergrößerte sich die Kluft, welche die Bildung in das Verhältnis zwischen Pfarrer bzw. meist auch Pfarrfamilie und Pfarrvolk riss und viele Jahrhunderte nicht mehr zu überwinden war.[28]
2.1.2. Allgemeinbildung
So wie zuvor im Abschnitt Kap. I, 2.1.1. Theologische Bildung von einer schlechten Bildung des Pfarrstandes kurz vor der Reformation berichtet wird, lässt sich in diesem Abschnitt sagen, dass auch der Bildungsstand des Volkes „[…] traurig [war], und selbst die Lateinschulen […] in ‚gruwelicker Dusternisse‘ [steckten]“[29], wie Luther einmal selbst bemerkte. In der vorreformatorischen Zeit wurde das gesamte Bildungswesen „[…] ausschließlich von der Geistlichkeit getragen und [war] nur für den Klerus bestimmt […].“[30] Diese dominierende Rolle des Klerus sollte nach den Vorstellungen Luthers und denen des humanistischen Reformators Philipp Melanchthon eine andere Gewichtung bekommen. „[N]eben den Eltern [trägt] die Obrigkeit (Staat, Stadt) auf der Grundlage der Zweiregimenten-Lehre[31] die Verantwortung für die christl[iche] Unterweisung und Ertüchtigung für die weltlichen Stände und Berufe […].“[32] Dass auch die Reformatoren in den gedanklichen Schemata ihrer Zeit verhaftet waren, zeigt einmal mehr der Bereich Bildung – explizit der Frauenbildung.
„Zwar werden Mädchen in die untere Schulbildung einbezogen, die nicht unwesentlich am allgemeinen Priestertum bzw. am Gottesdienst im Alltag der Welt orientiert ist. Aber die Mädchenschulen sind einseitig auf den neu geheiligten ‚Beruf‘ und ‚Stand‘ der Ehe- und Hausfrau bezogen. […] [D]en Frauen [bleibt] der Zugang zur höheren Schulbildung, also auch zu den Universitäten und den öffentlichen Ämtern in Kirche und Staat ebenso verschlossen wie zu anderen Berufen.“[33]
Dennoch muss man den Reformatoren und den Pfarrern dieser Zeit zugutehalten, dass sie sich bemühten, die Lücke, welche die Abschaffung der Klöster und damit auch teilweise der Klosterschulen in die Bildungslandschaft riss, zu schließen. Der neue geistliche Stand wird zum Stützwerk des Schulwesens. „Die Schulen bestimmend und den höheren Lehrerstand stellend wird er zugleich der Träger des Schulwesens, während das niedere Schulwesen vom Küster versorgt wird.“[34]
Im Pietismus, „eine[r] Erneuerungsbewegung im Protestantismus […] des späten 17. J[ahr]h[underts] und des 18. J[ahr]h[underts]“[35], wandelte sich wohl die Erwartung einer guten Bildung an den Pfarrer in eine Erwartung um, die auch an die Pfarrfrau gestellt wurde. Durch die bessere Schulbildung für Mädchen und auch der geänderten Rolle der Frau im Sinne eines „[…] partnerschaftlichen Umgang[s] der Geschlechter, einer Seelengemeinschaft […]“[36], wurden auch die Pfarrfrauen zunehmend gebildeter und brachten sich in der Pfarrgemeinde mit ein. Durch die Heirat einer gebildeten Frau aus gutem Hause erhoffte sich so mancher Theologe auch einen sozialen Aufstieg. Die Theologin und Soziologin Sigrid Bormann-Heischkeil zitiert hierzu Burgers Beobachtung: „[…] [J]unge[…] Theologen […] neig(t)en [dazu] eine Frau zu heiraten, die eher aus sozial etwas höher gestellten Kreisen stammt(e) als sie selber.“[37]
Die pietistische Zeit „[…] präsentierte sich als fortgeschriebene Reformation […]“[38], in der sich auch die Pfarrhäuser wieder als Bildungseinrichtungen betätigten. So war es in Württemberg üblich, das Pfarrhaus auch zu einem „[…] Sammelpunkt [für Studenten] [zu machen], wo sie nicht nur selbst religiös beeinflusst wurden, sondern [beispielsweise] auch in die spezielle Seelsorge [eingeführt wurden].“[39]
Überhaupt wurde im Pietismus versucht, die Dreiheit des Klosterlebens (Andacht, praxis pietatis und Bildungsarbeit[40]) in veränderter Form wieder Einzug in die Pfarrhäuser halten zu lassen. Geistliche Erbauung fand nun nicht mehr nur in den Privathäusern der Gemeineglieder statt, sondern wurde auch in den Pfarrhäusern gepflegt – durch Privatandachten, Bibelstudium[41], Lieder und freies Gebet.[42]
In der sich anschließenden Zeit der Aufklärung spielte ein weiterer wichtiger Aspekt mit hinein. Wie bereits vorher schon erwähnt, war es der Pfarrfamilie bis zur Einführung der festen Pfarrbesoldung nicht immer leicht, das Überleben zu sichern. Aus diesem Grund und sicherlich auch, weil besonders der Pfarrer mit seiner das gemeine Volk übersteigenden Bildung es leisten konnte, war es üblich, dass „[…] der Pfarrer Pensionäre ins Haus nahm und eine förmliche Privatschule hielt.“[43] Generell waren die Pfarrer der Aufklärung sehr interessiert an der Unterweisung. „Es hat die Aufklärung zu einem pädagogischen Zeitalter gemacht.“[44] In dieser Weise wird es seit der Aufklärung immer üblicher, dass Pfarrfamilien Schüler in ihr Haus aufnahmen. Nicht immer war das ohne Schwierigkeiten durchführbar, denn die Zustände der Pfarrhäuser waren auch zu dieser Zeit teilweise sehr miserabel.[45] Paul Drews, Pfarrer und außerordentlicher Professor für Praktische Theologie, hielt dazu zwei Zeitzeugenberichte fest, welche von teilnehmenden Schülern geschildert wurden:
„‚Hütten aus Lehm und Holz‘ […]. ‚Bei jedem Schritt und Tritt war man in Gefahr, sich tot zu stürzen oder den Kopf wider zu stoßen. Über den Mist ging’s ins Haus, durch den Kuhstall in die Studierstube und durch die Rauchkammer zu Frau Pastorin.‘ ‚Zimmer‘, sagt ein anderer, ‚welche ihres nassen Bodens wegen die Gesundheit unausbleiblich zerstören
müssen, elende Behältnisse, welche manchmal eher den Gemächern zerstörter Schlösser ähnlich sehn als Wohnungen der Lebendigen – so sind nicht selten die Behausungen der Landgeistlichen.‘ Allerdings gesteht derselbe Berichterstatter, sogar ‚prächtige‘ Landpfarrhäuser getroffen zu haben.“[46]
Es war aber nicht nur üblich, Schüler ins Pfarrhaus zu holen, sondern man ging auch in andere Familien, um dort zu unterrichten. So spielte bis ins 19. Jahrhundert hinein auch für so manchen angehenden Pfarrer das Dasein als Hauslehrer (auch Hofmeister genannt) eine prägende Rolle.
„In der Regel studierten die Siebzehn- bis Achtzehnjährigen, die sich auf die Universität begaben, drei Jahre, oft auch nur zwei. Das Studium bot – in bescheidenem Rahmen freilich – eine gewisse Chance zum sozialen Aufstieg, besonders in der theologischen Fakultät.“[47]
Junge Männer, teilweise aus sozial schwachen Schichten der Bevölkerung, versuchten hier ihren eigenen Stand zu verbessern. Es lässt sich dazu in mehreren Gegenden Deutschlands für diese Zeit, sehr zum Wehklagen der Universitäten, ein enormer Zulauf an Studenten der Theologie verzeichnen. Für eine solche Fülle von Absolventen war aber zweifellos der damalige Arbeitsmarkt nicht ausgelegt, sodass „[…] als Übergangslösung […] an eine Hauslehrerexistenz […]“[48] gedacht wurde.
„Einige dieser Studenten hatten offensichtlich von vornherein gar nicht die Absicht, Pfarrer zu werden[, sondern] dachten […] an eine Schulstelle“[49], um „[…] sich aus sozialer Misere zu erheben.“[50] Andere Absolventen strebten jedoch durchaus das Amt eines Pfarrers an und mussten sich, wegen weniger freier Arbeitsstellen, zunächst einmal mit einer Stelle als Hauslehrer zufriedengeben und auf eine geeignete Gelegenheit warten, um ein Leben als Pfarrer beginnen zu können. Daher „[…] galt [die Hauslehrerexistenz, im Gegensatz zum Pfarrberuf] […] in der historischen Realität fast immer mehr als notwendiges Übel denn als mit Überzeugung übernommenes Amt.“[51]
2.1.3. Vererbbarkeit
Es ist zahlreich belegt und daher nicht zu leugnen, dass über viele Jahrhunderte hinweg der Pfarrberuf einer gewissen Vererbung unterlag, durch die sich im Laufe der Zeit so genannte Pfarrdynastien entwickeln konnten. Hermann Werdermann, Theologe, vermutet das wesentliche Fundament für die Herausbildung des evangelischen Pfarrerstands in der Vererbungspraxis:
„Dadurch, daß die […] evangelische Kirche einen legitim verheirateten Pfarrerstand hatte, war es möglich, daß sich im Laufe der Zeit wirklich ein Stand bildete, in dem von den Vätern und Müttern viel Erbweisheit und Erfahrung in den eigenen Beruf mit hinübergenommen werden konnte. Es konnte jetzt eine Tradition dadurch entstehen, daß der Sohn dem Vater oder der Schwiegersohn dem Schwiegervater in der Stelle nachfolgte.“[52]
Selbstverständlich gab es zu den unterschiedlichen Zeiten mehrere äußere Faktoren, die eine solche Weitergabe des Berufes an die eigenen Kinder begünstigten. Eine Grundlage war, dass in der traditionellen Gesellschaft keiner Anstoß daran genommen hätte, dass der Beruf der Kinder durch die Eltern bestimmt wurde.
„Daß der Beruf für die Kinder gewählt wurde, war ein so normaler Vorgang, daß er als solcher auch bei den Pfarrerskindern in der Regel keinen Protest hervorrief, daß der Wunsch der Eltern allmählich auch zu dem Wunsch der Kinder wurde.“[53]
Denn der Gehorsam gegenüber den eigenen Eltern spielte lange Zeit eine grundlegende Rolle im Leben der Kinder, wie auch im Leben der jungen Erwachsenen.
„Gehorsam war den Eltern jedes in ihrem Haushalt lebende ledige Kind unabhängig von dessen Alter schuldig. Es gab keinen Bereich (wie etwa die Berufs- oder Partnerwahl), der davon ausgenommen gewesen wäre. Die Gehorsamspflicht traf auch und (da religiös verankert) vielleicht ganz besonders auf die Pfarrerskinder zu.“[54]
Die österreichische Schriftstellerin Lieselotte von Eltz-Hoffmann schreibt dazu:
„Der Pfarrer wünschte […] und forderte oft auch von seinem Sohn, dass er die gleiche Laufbahn einschlug. Entzog er sich aber dem geistlichen Amt, wog dies umso schwerer, als dieser Beruf mehr denn andere, als eine Berufung verstanden wurde. Er verschloss sich damit gleichsam dem Ruf Gottes.“[55]
Der Berufswunsch der Eltern für ihre Kinder wurde im 18. Jahrhundert aufgrund von ausgebauten Stipendien begünstigt. So war es beispielsweise im Württembergischen „[…] das Recht einer jeden Honoratiorenfamilie, einen Sohn auf Kosten des geistlichen Gutes zum Theologen ausbilden zu lassen, wenn er die Aufnahmeprüfung in die Klosterschulen bestand.“[56] So ist es nicht unverständlich, dass in den Pfarrfamilien fast ohne Ausnahme jeweils zumindest ein Sohn dem Vater im Beruf nachfolgte.[57] Die Bedingung, eine solche Aufnahmeprüfung zu bestehen, um Zugang zu einer ausbildenden Schule zu erhalten, löste ohne Zweifel manchen Erfolgsdruck bei den Pfarrkindern aus, der sicher in den meisten Fällen auch gerade von den Eltern erzeugt wurde. „Auf den Kindern lag bei all[en] Opfern der Eltern ein enormer Leistungsdruck […]“[58], besonders dann, wenn man eine „[…] der begehrten Freistellen in den Seminaren und im Tübinger Stift sichern [wollte]“[59], um den „[…] finanzschwachen Eltern [eine notwendige Hilfe zu sein], die so vielleicht einem nächsten Sohn noch das Studium finanzieren konnten“[60], denn es gab ja bekanntlich nur einen Freiplatz für das Studium der Theologie pro Familie. Andreas Gestrich, Professor für neuere Geschichte an der Universität Trier, bemerkt dazu, dass „[d]ies […] einer der Gründe [sei], weshalb man auch relativ viele Pfarrerskinder beim Militär findet: Die Kadettenanstalten waren die einzige andere kostenlose höhere Ausbildungsinstitution […].“[61]
Auch im 19. Jahrhundert bleibt der enorme Leistungsdruck der Eltern auf die Söhne bestehen:
„Wollte eine Familie das ‚Klassen-Ziel‘ erreichen, sollte auch noch die nächste Generation dem eigentlichen Adel der Nation angehören, dann mußten möglichst alle Söhne auf die Universität, waren ‚Ausrutscher‘, das heißt Kinder, die ‚nur‘ ein Handwerk erlernten oder in einfache Verwaltungsberufe gingen, eine Schande für die Familie.“[62]
Durch die hohen Leistungsanforderungen sowie das Vereinheitlichen der schulischen und universitären Ausbildung wurde auch der Unterricht für die Pfarrkinder zunehmend vom Pfarrhaus in die öffentlichen Schulen ausgelagert.[63]
Wie gerade das letzte Beispiel belegt, ging es, auch wenn die „[…] Berufsvererbung, traditionsbetontes Generationsschicksal, im evangelischen Pfarrhaus von großer Bedeutung war […]“[64], im Laufe der Zeit nicht mehr nur darum, den Beruf des Pfarrers an die Kinder weiterzugeben, sondern allgemein einen hohen Bildungsstand der eigenen Kinder zu erreichen und sie in guten beruflichen Positionen zu wissen.
„Der katholische Kirchenrechtler von Schulte hat [zu Beginn des letzten Jahrhunderts] anhand der bänderreichen ‚Allgemeinen deutschen Biographie‘ festgestellt, daß von 1631 hervorragenden Gelehrten und Dichtern, die in diesem Werke behandelt sind […], 861, also über die Hälfte Pfarrer zu Vätern hatten. […] Von Schultes Feststellung beweist, daß jahrhundertelang das evangelische Pfarrhaus eine Keimstätte von Begabung gewesen ist, wie wir keine zweite besitzen.“[65]
Und auch der Dichter und Arzt Gottfried Benn, „[…] selbst […] ein Pfarrerskind“[66], „[…] weist […] darauf hin, daß ein groß Teil [sic] des genialen Europa um 1900 vom protestantischen Pfarrhaus gestellt worden sei[…]. Es bilde ‚ein erstaunliches Massiv genialer Erbmasse‘.“[67]
2.1.4. Resümee Bildung
Nun gilt es festzuhalten, welche Erwartungen an das Pfarrhaus sich aus den drei Bereichen zum Pfarrhaus als Ort der Bildung herauslesen lassen.
Die erste Erwartung aus dem Bereich theologische Bildung ist die Forderung nach theologischer Versiertheit des Pfarrers und darin inbegriffen die Kenntnis über die alten Sprachen (Latein[68], Hebräisch, Griechisch). Diese Erwartung ist sicherlich einerseits auf die Urbilder der evangelischen Pfarrer zurückzuführen, andererseits auch auf immer wiederkehrende, glänzende Streiflichter im Pfarrstand, welche sich aus der Masse heraushoben.
Eine zweite Erwartung, welche im Bereich Bildung an das Pfarrhaus gestellt wird, ist das Verlangen nach einer guten Allgemeinbildung[69] der Pfarrfamilie. Obwohl sich diese Erwartung wohl anfangs fast gänzlich auf den Pfarrer selbst bezog, hat sie sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und besonders die Pfarrfrau sowie in gewissem Maße auch die Pfarrkinder mit einbezogen. Es ist hier zu merken, dass sich die Erwartung an eine solide Bildung der Frau im Pfarrhaus nicht nur von außen entwickelt hat, sondern auch im Inneren des Pfarrhauses wuchs – auch der Pfarrer stellte diesen Anspruch an seine Ehefrau.
Die dritte Erwartung, welche ebenfalls im Bereich der Allgemeinbildung verankert ist, auch wenn sie wahrscheinlich besonders im Pietismus ihre Fühler auch in die theologische Bildung streckte, ist die Anforderung an das Pfarrhaus, die eigene gewonnene Bildung auch an die Gemeinde weiterzugeben – in Predigt, Bibelstunden, Konfirmanden- und Schulunterricht. Diese Erwartung ist sicherlich hauptsächlich durch das Schulsystem der Reformation und die Gemeindearbeit des Pietismus geprägt, auch wenn sie zu allen Zeiten eine Rolle spielte.
Eine vierte Erwartung an die Pfarrfamilie im Bereich der Bildung betrifft vor allem die Pfarrkinder. Sie sollen überdurchschnittlich gut in der Schule und erfolgreich im Studium sein. Bei dieser Erwartung ist sehr einfach auszumachen, dass sie vorrangig im Pfarrhaus selbst entstanden ist und erst von dort den Weg zu einer von außen an das Pfarrhaus herangetragenen Erwartung fand.
2.2. Das Pfarrhaus als Ort der Kultur
Das Pfarrhaus als Ort der Kultur meint hier einen Ort der geistigen und künstlerischen Betätigung. Der folgende Abschnitt soll dabei besonders auf die musischen und literarischen Aktivitäten eingehen, da diese das Pfarrhaus am stärksten geprägt haben.
2.2.1. Beiträge zur Kultur
In einer von Theologe Johannes Hanselmann beschriebenen Umfrage schildern Pfarrehepaare das Pfarrhaus u.a. auch als „Kulturträger“[70] und auch vom Pfarrhaus der bürgerlichen Gesellschaft wird gesagt, dass es die städtische Kultur in die ländlichen Gegenden brachte, denn es wurde von „Bilder[n] und Bücher[n], Kunst und Dichtung, Musik und Gespräch […]“[71] gefüllt. Die Pfarrer waren meist nicht nur Geistliche, sondern sowohl sie selbst als auch so manche Pfarrerssöhne taten sich auch als Kirchenhistoriker, Forscher und Erfinder hervor.[72]
Eltz-Hoffmann bezeichnet das Pfarrhaus nicht nur als „Heimstatt von Dichtern und Denkern“[73], sondern auch als eine „[…] Keimzelle geistlichen und geistigen Lebens […], auf [dessen] Boden schöpferische Begabungen in reichem Maß zur Entfaltung kamen.“[74]
Schaut man nun zuerst auf die musischen Begabungen, dann ruht auch hier bereits wieder ein möglicher Anfang auf dem Reformator Luther, denn dieser war der Musik sehr zugeneigt. „[…] Luther verfolgte […] aufmerksam die musikalische Entwicklung […] und fühlte sich zu den führenden Komponisten seiner Zeit […] hingezogen.“[75] Zudem ist bekannt, dass Luther selbst Gemeindelieder schrieb bzw. umschrieb, von denen noch heute einige in Evangelischen Gesangbüchern zu finden sind. Gerne musizierte er auch selbst, wobei er vor allem das Spielen der Laute, aber auch den Gesang beherrschte und dies gerne gemeinsam mit seinen Kindern und seinen Tischgästen einsetzte.[76] Aber nicht nur Martin Luther war zu seiner Zeit von der Wirkung der Musik angetan. „[…] [B]is gegen Ende des 18. Jahrhunderts [wurde] die Musik in den Schulen und in der Öffentlichkeit ungleich intensiver gepflegt als heute.“[77] In diese Zeit passt auch die Entstehung der pietistischen Herrnhuter Brüdergemeine, in der die Musik als Gemeindeaktivität eine herausragende Rolle spielte. Im Evangelischen Gesangbuch ist über den Gemeine-Begründer Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf zu lesen, dass er „[m]it seinen ‚Singestunden‘, den Liturgien und Litaneien, mit seinen überquellenden Gesangbuchausgaben und den 2000 […] Liedern […] das geistliche Singen als emotionale und gemeinschaftbildende Glaubensäußerung verstanden [habe].“[78] Wie eine Vielzahl von literarischen Zeugnissen belegt, war es über lange Zeit eine übliche Selbstverständlichkeit, dass nicht nur in den Kirchen Musik erklang, sondern auch im Pfarrhaus Hausmusik betrieben wurde. So schrieb beispielsweise der „[…] ostpreußische Pfarrerssohn Theodor Gottlieb von Hippel […] von der ‚singenden Hausgemeinde‘ in seinem Elternhaus.“[79] Dass sich das Pfarrhaus zu einer „[…] lebendigen Pflegestätte der Musik entwickelte“[80], ist keineswegs nur der Gunst der Männer zu verdanken, denn gerade in diesem Bereich haben sich, wenn auch oft unerwähnt geblieben, die Pfarrfrauen beteiligt.
„[Das] 19. Jahrhundert hat dem Pfarrer nicht selten die solistische Mitwirkung der stimmlich begabten und ausgebildeten Pfarrfrau […] im Gottesdienst gebracht. Und es ist sicher, daß diese Bereicherung des Gottesdienstes den Gemeinden meist zur Freude geschah.“[81]
So ist es sicher auch den Pfarrfrauen zu verdanken, wenn der Theologe und Musikwissenschaftler Oskar Söhngen von dem Vorhandensein einer „[…] gute[n] musikalische[n] Erbsubstanz in den evangelischen Pfarrhäusern […]“[82] spricht, durch welches es auch bei Pfarrkindern nicht an musikalischer Begabung fehlte und fehlt. Nach Söhngen ist zwar die Zahl derer, welche sich als Komponisten hervorgetan haben, nicht sonderlich groß, dagegen setzt er jedoch, dass eine Vielzahl von Pfarrkindern sich seit der Einführung eines hauptberuflichen Kirchenmusikerstandes in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts zu einem Studium der Kirchenmusik entschließen.
Schaut man nun neben der Musik auf die Seite der Malerei, so kann man auch dort Begabungen im Pfarrhaus entdecken, auch wenn diese nicht so weitreichend zu sein scheinen wie im musikalischen Bereich. „Im 18. Jahrhundert machen sich Frauen wie nie zuvor in Literatur und Malereien einen Namen, sogar wenn sie mit einem Pfarrer verheiratet sind.“[83] Trotz hervorragender Beispiele im Bereich der Malerei, ist die literarische Begabung im Pfarrhaus weit mehr ausgeprägt bzw. belegt. Hier sind es aber meist nicht die Pfarrfrauen, sondern die Kinder des Hauses, welche sich dieser Kunst annehmen. Nach Eltz-Hoffmann ist besonders die Zahl der Poeten, welche einem evangelischen Pfarrhaus entstammen, beträchtlich.[84] „Allein bis zum Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich unter den namhaften Dichtern hundertfünfundneunzig Pfarrersöhne und acht Pfarrertöchter“[85], so Eltz-Hoffmann, welche hier der Meinung ist, dass nicht allein das Wort als Verkündigungsmittel[86], sondern auch der „[…] Umgang mit der Bibel […], in der bereits jene Verbindung von Religion und Poesie angelegt war, an der sich die dichterische Phantasie entzündete“[87], ein ausschlaggebender Punkt für die hohe Konzentration dichtender Pfarrkinder ist.
2.2.2. Resümee Kultur
Die Pfarrfamilie soll zum einen ein generelles kulturelles Interesse zeigen und insbesondere Befähigungen der Familie in den Bereichen Musik, Malerei und Schriftstellerei, die vorausgesetzt werden, zulassen und fördern. Zum anderen wird erwartet, dass solche Fähigkeiten auch für die Gemeindearbeit eingesetzt werden.
Sowohl die Schriftstellerei als auch die Musik haben gemeinsam, sofern es sich bei der Musik um singbares Liedgut handelt, dass sie einen geschickten Umgang mit dem Medium „Wort“ erfordern. So werden beide schon seit der Reformation als geeignete Instrumente zur Verkündigung des Evangeliums wahrgenommen und haben diesen Stellenwert über die Jahre nicht verloren.
2.3. Das Pfarrhaus als offene Burg
Diese Beschreibung geht auf Empfindungen von Menschen zurück, welche in Notsituationen ihres Lebens das Pfarrhaus als einen Ort des Asyls erlebt haben – Menschen, die die Mauern des Pfarrhauses als schützenden Burgwall und die Bewohner des Hauses als Gefahr abwendende Kämpfer empfunden haben. Diesen Ort des Asyls kann man grob in die zwei Bereiche Sozialstation und Zufluchtsort unterteilen, wobei in der Realität beide vermutlich nicht klar zu trennen waren.
2.3.1. Sozialstation
Es ist an vielen meist personengebundenen Beispielen belegt, dass das evangelische Pfarrhaus durch seine lange Tradition hindurch ein Ort der Fürsorge war. Beginnen kann man auch hier wieder im Schwarzen Kloster zu Wittenberg, dem Hause Luthers. Luther selbst sagte: „Sehe ich, daß er (mein Nächster; Anm. d. Verf.) hungert oder dürstet, so muß ich ihn nicht (im Hunger und Elend) lassen, sondern (muß ihn) speisen und tränken und nicht auf die Gefahr sehen, ob ich dadurch ärmer oder geringer werde.“[88] Es ist denkbar, dass dies zu einer der Grundregeln im Hause Luther gehörte, denn im Wittenberger Pestjahr 1527 leistete die Familie[89] Luther Hilfe bei der Pflege Pestkranker und deren medizinischen Versorgung. Hier wurde der Grundstein dafür gelegt, dass das Pfarrhaus auch weiterhin besonders in Zeiten schwerster Not einen hohen Stellenwert für die Gemeinde hatte – vor allem für die Kranken, denn auch viele Generationen nach Luther schien die Thematik der Pflege und medizinischen Versorgung eine immer wichtiger werdende Rolle zu spielen. Der Mediziner und Theologe Dietrich Rössler zitiert hierzu den Theologen Gerhard Uhlhorn:
„Die öffentliche Krankenversorgung gegen Ende des 18. Jahrhunderts war katastrophal. […] Hier mußte zunächst die Mentalität geändert werden und die Pfarrhäuser sollten zum Vorbild einer neuen und menschlicheren Zuwendung zum Kranken und einer besseren Auffassung von der Pflege werden.“[90]
Weiterhin bemerkt Rössler, dass die Pfarrhäuser gerade im Bereich der Pflege ihren Gemeinden zum Schulhaus geworden sind. Gerade im ländlichen Raum, in dem es auch zum Ende des 19. Jahrhunderts noch keine Möglichkeit der schnellen medizinischen Versorgung gab, war es „[wie selbstverständlich, daß] im Pfarrhaus, als dem kulturellen Mittelpunkt des Ortes […] auch in Krankheitsfragen vorgesprochen wurde.“[91] Obwohl die
„[…] Medizin […] zwar die objektiven Ursachen der Krankheiten schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem erstaunlichen Maße zu analysieren, zu erkennen und darzustellen vermocht[e, …] hat [sie] dabei die subjektiven Ursachen aus den Augen verloren. Deshalb ist es nicht zufällig, daß gerade zu dieser Zeit die Medizin im Pfarrhaus eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Das Pfarrhaus schien geeignet, die Dimensionen von Krankheit und Heilung wahrzunehmen, die die Schulmedizin bei ihrer Umformung zur Naturwissenschaft aufzugeben im Begriff war.“[92]
Es war jedoch nicht nur die Medizin, welche das Pfarrhaus oft zu einer Sozialstation machte. Denn ebenfalls bereits bei Luther hieß soziale Fürsorge auch soziale Fürsprache. „Wiederholt hat sich Luther als Bittsteller für Arme an die Obrigkeit […] gewandt.“[93] „[… D]ie soziale Aufgeschlossenheit vieler Pfarrhäuser[, die so handelten,] wirkte prägend und ansteckend.“[94] Auch im Dreißigjährigen Krieg waren es Pfarrhäuser, welche „[…] Stätten der Diakonie im täglichen Elend […]“[95] der Geschehnisse wurden. Allen voran ist hier das Pfarrhaus des Johann Valentin Andreä[96] zu nennen. So war lange Zeit bevor die evangelische Diakonie als berufliche Tätigkeit eingeführt wurde, das Pfarrhaus ein Ort des Dienstes an Kranken und Armen und ein Ort, an dem die christliche Nächstenliebe für jeden, der Beistand und Unterstützung suchte, praktisch erfahrbar war.[97]
2.3.2. Zufluchtsort
Zum Bild der offenen Burg gehört hier aber nicht nur das Pfarrhaus als Sozialstation, sondern auch das Pfarrhaus als ein Zufluchtsort. Christel Köhle-Hezinger, Kulturwissenschaftlerin, schreibt über den Zufluchtscharakter des Pfarrhauses: „[…] Pfarrhaus und Wirtshaus – beide übrigens Zuflucht für Fremde und Herbergssuchende: ersteres durch göttliches Gebot, letzteres durch Gesetz dazu verpflichtet – bildeten weithin sichtbar den Ortskern.“[98] Das Pfarrhaus war also kein Geheimtipp, der unter Hilfesuchenden weitergegeben wurde, sondern das Pfarrhaus war eine offenkundige Stätte der Zuflucht und des Asyls, welche „[…] von Menschen erfüllt [war], die in dieser Aufgabe weder der Angst noch der Drohung Raum gaben, sondern das Christuszeugnis mit allen Konsequenzen zu leben bereit waren.“[99]
Trotz drohender Todesstrafe wegen Fluchthilfe an Mönchen und Nonnen nahm Luther 1523 die entlaufenen Nonnen aus dem Kloster Nimbschen, zu denen auch seine spätere Frau Katharina von Bora zählte, in seiner Wohnstätte auf. Aber auch in den folgenden Jahren nahmen die Luthers immer wieder Bittgänger im Schwarzen Kloster auf, welche sonst auch wegen ihrer Armut keine andere Zuflucht gefunden hätten. Dieser Wesenszug des Pfarrhauses hat sich bis in unsere Zeit hinein erhalten und ist besonders in Zeiten von Krieg, Gewalt und gesellschaftlicher Einengung über die Maßen bedeutungsvoll gewesen. Gerade im letzten Jahrhundert, welches von zwei Weltkriegen und zwei Diktaturen erschüttert wurde, „[…] wurde [das Pfarrhaus] für viele zum Asyl, zum Ort, wo man letzte Hilfe suchte. Unzählige Male haben verfolgte Juden [in der Zeit des Dritten Reiches] hier Rückhalt und manchmal auch Versteck über die Gefahrenzeit der Deportationen hinweg gefunden.“[100] Ebenso bot das Pfarrhaus in der Zeit des geteilten Deutschlands besonders auf ostdeutschem Boden Menschen und Meinungen Asyl, die dem politischen Ideal der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) entgegenstanden.[101]
Pfarrer Theodor Schober forderte in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts, dass „[d]er Asylcharakter für Menschen, die sonst nirgends eine offene Tür erhoffen dürfen, […] nicht verlorengehen [darf].“[102] Diese Forderung Schobers geschieht gewiss eben auch angesichts der jüngeren deutschen Geschichte.
„Asyl sollte das Pfarrhaus immer gewähren; und nicht selten hat es sich in dieser zuweilen lebensrettenden Rolle auch bewährt, […] ob es um verfolgte Christen, Juden oder Deserteure unter der Naziherrschaft in der Bekennenden Kirche ging, ob schließlich sogar Ausbrecher oder Terroristen in den siebziger Jahren an Pfarrhaustüren klopften.“[103]
2.3.3. Resümee Das Pfarrhaus als offene Burg
Das evangelische Pfarrhaus als eine offene Burg, die immer für alle zugänglich ist und doch schützt, ist in der deutschen Geschichte in unterschiedlichen Epochen immer wieder von enormer Wichtigkeit gewesen. Daraus haben sich Erwartungen an das Pfarrhaus als Sozialstation und Ort des Asyls kristallisiert. Auch hier handelt es sich wieder um Erwartungen, die teils von außen an das Pfarrhaus und seine Bewohner gestellt werden, aber teilweise auch um Erwartungen, die sich im Inneren des Pfarrhauses entwickelt haben. Es soll ein immer erreichbares Haus sein, das für jeden offen ist, der Hilfe sucht, egal welchen Alters, Volkes oder welcher Religion er zugehörig ist – ein Haus, das niemanden abweist.
3. Pfarrfamilie als Idealbild und Maßstab
Mit dem Begriff ‚Pfarrfamilie‘ verbinden sich im Hinblick auf die Geschichte und die Gegenwart des evangelischen Pfarrhauses verschiedene Vorstellungen. Das Bild der traditionellen Pfarrfamilie beinhaltet meist Pfarrer, Pfarrfrau und eine nicht geringe Zahl an Pfarrkindern. In der gegenwärtigen Zeit ist das Bild einer Pfarrfamilie um einiges differenzierter und konstellationsreicher zu sehen.[104] Da sich das Kap. I jedoch vorwiegend mit der Herausbildung der historisch gewachsenen Erwartungen befasst, wird hier von dem o.g. traditionellen Bild einer Pfarrfamilie ausgegangen und erst im weiteren Verlauf der Arbeit Bezug auf die entstandenen und entstehenden Änderungen genommen.
Dieser Abschnitt soll nun ganz gezielt auf einzelne Bereiche des Pfarrhauslebens und der Pfarrhausbewohner eingehen, welche in den oben bereits ausgeführten Bereichen noch nicht abgedeckt wurden.
3.1. Pfarrfamilie
3.1.1. Die etwas andere Familie?
„[Das] Leben im Pfarrhaus ist eine öffentliche Angelegenheit. Der Gemeinde das Beispiel einer christlichen Ehe und Kinderzucht vorzuleben ist Teil des geistlichen Dienstauftrages […].“[105] Gestrich hat bei der Untersuchung von Amtsanweisungen für Pfarrer festgestellt, dass „[sich] [d]erartige Formulierungen […] in allen Amtsinstruktionen für die Pfarrer und pastoraltheologischen Entwürfe bis in [das 20.] Jahrhundert hinein [finden lassen].“[106] Angesichts solcher Anweisungen ist es verständlich, dass das Pfarrhaus seinen Bewohnern nicht selten als eine Bühne und ihr eigenes Leben als ein Theaterstück erscheint, in dem jedoch nicht sie selbst die Regie führen, sondern andere.[107] Sicherlich war das Haus des Pfarrers von jeher ein Haus, das intensiver beobachtet und vielleicht auch mit anderen Augen gesehen wurde. Über eine lange Zeit waren jedoch christliche Werte und eine christliche Lebensweise so präsent in der Gesellschaft und für alle Menschen in gleicher Weise gültig und nicht dem Pfarrer und seiner Familie vorbehalten, dass „[d]ie Pfarrfamilie […] erst zu einer Insel [wurde], als die übrige Welt Abschied nahm von einer christlichen Lebensführung, die jahrhundertelang von niemandem in Zweifel gezogen worden war.“[108]
In der vorbürgerlichen Gesellschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit war die Welt gläsern. Es konnte „[…] nichts unbemerkt [geschehen], weil sich alles in der Öffentlichkeit abspielt[e], vor den Augen der anderen und unter ihrer Kontrolle.“[109] Diese permanente Transparenz wendete sich mit der bürgerlichen Gesellschaft, in der das „[…] Haus […] davon [lebte], daß seine Innenseite nicht eingesehen, nicht beobachtet und nicht veröffentlicht werden [konnte].“[110] Nicht umsonst wird auch in unserer Zeit noch immer vom Pfarrhaus als „Glashaus“ gesprochen, denn im Pfarrhaus bleibt die Idee des vorbürgerlichen Hauses erhalten. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt möglich, „[d]ie Pfarrfamilie [zu einem] Bild [zu] stilisier[en], als dessen Abbild sich jede andere bürgerliche Familie begreift.“[111] Während das bürgerliche Pfarrhaus (und später auch das moderne) „[…] von anderen zum Vorbild erhoben [wurde], meist gegen den Willen seiner Bewohner“[112], wurde dieser vorbildliche Lebensstil, in Familie, Ehe und Lebensführung, ganz und gar das
„[…] Selbstverständnis des aufgeklärten Pfarrers und seiner Familie. Sie machten ihr Haus selbst zum Glashaus [und] [s]tilisierten sich selbst zum Vorbild. Während das bürgerliche […] Pfarrhaus also kein Vorbild, sondern ein Sinnbild anderer Häuser darstellt[e], machte sich das aufgeklärte Pfarrhaus zum Demonstrationsobjekt neuzeitlicher, vernünftiger […] Lebensführung.“[113]
Eine aufgeklärte Pfarrfamilie auf dem Land nutzt das alte Pfarrhaus, samt Garten und Nebengebäude in seiner anfänglichen Funktion – als einen „[…] landwirtschaftliche[n] Musterbetrieb“[114] für pädagogische Zwecke.
„Von der Kanzel klärt [der aufgeklärte Landpfarrer] die Bauern über Viehzucht und Fruchtwechsel auf. Nach dem Gottesdienst führt er sie durch Stall und Garten. Und am Abend schreibt er volkstümliche Bücher, Leitfäden der Bienenzucht.“[115]
Damit wird das ganze Leben des Pfarrers und seiner Familie zum idealen Vorführobjekt für die Umwelt. „Es ist der Pfarrer und seine Familie, über die protestantische Frömmigkeit, protestantische Lebenshaltung und Lebenskultur vermittelt wird.“[116] Der evangelische Theologe Wolfgang Steck ist der Meinung, dass erst durch dieses Selbstverständnis der Vorbildlichkeit während der Aufklärung die Pfarrfamilie, die Pfarrkinder und die Pfarrehe zu den „[…] moralischen und pädagogischen Vorbild[ern werden konnten], die sie seitdem geblieben sind.“[117] Martin Greiffenhagen, Politologe und Pfarrerssohn, ging mit der Forschung nach dem Ursprung der Vorbildlichkeit der Pfarrfamilie sogar noch ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit: „Mit der Aufhebung des priesterlichen Eheverbots nämlich geriet die gesamte Familie, der ganze Hausstand des Pfarrers unter den Anspruch dieses beispielhaften Lebens.“[118]
Die Pfarrfamilie ist oft jedoch nicht nur Vorbild für andere Familien gewesen, sondern sie wurde zu einem Idealbild von Familie erhoben. Die bürgerliche Gesellschaft konstruiert die Pfarrfamilie als ein Symbol des Familienbildes, indem sie diese zum „[…] Urbild der in der Familie symbolisierten Menschheit und Menschlichkeit“[119] macht. Die Pfarrfamilie der Aufklärung nimmt dieses Ideal genauso an wie den Charakter der Vorbildlichkeit:
„Wie vernünftig, natürlich und human mit den Kindern umzugehen ist, wie eine Ehe wahrhaft glücklich verläuft, wie das alltägliche Leben der Familie einzurichten ist, darüber verbreiten sich die aufgeklärten Geistlichen […] in Predigten und erbaulichen Büchern, in populären wissenschaftlichen Abhandlungen und in vielgelesenen Familienzeitschriften. Sie führen ihr eigenes Leben den anderen vor. Und sie erwarten von den anderen, daß sie so werden, wie sie selber sind, vernünftig, tugendhaft und damit glücklich.“[120]
Nicht erst seit der Aufklärung gilt für das Pfarrhaus, dass es nicht nur eine Stätte des Glücks, sondern auch „[…] eine ‚Wohnung des Friedens‘ sein mußte“[121]. „Dem Familienleben insgesamt wird Konfliktfreiheit und Harmonie verordnet – nicht nur per Erlaß ‚von oben‘, sondern auch durch den Erwartungsdruck der Gemeinde.“[122]
Das Pfarrhaus hat dabei nicht nur sich selbst und seine Bewohner geprägt, sondern auch immer wieder Vorlagen und Richtlinien geliefert und konnte sich daher nie aus der Prägung des Ideals befreien, die es aufgedrückt bekam. Hanselmann macht indes darauf aufmerksam, dass
„[es] [b]ei Lichte besehen […] dieses absolut ideale Pfarrhaus generell so nicht gegeben [hat]. Daß viel ehrliches Mühen und auch Gelingen in der angedeuteten Richtung vorhanden war, darf dankbar vermerkt werden. Wer jedoch die Geschichte von Pfarrehen und Pfarrfamilien etwa in alten Kirchenbüchern verfolgt, der findet dort jedenfalls exemplarisch alle menschlichen Schwächen, aber auch jedes Maß an menschlichem Leid verzeichnet.“[123]
3.1.2. Resümee Pfarrfamilie
Die Pfarrfamilie ist etwas Besonderes – hauptsächlich aus dem Grund, dass Erwartungen an sie gestellt werden, die in diesem Maße und mit diesem Nachdruck wohl an keine andere Familie herangetragen werden.
Es wird von der Pfarrfamilie erwartet, dass sie ein Vorbild für alle ist und zwar in allen Bereichen, ob nun in geistlicher oder weltlicher Dimension. Außerdem soll die Pfarrfamilie eine ‚Modellfamilie‘ sein – ein konfliktfreies Ideal, zusammengesetzt aus den fehlerfreien Eltern und den makellosen Kindern. Beide Erwartungen an das Pfarrhaus sind im Laufe ihrer Entwicklungsstationen in unterschiedlicher Weise benutzt und genutzt worden, um ein gesellschaftsfähiges Ideal zu haben oder der Lebensweise im Pfarrhaus eine allgemeine Tragfähigkeit zu verordnen.
3.2. Pfarrfrau
3.2.1. Die etwas andere Frau?
Keine andere Frau nimmt vermutlich so viel Anteil am Beruf ihres Mannes wie die Pfarrfrau und über keine der überhaupt teilhabenden Frauen sind so viele Bücher, Aufsätze und Artikel erschienen wie über die Frau des Pfarrers.
„Wohl in keiner anderen Gruppe des Bürgertums wurden der Frau derart spezifische, aus dem Beruf des Mannes abgeleitete Dispositionen abverlangt. […] Die Pfarrfrau muss das Familienleben seinem Geist nach mit der religiösen Berufsaufgabe des Mannes in Einklang bringen.“[124]
Seit ihrer ‚Entstehung‘ im Zuge der Reformation hat die Pfarrfrau auch aufgrund dieser hohen Ansprüche unterschiedliche Phasen der Gering- bzw. der Wertschätzung durchlebt. In der Zeit der Reformation wurden die Pfarrfrauen selbstverständlich mit in den Dienst am Pfarrvolk einbezogen, z.B. bei der „[…] Zuständigkeit für Kinder, Wöchnerinnen und Sterbende“[125]. Bereits im Zeitalter der Orthodoxie, welche sich am Ende des 16. Jahrhunderts theologiegeschichtlich der Reformation anschließt,
„[…] kommt […] die Pfarrfrau [bei Visitationen] meist schlecht weg. Sie wird als zänkisch und rechthaberisch geschildert; mische sich in Sachen, die nur den Pfarrer etwas angingen. An ihr liegt es, wenn die Ehe nicht harmonisch ist. Sie ist das ‚böse Weib‘ […]. Als höchste Tugend der Pfarrfrau werden [hier] genannt: Schweigen, Bescheidenheit, im Hause bleiben.“[126]
Die Pfarrfrau dieser Zeit scheint auf Haushaltsführung und Kinder beschränkt zu sein. In pietistischer Zeit änderte sich die Einstellung zu den Frauen allgemein und damit auch zur Pfarrfrau. Die führenden Männer des Pietismus lassen den Frauen einen wichtigen Platz zuteilwerden, indem sie Gemeindestunden für Männer und Frauen zur gemeinsamen Erbauung einführen. „In den Umkreis pietistischer Religiosität gehört [daher] eine andere Pfarrfrau, der vom Ehemann schon vor der Heirat gesagt wurde, daß sie in dieser Verbindung nicht schmückendes Beiwerk, sondern aktiver und eigenständiger Teil sein sollte.“[127] Im Zuge der Aufklärung wuchs auch das Interesse der Pfarrfrauen an Bildung und Kultur. So wurden im 18. Jahrhundert vermehrt weibliche Begabungen gefördert. In den Erwartungen der männlichen Zeitgenossen spiegelt sich dennoch die Erwartung wider, dass die Pfarrfrauen „[…] – bei aller Bildung – vor allem dem geschäftigen Gatten ein friedliches Heim schaffen [sollen], wo er von den Sorgen des Tages ausruhen kann.“[128] „Die ideale Pfarrfrau soll in erster Linie Gattin und Gefährtin ihres Mannes sein […]“[129], die „[…] belastbar und in ihrem Haushalt rastlos tätig […], anspruchslos und sparsam, ordentlich und reinlich, flexibel und anpassungsfähig“[130] ist. Bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte die normale Pfarrfrau einen großen Teil ihrer Aufgaben in der Haushaltsführung und der Bewirtschaftung des Pfarrgutes zu sehen. Gesellschaftlich betrachtet hatte sie vor allem mit Letzterem eine enorme Sonderstellung, da sie eine der wenigen Frauen war, welche ohne Proteste Aufgaben übernehmen durfte, die sonst den Männern vorbehalten waren. Neben der landwirtschaftlichen Arbeit gehörte dazu auch der Einkauf von Waren. Der Soziologe und Historiker Christian Graf von Krockow offenbart bezüglich der Aufgaben für die Pfarrfrauen in der Gemeinde: „Über die Möglichkeiten, in der ‚Gemeindearbeit‘ aktiv zu werden, darf man sich keine Illusion machen.“[131] Dies änderte sich mit der Einführung der festen Pfarrbesoldung im Laufe des 19. Jahrhunderts. „[D]ie Pfarrgüter [wurden] verpachtet[, so dass] [d]ie Landwirtschaft auch des Dorfgeistlichen […] sich mehr und mehr auf den (freilich großen) Pfarrgarten [beschränkte].“[132] Dadurch wurde die Pfarrfrau wesentlich in ihrem großen Aufgabenspektrum entlastet und übernahm nun des Öfteren Aufgaben in der Gemeindearbeit. Zudem „[…] stand [sie] dem Mann in seelsorgerlichen Fragen beratend zur Seite […] und wurde (, seit der Aufklärungszeit geistig immer mehr gebildet,) auch Gesprächspartnerin des Mannes.“[133] Ihre Aufgabe ist es auch, die seelsorgerliche Arbeit ihres Mannes durch das aufopferungsvolle, praktische Tätig sein zugunsten der Gemeinde zu unterstreichen.[134] Die Aufgaben, welche einer Pfarrfrau besonders in der gemeindlichen Arbeit zukamen, wurden im Zuge des Jahrhunderts reichhaltiger und vielfältiger. Theologin und Hochschulpfarrerin Brigitte Enzner-Probst nennt hier:
„[…] sozial-diakonische[…], bildungsbezogene[…] (Kindergruppen, Frauenkreise), musikalische[…] (Organistin, Kinderchor), med[izinisch]-fürsorgerische[…] (Gemeindeschwester), organisatorische[…] (Sekretärin) wie verkündigende[…] (Kindergottesdienst, Gebetsstunden) Aufgaben […].“[135]
Obwohl sie in erster Linie ihre Aufgabe im Haushalt zu sehen hat, soll sie auch das „[…] Muster des engagierten, kirchentreuen Gemeindemitglieds verkörpern.“[136] Daher überrascht es nicht, dass es bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts eine Pflicht der Pfarrfrauen in den deutschen Gliedkirchen war, auf einen eigenen Beruf zu verzichten.
3.2.2. Resümee Pfarrfrau
Der Theologe Friedrich Wintzer spricht von einem „[…] Bündel der Erwartungen an die Pfarrfrau, das bis heute in den Kirchengemeinden anzutreffen ist […].“[137] Dieses Bündel ist sicherlich auch gespickt mit Erwartungen, die das Aussehen, die Herkunft, das Alter und den Umgang der Pfarrfrau betreffen, an denen sich manche Geister scheiden. Zwei große Erwartungsfelder haben sich aber, abgesehen davon, hier herausstellen lassen:
Die Pfarrfrau soll teilhaben am Beruf des Mannes, in Form von unbezahlter Mitarbeit in der Gemeinde und immerwährendem Dasein für das Pfarrvolk, wann immer sie gebraucht wird. Zudem soll die Pfarrfrau eine Stütze für ihren Mann im Beruf sein und ihre Erfüllung in Haushalt, Kindererziehung und Gemeindearbeit finden.
3.3. Pfarrehe
3.3.1. Die etwas andere Ehe?
Mit den tiefgreifenden Änderungen der Reformation wurde die Pfarrehe auf legalen Boden gestellt. Eine große Zahl der evangelischen Geistlichen machte von dem neu erworbenen Recht Gebrauch und trat in den Ehestand ein.
„In der traditionellen Gesellschaft teilte die Mehrzahl der evangelischen Pfarrersehen mit der Mehrzahl aller anderen Ehen eine gewisse Distanz in den Partnerbeziehungen. Denn auch der evangelische Pfarrer heiratete (musste heiraten!) vielfach aus wirtschaftlichen Gründen.“[138]
In der Pfarrehe war es, wie in anderen Ehen der traditionellen Gesellschaft auch, nicht sonderlich üblich eine Liebesehe einzugehen. Meist wurde auf schriftlichem Weg oder über Dritte um eine zukünftige Frau geworben, sodass viele Frauen ihre zukünftigen Männer vor der Hochzeit oft nur unzureichend kennenlernen konnten.
„Nicht die ‚romantische Liebe‘ im modernen Sinne war das Band, das in der traditionellen Gesellschaft Ehen stiftete und zusammenhielt, sondern ‚christliche Tugend‘. […] ‚Christliche Tugend‘ – das bedeutete zunächst einmal Achtung vor der Person des anderen, Güte und Demut.“[139]
In den Zeiten der bürgerlichen Gesellschaft wurde bereits mehr Wert auf persönliche Zuneigung gelegt, wobei diese dennoch nicht an erster Stelle für die Partnerwahl ausschlaggebend war. „Die Eignung der Zukünftigen für ihren ‚Beruf als Pfarrfrau‘ wird mindestens so hoch bewertet wie persönliche Zuneigung.“[140] Die ideale Pfarrfrau soll demnach nicht nur tugendhaft den Haushalt führen, sondern sich auch mit dem Beruf des Ehemanns identifizieren können und bereit sein, sich in diesen Beruf einzufügen.[141] Daher ist es nicht erstaunlich, dass
„[f]ast ein Drittel der Geistlichen […] seine Ehefrau unter den Pastorentöchtern [fand], die von Hause aus mit dem Rollenbild der Pfarrfrau am besten vertraut waren. Die übrigen Pfarrer wählten ihre Frauen in der Regel aus kirchlichen Familien des restlichen Bürgertums […].“[142]
Sowohl in der traditionellen als auch in der bürgerlichen Gesellschaft ist der Altersunterschied zwischen den Pfarrern und ihren Bräuten meist sehr beträchtlich. Da die Frauen bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert nur selten über eine eigenständige, abgeschlossene Berufsausbildung verfügten, war das Eintreten in den Ehestand für sie auch der Beginn einer abgesicherten Versorgung.[143] „Sich mit einem Kandidaten oder gar Studenten zu verloben, bedeutete für die Braut ein hohes Risiko […]“[144], denn zum einen war hier nicht von einer gesicherten Versorgung auszugehen, da die jungen Männer noch keiner ausreichenden Erwerbstätigkeit nachgingen und zum anderen war die Braut bei einem möglichen Scheitern der Hochzeitspläne in der Verlobungszeit anschließend bereits zu alt, um weiterhin auf die Chancen einer Verheiratung zu hoffen. Eine besondere Eigenschaft der Pfarrehe war es also zu dieser Zeit, dass die Männer meist erst mit dem Beginn ihrer ersten festen Pfarrstelle, „[…] im Durchschnitt mit 30-33 Jahren […]“[145], heirateten bzw. erst nach Antritt der Stelle überhaupt auf Brautschau gingen, sodass der Altersunterschied zwischen den Eheleuten manchmal mehr als zehn Jahre betrug.[146] „Durch den großen Altersabstand konnten die Pfarrfrauen in Brautzeit und Ehe von ihren Männern geistig und religiös noch stark beeinflusst und den spezifischen Anforderungen der Pfarrfrauenrolle angepaßt werden.“[147] Besonders für die Pfarrfrau stellte es sich als Problem dar, dass sie durch die späte Heirat ihres Mannes in ein Beziehungsgefüge zwischen Pfarrer und Gemeinde hineintrat, das schon bestand, und daher unter besonderer Beobachtung der prüfenden Gemeinde stand. Wie alles andere, was im „Glashaus“ Pfarrhaus vor sich ging, war auch die Pfarrehe von jeher davon nicht ausgeschlossen – auch sie sollte musterhaft sein, sowohl im Entstehen als auch im Umgang miteinander und im Umgang mit den eigenen Kindern. „Die Pfarrerehe soll das Ideal guter Eltern verkörpern.“[148]
3.3.2. Resümee Pfarrehe
Die Ehe soll als die von Gott gegebene Institution des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau im Pfarrhaus vorbildlich gelebt werden, um anderen Ehen ein geeignetes Beispiel zu geben. Dazu zählt hier neben dem täglichen Umgang miteinander und der im nächsten Abschnitt näher beschriebenen Kindererziehung auch das Zustandekommen der Ehe durch Brautschau und Werbung. Dabei ist festzustellen, dass sich die gültigen Prinzipien für die genannten Faktoren durch die verschiedenen Epochen hindurch veränderten. Meist beeinflussten die gesellschaftlich vollzogenen Änderungen im Bereich der Ehe auch die Ehe im Pfarrhaus, sodass auch dort gesellschaftliche Normen neu definiert und gelebt wurden.
3.4. Erziehung im Pfarrhaus
3.4.1. Die etwas andere Erziehung?
Wie bereits zu Beginn des Kap. I, 3.1.1. Die etwas andere Familie? erwähnt wurde, hat das öffentliche Leben im Pfarrhaus auch eine große Auswirkung auf die Erziehung der Pfarrkinder und auf ihre Persönlichkeitsprägung. Jede gesellschaftliche Epoche hat ihre eigenen Ideale und Maßstäbe zum Thema der Erziehung hervorgebracht, welche sich manchmal an die Erziehungsideale der vorausgegangenen Epoche anknüpfen und sie weiterentwickeln, manchmal aber auch eine komplette Umkehrung der „alten“ Erziehungsregeln bewirkten. Diese gesellschaftlichen Ideale der Kindererziehung nehmen selbstverständlich auch großen Einfluss auf die Erziehung im Pfarrhaus. So wurde hier, wie in allen anderen Familien auch, lange Zeit auf die geschlechtsspezifische Erziehung Wert gelegt, die sich weitgehend auf das gesellschaftliche Modell der unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau bezüglich Arbeit und Lebensweise stützte. Im Vergleich zu anderen Häusern stellt das Pfarrhaus aber bereits hier eine Besonderheit dar. Gewöhnlich war für die Pfarrfamilie der väterliche Beruf maßgebend.[149] Im Gegensatz zu anderen Familien war in der Pfarrfamilie die Frau für die Bewirtschaftung von Hof und Haus zuständig[150], da sich der Mann allein dem geistlichen Auftrag zu widmen hatte[151]. Aufgaben, die ansonsten den Männern vorbehalten waren, kamen hier der Frau zu, während der Mann sich um die geistige Arbeit mühte.
„Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde im Pfarrhaus von frühster Kindheit an eingeübt. Die Jungen wurden ab dem dritten, vierten Lebensjahr vom Vater unterrichtet, hatten mit der Welt der Hausarbeit immer weniger zu tun; die Mädchen dagegen wurden weitgehend von der Mutter in ihrer Welt erzogen.“[152]
Grundsätzlich galt die Erziehung als
„[…] eine der vornehmsten und wichtigsten Aufgaben des Christen und damit des Pfarrers. Galt es doch, deren unschuldige Seelen zu bewahren und dem rechten Glauben zuzuführen. In wenigen anderen Familien bekamen die kleinen Kinder zu allen Zeiten so viel Aufmerksamkeit und Zuwendung gerade auch von den Vätern wie im Pfarrhaus.“[153]
Für die älteren Kinder stellte sich der Vater jedoch bald als ein entschiedener und rigoroser Lehrmeister dar.[154] Gestrich betont jedoch, dass man hier genau zwischen den aufgeklärten und pietistischen Pfarrfamilien differenzieren muss.[155] Die aufgeklärte Erziehung ließ den Kindern viel Freiraum, solange sich dieser mit Glauben, Moral und Umgangsformen vertrug. Die pietistische Erziehung hingegen „[…] exerzierte[…] teilweise die alttestamentarische Erziehungsmaxime ‚Züchtige deinen Sohn, weil Hoffnung da ist …‘ verbrämt im Gewand einer neutestamentlichen Errettungssymbolik.“[156] Vermischt mit dem strengen Beharren auf die Unerlässlichkeit eines außerordentlichen Bekehrungserlebnisses beschwor diese Art der Erziehung die eine oder andere Krise in der Entwicklung der Kinder herauf.
Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, insbesondere zwischen Vätern und Söhnen, ist im Kontext des Pfarrhauses immer wieder als besonders schwierig erlebt worden. Beispiele in der Geschichte gab es dafür ausreichend, so dass als Vertreter Gottfried Benn[157] und J.M.R. Lenz[158] genügen sollen. Mit der Verlagerung der Erziehung vom Elternhaus in die allgemeinen Schulen begann sich auch der bildungserzieherische Einfluss des Pfarrervaters auf seine Kinder zu verringern. Viele Pfarrerssöhne verbrachten daher ihre Jugendzeit in besonders hervorragenden Bildungseinrichtungen wie Seminaren und Stiften, was wiederum ebenso einen Einfluss auf das Verhältnis der Söhne zu ihren Vätern hatte. „Dem starken Vater der Kindheit folgte der entfernte Vater der Jugend.“[159] Besonders dieses frühzeitige Getrenntsein von der Familie, machte vielen Pfarrkindern immer wieder Probleme, da ihnen die Möglichkeit einer gesunden Abnabelung vom Elternhaus versagt blieb. Dennoch sollen die Kinder des „Glashauses“ zum Vorbild für andere Kinder geraten, weil auch sie Anteil haben am Beruf des Vaters und der damit verbundenen Aufgabe. „[Sie sollen] nicht frech sein oder laut, keine Affären haben und den Eltern Ehre machen (sonst ist der Vater als Pädagoge im Konfirmandenunterricht gleich blamiert.)“[160]
3.4.2. Resümee Erziehung
Je nach Epoche und den diesbezüglich gängigen Formen und Arten von Erziehung, ändern sich auch die Erziehungsstile im Pfarrhaus. Der Ansatz und der Weg, den die Erziehung nimmt, sind dabei recht unterschiedlich, aber die Erwartung an das Endergebnis ist dabei durchgehend doch sehr ähnlich. Gestrich fasst dies sehr treffend zusammen, wenn er sagt: „Um ‚Anstößiges‘ zu vermeiden, müssen Pfarrerskinder so sein, wie jeder Familienvater seine eigenen gerne hätte: bescheiden und gehorsam, wohlerzogen und erfolgreich in Schule und Beruf.“[161]
4. Fazit I
Das zurückliegende Kapitel hat sich mit unterschiedlichen Bereichen und Personen des Pfarrhauslebens beschäftigt und vielfältige Erwartungen herausgestellt. Bei manchen Erwartungen lässt es sich historisch relativ genau feststellen, wie sie entstanden sind bzw. entstanden sein könnten. Bei anderen Erwartungen dagegen müssen es vorerst Vermutungen bleiben. Einige Erwartungen scheinen von vornherein von außen, also von der Gesellschaft, an das Pfarrhaus herangetragen worden zu sein. Andere dagegen könnten sich aufgrund von Berufseinstellung und Lebenshaltung von Pfarrer und Pfarrfamilie direkt im Pfarrhaus selbst entwickelt haben. Es ist jedoch schwer auszumachen, ob sich die entstandenen Erwartungen wirklich teilweise im Pfarrhaus selbst entwickelt haben oder ob es sich hierbei bereits um Projektionen von Erwartungen handelt, welche von außen herangetragen wurden und mit den Vorstellungen der Pfarrhausbewohner und den Erwartungen an sich selbst verschmolzen.
Es ist zu beachten, dass die Palette der Erwartungen, die in diesem Kapitel herausgestellt wurden, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Vielmehr ist es so, dass es sich hierbei um Erwartungen handelt, die oft gestellt werden – in manchen Gemeinden mehr und in anderen weniger hartnäckig oder vielleicht sogar gar nicht. Dazu kommen noch regionale Unterschiede, sowie unterschiedliche Erwartungen im städtischen und im ländlichen Raum.
Kapitel II: Die heutigen Lebensumstände
Das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit setzt sich mit den gegenwärtigen Lebensumständen auseinander. Die entstandenen Erwartungen an das evangelische Pfarrhaus bestehen größtenteils auch heute noch. Jedoch lassen sie sich durch den gesellschaftlichen Wandel unter stetigen Entwicklungen nicht konfliktfrei mit den heutigen Lebensumständen vereinbaren.
Der erste Teil soll einen kurzen Überblick zur zeitlichen Einteilung geben. Was ist gemeint, wenn von ‚gegenwärtig‘ und ‚heute‘ gesprochen wird? Im zweiten Teil werden demographische Aspekte der gesellschaftlichen Veränderungen genauer betrachtet. Den Schwerpunkt des dritten und letzten Teils bildet insbesondere das Familienleben. Wenn im ersten Kapitel von Familie und Pfarrfamilie die Rede ist, muss nun bei der Betrachtung der Familien deutlich differenziert und genauer definiert werden, da sich wesentliche Unterschiede zu den vergangenen Jahrhunderten abzeichnen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass zahlreiche Aspekte innerhalb des Kapitels immer wieder aufeinander aufbauen und sich gegenseitig beeinflussen. Weiterhin erfolgt eine für die Arbeit angepasste Eingrenzung der soziologischen Themen.
1. Zeitliche Einteilung
Mit dem Begriff des ‚Heute‘ ist laut dem Rechtschreibwerk Duden die Gegenwart gemeint.[162] Unter Gegenwart versteht man eine Einordnung des zeitlichen Jetzt, denn das Jetzt befindet sich zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. „Aber das Heutige ist morgen von gestern; die Gegenwart verliert sich immer wieder, indem sie zur Vergangenheit wird, und deshalb muß sie unter dem Gesichtspunkt der Modernität immer wieder neu gegen die Vergangenheit behauptet werden.“[163] So gilt es, den Zusammenhang zwischen den Entwicklungen der Zeit und den damit verbundenen Erfahrungen zu betrachten.
1.1. Moderne und Postmoderne
Laut Philosoph Günter Figal ist die Moderne „[…] ein Epochenbegriff, der im Deutschen die spätere Neuzeit […]“ beschreiben will. Wichtiger als die genaue Kenntnis des Beginns der Moderne ist für Figal jedoch die Klärung des Sinngehaltes. „Modern ist die Erfahrung der Zeit als Kluft zw[ischen] der eigenen Gegenwart und dem Vergangenen.“[164] Somit gewinnt die Moderne, das Heutige, gegenüber dem Vergangenen eine wesentlich größere Bedeutung. Doch aufgrund der Schnelllebigkeit der Zeit ist auch die Gegenwart von einem auf den anderen Augenblick wieder vergangen. Dies ist beispielsweise an technischen Fortschritten erkennbar. „Mit den wiss[enschaftlichen] und technischen Innovationen der M[oderne] verlieren traditionelle Institutionen, Lebensformen und Maßstäbe ihre frühere Überzeugungskraft.“[165] Daher gilt es, diese Kluft zu schließen.
Mit einer Definition der Postmoderne verhält es sich ähnlich wie beim Begriff der Moderne. Soziologisch betrachtet wird dem Inhaltlichen mehr Gewichtung entgegengebracht als einer konkreten zeitlichen Einordnung. So wird, indem „[…] Verschiedenheit, Eigenart, Individualität und Vielfalt […]“[166] besondere Beachtung finden, die Intention der Moderne weiter konkretisiert.
1.2. Resümee Zeitliche Einteilung
Charakteristische Merkmale der Moderne sowie der Postmoderne sind unter anderem Innovation, Fortschritt und Mobilität. So gilt es, Orientierung zu finden, Gewissheit, Sicherheit und Verbindlichkeit zu erlangen in einer Zeit, in der vieles versucht und ausprobiert werden kann. In dieser Freiheit werden Traditionen in Frage gestellt und größtenteils entstehen Konfliktfelder zwischen Universalität und Individualität.
Diese Auswirkungen auf wirtschaftlicher, politischer, kultureller und besonders sozialer Ebene sollen im weiteren Verlauf der Arbeit betrachtet werden, wobei sich im Wesentlichen auf ausgewählte soziale Aspekte begrenzt wird.
2. Bevölkerungsentwicklung und Demographie
Wenn von einer Bevölkerungsentwicklung gesprochen wird, so muss sowohl der Begriff der Bevölkerung definiert als auch eine zeitliche Abgrenzung der Entwicklung vollzogen werden. Die deutschen Soziologen Rainer Geißler und Thomas Meyer haben demographisch und strukturell bedingte Veränderungen gemeinsam erarbeitet.
Zu Beginn ihrer Ausführungen halten sie fest: „Unter Bevölkerung versteht man die Gesamtzahl der Einwohner innerhalb eines politisch abgrenzbaren Gebietes.“[167] In diesem Kapitel der Arbeit werden demnach die modernen Lebensbedingungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. in den Jahren zwischen 1949 und 1989 der west- und ostdeutschen Gebiete genauer betrachtet.
2.1. Demographischer Wandel
Aufgrund unterschiedlicher sozialer Aspekte kommt es zu wirtschafts- und sozialpolitischen Bevölkerungsbewegungen innerhalb einer Gesellschaft. Für Deutschland[168] haben Geißler/Meyer vier große Faktoren, auch „Grundlinien der langfristigen Bevölkerungsentwicklung“[169] genannt, herausgestellt. Diese Grundlinien sind der Geburtenrückgang, gleichzeitig aber auch eine steigende Lebenserwartung. Weiterhin erfolgt in der Bevölkerung ein Alterungsprozess. Durch solch einen Wandel bedingte Zuwanderungen formen Deutschland zu einer multiethnischen Gesellschaft.[170]
2.1.1. Geburten und Lebenserwartung
Die Geburtenentwicklung der Nachkriegszeit war geprägt von einer Art Babyboom. Der Zweite Weltkrieg hatte viele Eheschließungen und Familienplanungen verhindert, welche in der Nachkriegszeit aufgrund der stabileren politischen und wirtschaftlichen Situation im Land nivelliert wurden. Darunter zählten zum großen Teil auch nachgeholte Eheschließungen. Das Familienleben nahm somit neue Formen an und zog damit weite Kreise. Sowohl von der Politik als auch von der Kirche wurde diese Familienform[171] unterstützt. Der Soziologe Rüdiger Peuckert schreibt hierzu Folgendes: „Nie zuvor war eine Form von Familie in Deutschland so dominant wie Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.“[172] „[Diese] verlangt von jedem Menschen die lebenslange, monogame Ehe. Der Sinn der Ehe erfüllt sich letztendlich in der Familiengründung.“[173] Da der überwiegende Großteil der Bevölkerung ganz selbstverständlich in dieser modernen Familienform lebte, entwickelte sie sich zu einem Leitbild heran.
[...]
[1] Vgl. Kantzenbach (²1991), 27.
[2] A.a.O., 27f.
[3] Vgl. Kantzenbach (²1991), 28.
[4] Ebd.
[5] Enke (1990), 8.
[6] A.a.O., 9.
[7] Unter dem Begriff Konkubinat versteht man ein eheähnliches Zusammenleben ohne Eheschließung.
[8] Kantzenbach (²1991), 37.
[9] Vgl. Enke (1990), 9.
[10] Wuschka (1987), 18f.
[11] Baur (1878), 62.
[12] Vgl. Angermann (³1939), 7f.
[13] Kantzenbach (²1991), 26.
[14] Vgl. Drews (1925), 55.
[15] Kantzenbach (²1991), 29.
[16] Köpf (42008), 164.
[17] Vgl. Kantzenbach (²1991), 37.
[18] Ebd.
[19] Marhold (²1991), 179.
[20] Gestrich (²1991), 76f.
[21] Vgl. Beck (2008), 268.
[22] Köhle-Hezinger (²1991), 271.
[23] Ebd.
[24] Vgl. Hübner (42008), 1193.
[25] Vgl. Gestrich (²1991), 74.
[26] Köhle-Hezinger (²1991), 260.
[27] Drews (1925), 59.
[28] Vgl. Köhle-Hezinger (²1991), 275.
[29] Kantzenbach (²1991), 37.
[30] Nipkow (42008), 1588.
[31] „Der Begriff Zweireichelehre [oder auch Zweiregimenten-Lehre] bezeichnet einen komplexen Sachverhalt: Es geht um die Stellung des Menschen vor Gott und vor der Welt […]. Worauf kommt es vor Gott und worauf vor der Welt an?“ (Honecker (1995), 15).
[32] Nipkow (42008), 1588.
[33] Janowski, J.C. (²1991), 103.
[34] Marhold (²1991), 179 zitiert nach Troeltsch (²1909), 539.
[35] Wallmann (42008), 1341.
[36] Beuys (²1991), 54.
[37] Bormann-Heischkeil (²1991), 167.
[38] Voll (²1992), 275.
[39] Drews (1925), 63.
[40] Vgl. Voll (²1992), 275.
[41] Vgl. Drews (1925), 63.
[42] Vgl. Voll (²1992), 275.
[43] Drews (1925), 65.
[44] Ebd.
[45] Vgl. ebd.
[46] Drews (1925), 65.
[47] Fertig (²1991), 197.
[48] Ebd.
[49] Ebd.
[50] Ebd.
[51] A.a.O., 196.
[52] Bormann-Heischkeil (²1991), 160 zitiert nach Werdermann (1935), 91ff.
[53] Gestrich (²1991), 69.
[54] A.a.O., 68.
[55] Eltz-Hoffmann (2001), 646.
[56] Bormann-Heischkeil (²1991), 161.
[57] Vgl. ebd.
[58] Gestrich (²1991), 78.
[59] Ebd.
[60] Ebd.
[61] Ebd.
[62] A.a.O., 75.
[63] Vgl. ebd.
[64] Bormann-Heischkeil (²1991), 160.
[65] Franz (1957), 35.
[66] A.a.O., 36.
[67] Ebd.
[68] Kenntnisse und Anwendung der lateinischen Sprache müssten zu einigen historischen Zeiten eher zur Allgemeinbildung gezählt werden. Aufgrund der gegenwärtigen Gegebenheiten wird davon im Erwartungsbild jedoch Abstand genommen.
[69] Zum Bereich der Allgemeinbildung gehörte in verschiedenen Epochen eine unterschiedliche umfangreiche Bildung in vielfältigen Bereichen. Um unnötige Ausdifferenzierung zu vermeiden, wird hier nicht noch explizit in die verschiedenen Epochen unterteilt.
[70] Hanselmann (²1992), 290.
[71] Steck (²1991), 110.
[72] Zu nennen wären hier: Georg Spalatin und Leopold Ranke als Historiker, Christian Ludwig Brehm als Forscher in der Ornithologie, Philipp Matthäus Hahn als Erfinder von astronomischen und Rechenmaschinen, Waagen und Uhren (Vgl. dazu: Brecht (1990), 4-17 und Franz (²1991), 277-294).
[73] Eltz-Hoffmann (2001), 646.
[74] Ebd.
[75] Söhngen (²1991), 297f.
[76] Vgl. a.a.O., 297.
[77] A.a.O., 300.
[78] EG (1995), 957 (Stichwort: Zinzendorf).
[79] Söhngen (²1991), 306f. zitiert nach Baur (³1884), 219f.
[80] Söhngen (²1991), 303.
[81] A.a.O., 307.
[82] A.a.O., 309.
[83] Beuys (²1991), 56.
[84] Vgl. Eltz-Hoffmann (2001), 646.
[85] Ebd.
[86] Ebd.
[87] Eltz-Hoffmann (2001), 646.
[88] Wolf (³2009), 77.
[89] Zur Zeit Luthers kann man mit dem Wort „Familie“ noch nicht die moderne Kleinfamilie assoziieren. Gemeint ist das ganze Haus, der ganze Haushalt, zu dem neben Eltern und Kindern viele Weitere gehörten. (Vgl. Steck (²1991), 114).
[90] Rössler (²1991), 237.
[91] A.a.O., 235.
[92] A.a.O., 232.
[93] Schober (²1991), 383.
[94] Ebd.
[95] Ebd.
[96] Andräe erlebte als Dekan in Calw den Dreißigjährigen Krieg mit. Er verlor selbst sein ganzes Hab und Gut. Dennoch war ihm der Dienst als Seelsorger, Pfleger und Fürsorger an seiner Gemeinde wichtiger als der Aufbau einer neuen eigenen Existenz. (Vgl. Schober (²1991), 384f.).
[97] Vgl. Schober (²1991), 383f.
[98] Köhle-Hezinger (²1991), 251.
[99] Schober (²1991), 380.
[100] Tödt (²1991), 374.
[101] Vgl. Weichlein (2010), 652.
[102] Schober (²1991), 393.
[103] Janowski, H.N. (²1991), 413.
[104] Vgl. Kap. II, 3. Familie im Wandel.
[105] Gestrich (²1991), 63.
[106] Ebd.
[107] Vgl. Steck (²1991), 110.
[108] Beuys (²1991), 52.
[109] Steck (²1991), 110f.
[110] A.a.O., 110.
[111] A.a.O., 118.
[112] A.a.O., 121.
[113] A.a.O., 121f.
[114] A.a.O., 122.
[115] Ebd.
[116] A.a.O., 112.
[117] Steck (²1991), 121.
[118] Greiffenhagen (²1982), 17.
[119] Steck (²1991), 118.
[120] A.a.O., 122.
[121] Gestrich (²1991), 66.
[122] Ebd.
[123] Hanselmann (²1992), 294.
[124] Janz (1994), 409.
[125] Enzner-Probst (42008), 1226.
[126] Beuys (²1991), 51.
[127] Beuys (²1991), 54.
[128] A.a.O., 56.
[129] Janz (1994), 406.
[130] A.a.O., 407.
[131] Krockow (²1991), 226.
[132] Gestrich (²1991), 74.
[133] Gestrich (²1991), 74.
[134] Vgl. Janz (1994), 409.
[135] Enzner-Probst (42008), 1227.
[136] Janz (1994), 409f.
[137] Wintzer (1982), 350.
[138] Gestrich (²1991), 64.
[139] A.a.O., 64f.
[140] Janz (1994), 405.
[141] Vgl. a.a.O., 416.
[142] A.a.O., 417.
[143] Vgl. Janz (1994), 414.
[144] Ebd.
[145] A.a.O., 419.
[146] Daraus resultierte natürlich auch das Problem der Verwitwung der Pfarrfrauen, auf das jedoch hier nicht weiter eingegangen werden soll. (Vgl. dazu a.a.O., 422-425).
[147] A.a.O., 421.
[148] Roessler (²1992), 191.
[149] Vgl. Goldschmidt (2001), 38.
[150] Vgl. Gestrich (²1991), 66.
[151] Vgl. ebd.
[152] A.a.O., 66f.
[153] Gestrich (²1991), 67.
[154] Vgl. ebd.
[155] Vgl. a.a.O., 67f.
[156] A.a.O., 68.
[157] G. Benn: Benn hat in seiner Kindheit oft Zurückweisungen und Kränkungen durch den Vater erlebt, der seine andersartigen Fragen und Geisteshaltungen als Unbegabtheit abwertete. Diese Haltung prägte lebenslang das Verhältnis Benns zu seinem Vater. (Vgl. Dyck (2009), 5-6).
[158] J.M.R. Lenz: Durch die Aufgabe des Theologiestudiums des Sohnes fühlte sich der strenge Vater, welcher pietistischer Pfarrer war, persönlich schwer angegriffen. In den heftigen Depressionen Lenz‘ verschwammen die Bilder des Gottes als Vater und des Vaters als Gott ineinander, welches er gleichzeitig liebte und bekämpfte. (Vgl. Gestrich (²1991), 69).
[159] A.a.O., 81.
[160] Bartels/Bartels (²1992), 31.
[161] Gestrich (²1991), 63f.
[162] Vgl. Bibliographisches Institut GmbH (2012).
[163] Figal (42008), 1377.
[164] Figal (42008), 1377.
[165] Ebd.
[166] Graf (42008), 1515.
[167] Geißler/Meyer (42006), 41.
[168] Diesen demographischen Wandel erlebten in ähnlicher Art und Weise auch andere industrielle Dienstleistungsgesellschaften.
[169] Geißler/Meyer (42006), 41.
[170] Vgl. ebd.
[171] Vgl. Kap. II, 3.1. Familienleben.
[172] Peuckert (72008), 16.
[173] A.a.O., 19.
- Quote paper
- Nicole Pagels (Author), Tina Fritzsche (Author), 2012, Das evangelische Pfarrhaus - ein Haus zwischen Himmel und Erde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203968