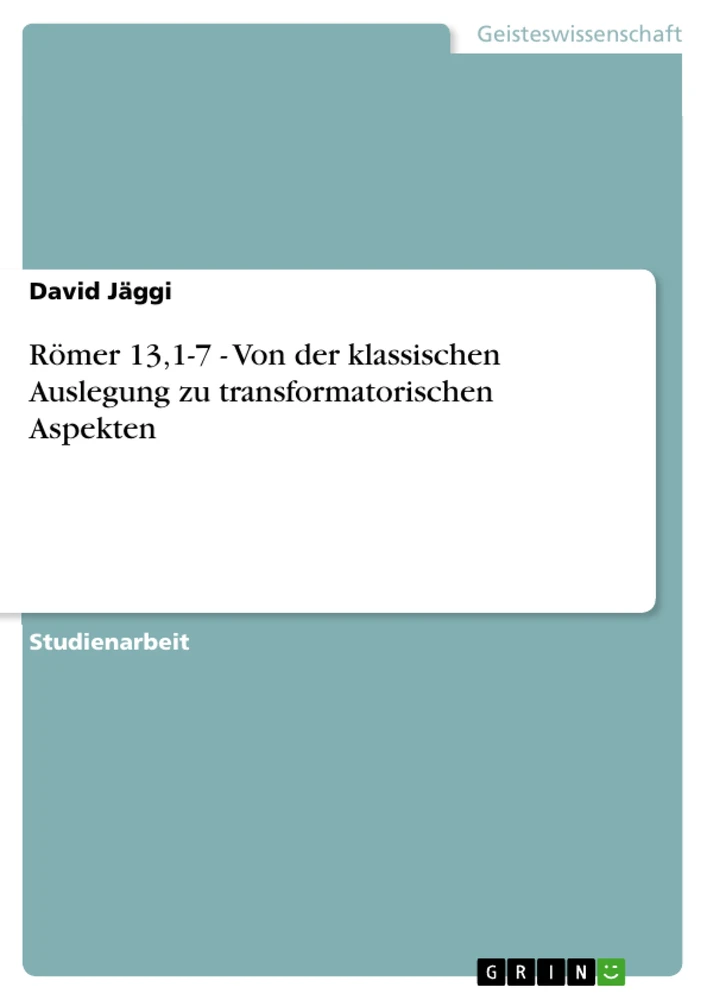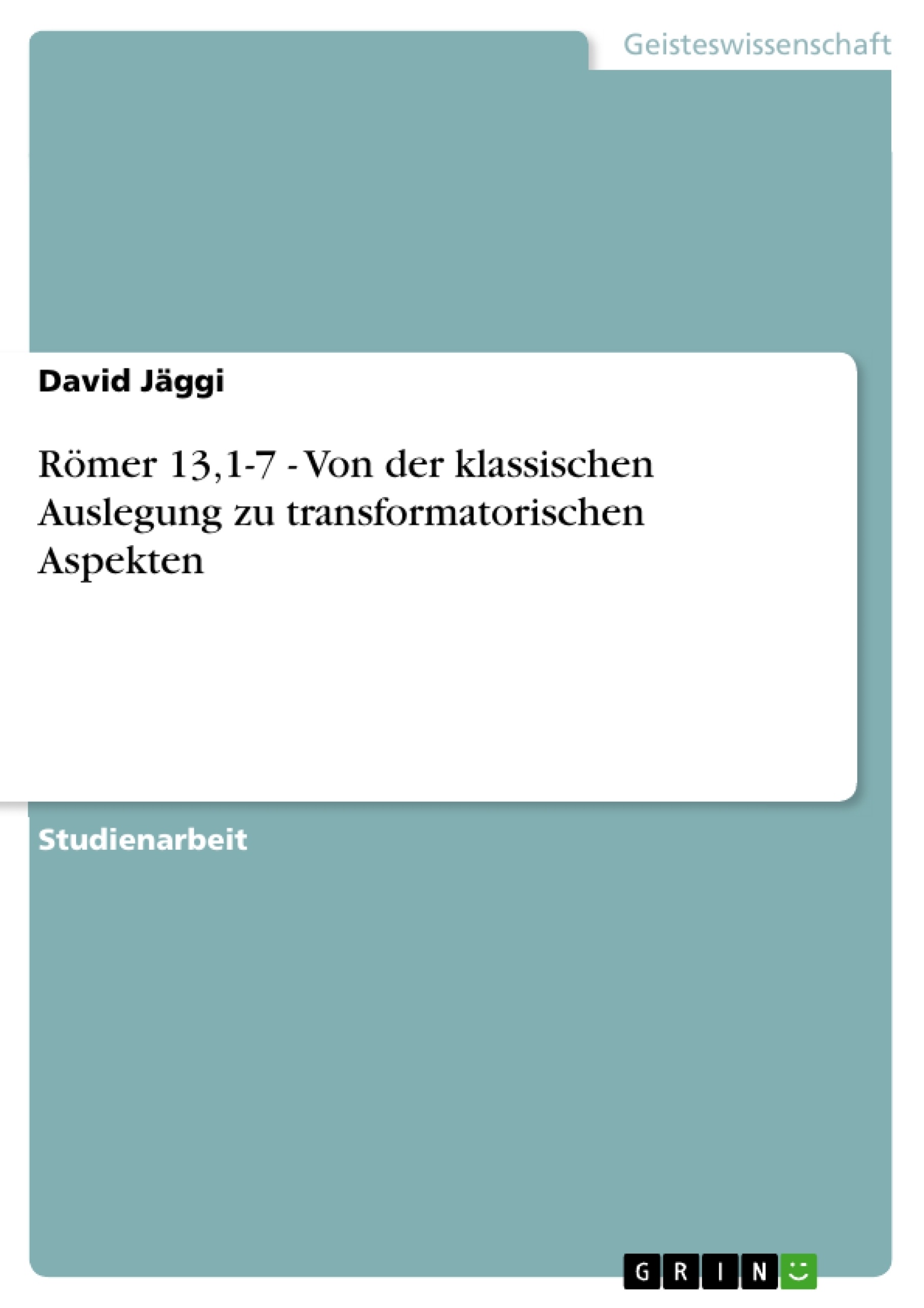Die Paränese Röm 13,1-7 hat die politische Ethik des Christentums massgeblich geprägt. Je nach zeitgeschichtlicher Epoche und politischem Kontext werden die Verse ganz unterschiedlich ausgelegt. Im europäischen Umfeld erfuhr Röm 13 insbesondere zur Zeit des 2. Weltkrieges weitreichende Bedeutung und löste einige Anfragen an die Christen aus, namentlich was das Recht zum politischen Widerstand betrifft. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten, heute noch durch die akademische Theologie konsultierten Konzeptionen.
Insbesondere aus den exegetischen Arbeiten zu Röm 13 entsteht allerdings der Eindruck, dass die Paränese zum Verhalten des Christen hinsichtlich der staatlichen Obrigkeit aus dem Gesamtzusammenhang von Paulus Anliegen herausgetrennt wird. Es kann nicht geleugnet werden, dass Paulus oft eher mit dem Bild eines Theologieprofessoren in Verbindung gebracht wird, welcher systematisch-theologische und ethische Antworten in komplizierten, aber geschickten Glaubenssätzen äussert, als mit einem feurigen Missionar, welcher ein ganz einschneidendes Erlebnis mit Gott gemacht hat (Apg 9,5), das sein Leben und sein Verhalten von Grund auf veränderte. Die Kapitel Röm 12-16 sind denn auch kein „add-on“, nachdem zuvor das Relevante, die individuelle Rechtfertigung durch Christus, bereits dargelegt wurde. Die Kapitel stellen im Gegenteil einen integralen Bestandteil des Briefes an die Römer dar. Paulus will aufzeigen, wie die Gläubigen in ihrem neuen Glauben leben können, nachdem ihr Leben durch den auferstandenen Jesus transformiert wurde. In diesem breiteren Zusammenhang muss auch Röm 13,1-7 betrachtet werden. Und so gelangt man zur Frage, wie dem Grundauftrag der Verantwortung und Mitgestaltung in dieser Welt, in der Schöpfung Gottes in der Jesus als König regiert, als Christ nachgelebt werden kann. Ein Einlassen auf die Probleme, Gefahren, die Gesellschaft oder die Politik dieser Welt wurde und wird teilweise als gefährliche Irrlehre bezeichnet (Dualismus).
Hinsichtlich dieser aufgeführten Tatsachen soll in vorliegender Konzeption in aller Kürze die traditionelle theologische Auslegung von Röm 13,1-7 betrachtet werden. Daran schliesst sich eine Auseinandersetzung mit den transformatorischen Aspekten der Paränese, wobei zuerst dargelegt werden soll, wie Paulus entgegen der herkömmlichen Sichtweise in seinem Anliegen auch noch verstanden werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Traditionelle Betrachtungen zu Röm 13,1-7
- Exegetisch
- Nach Otto Michel
- Nach Michael Theobald
- Ethisch
- Der Staat als Notwendigkeit in einer gefallenen Welt
- Die Verantwortung des Christen gegenüber dem Staat
- Exegetisch
- Von der Distanz zur Transformation
- Luthers „Zwei-Reiche-Lehre“
- Karl Barths „Christengemeinde und Bürgergemeinde“
- Paulus' Theologie aus anderer Sicht
- Das Anliegen von Paulus
- Paulus als leidenschaftlicher Missionar
- Der Bund
- König Jesus und das Evangelium
- Röm 12,1 als theologischer Angelpunkt
- Das Anliegen von Paulus
- Transformative Aspekte zu Röm 13,1-7
- Transformation vs. Distanz
- Transformation durch Nächstenliebe
- Transformation durch Tikkun Olam
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Paränese Römer 13,1-7 und deren Auswirkung auf die politische Ethik des Christentums. Sie beleuchtet die traditionellen Auslegungen im Kontext historisch-kritischer Exegese und setzt diese in Beziehung zu transformatorischen Ansätzen. Ziel ist es, ein differenzierteres Verständnis von Paulus' Anliegen und dessen Relevanz für das heutige christliche Leben zu entwickeln.
- Traditionelle und moderne Interpretationen von Römer 13,1-7
- Die Rolle des Staates in der christlichen Ethik
- Der Einfluss von Luther und Barth auf die Rezeption des Textes
- Paulus' Missionsverständnis und seine Relevanz für die politische Beteiligung
- Transformative Aspekte des christlichen Engagements in der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die vielschichtige und oft missbrauchte Interpretation von Römer 13,1-7 im Laufe der Geschichte, insbesondere im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Sie kritisiert die Tendenz, Paulus' Worte aus ihrem Gesamtkontext zu reißen und ihn eher als systematischen Theologen denn als leidenschaftlichen Missionar darzustellen. Die Einleitung legt den Grundstein für die Untersuchung traditioneller und transformatorischer Perspektiven auf den Text.
Traditionelle Betrachtungen zu Röm 13,1-7: Dieses Kapitel untersucht traditionelle exegetische und ethische Interpretationen von Römer 13,1-7, wobei die Ansichten von Otto Michel und Michael Theobald exemplarisch herangezogen werden. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung dieser Verse in unterschiedlichen politischen Kontexten ergeben haben, und die Debatte um den christlichen Widerstand gegen staatliche Autorität. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Verhältnisses zwischen Christen und Staat in einer "gefallenen Welt".
Von der Distanz zur Transformation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Gegensatz zwischen der traditionellen, oft auf Distanz zum Staat ausgerichteten Interpretation von Römer 13,1-7 und einem transformatorischen Ansatz. Es analysiert die "Zwei-Reiche-Lehre" Luthers und Karl Barths Konzept der "Christengemeinde und Bürgergemeinde", um unterschiedliche theologische Perspektiven auf das Verhältnis von Kirche und Staat zu verdeutlichen und die Entwicklung des Verständnisses von christlichem Engagement in der Welt aufzuzeigen.
Paulus' Theologie aus anderer Sicht: Dieses Kapitel untersucht Paulus' Anliegen hinter Römer 13,1-7 und präsentiert eine alternative Perspektive, die von seinem leidenschaftlichen Missionsverständnis und seinem Verständnis des Evangeliums ausgeht. Es betont die Bedeutung von Römer 12,1 als theologischen Angelpunkt und die Notwendigkeit, den Text im Kontext von Paulus' Gesamtwerk zu verstehen, um ein umfassenderes Bild seiner Theologie zu gewinnen und das Verhältnis zwischen Glaube und Handeln zu beleuchten.
Transformative Aspekte zu Röm 13,1-7: Dieses Kapitel konzentriert sich auf transformatorische Ansätze im Umgang mit Römer 13,1-7. Es vergleicht den Ansatz der Distanz mit dem der Transformation, wobei die Rolle von Nächstenliebe und Tikkun Olam als transformative Prinzipien betont werden, die das christliche Handeln in der Welt prägen. Es geht um die aktive Gestaltung der Gesellschaft im Sinne des Reiches Gottes.
Schlüsselwörter
Römer 13,1-7, politische Ethik, Christentum, Exegese, Transformation, Nächstenliebe, Tikkun Olam, Luther, Barth, Paulus, Staat, Widerstand, Mission.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interpretation von Römer 13,1-7
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Paränese Römer 13,1-7 und deren Bedeutung für die politische Ethik des Christentums. Sie untersucht traditionelle und moderne Interpretationen, um ein differenzierteres Verständnis von Paulus' Anliegen und dessen Relevanz für das heutige christliche Leben zu entwickeln.
Welche traditionellen Interpretationen von Römer 13,1-7 werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet traditionelle exegetische und ethische Interpretationen, unter anderem die Ansichten von Otto Michel und Michael Theobald. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung dieser Verse in verschiedenen politischen Kontexten ergeben haben, und die Debatte um christlichen Widerstand gegen staatliche Autorität.
Wie werden Luther und Barth in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit analysiert Luthers "Zwei-Reiche-Lehre" und Karl Barths Konzept der "Christengemeinde und Bürgergemeinde", um unterschiedliche theologische Perspektiven auf das Verhältnis von Kirche und Staat zu verdeutlichen und die Entwicklung des Verständnisses von christlichem Engagement in der Welt aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen traditionellen, oft auf Distanz zum Staat ausgerichteten Interpretationen und transformatorischen Ansätzen.
Welche alternative Perspektive auf Paulus' Theologie wird präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine alternative Perspektive auf Paulus' Anliegen, die von seinem leidenschaftlichen Missionsverständnis und seinem Verständnis des Evangeliums ausgeht. Sie betont die Bedeutung von Römer 12,1 als theologischen Angelpunkt und die Notwendigkeit, den Text im Kontext von Paulus' Gesamtwerk zu verstehen.
Welche transformatorischen Aspekte werden in Bezug auf Römer 13,1-7 betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf transformatorische Ansätze, die die aktive Gestaltung der Gesellschaft im Sinne des Reiches Gottes betonen. Die Rolle von Nächstenliebe und Tikkun Olam als transformative Prinzipien wird hervorgehoben, und der Ansatz der Distanz wird mit dem der Transformation verglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römer 13,1-7, politische Ethik, Christentum, Exegese, Transformation, Nächstenliebe, Tikkun Olam, Luther, Barth, Paulus, Staat, Widerstand, Mission.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, traditionellen Betrachtungen zu Römer 13,1-7, dem Übergang von Distanz zu Transformation, Paulus' Theologie aus einer anderen Sicht, transformativen Aspekten zu Römer 13,1-7 und einem Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenzierteres Verständnis von Paulus' Anliegen in Römer 13,1-7 und dessen Relevanz für das heutige christliche Leben zu entwickeln. Sie untersucht die traditionellen Auslegungen im Kontext historisch-kritischer Exegese und setzt diese in Beziehung zu transformatorischen Ansätzen.
- Quote paper
- David Jäggi (Author), 2012, Römer 13,1-7 - Von der klassischen Auslegung zu transformatorischen Aspekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203353