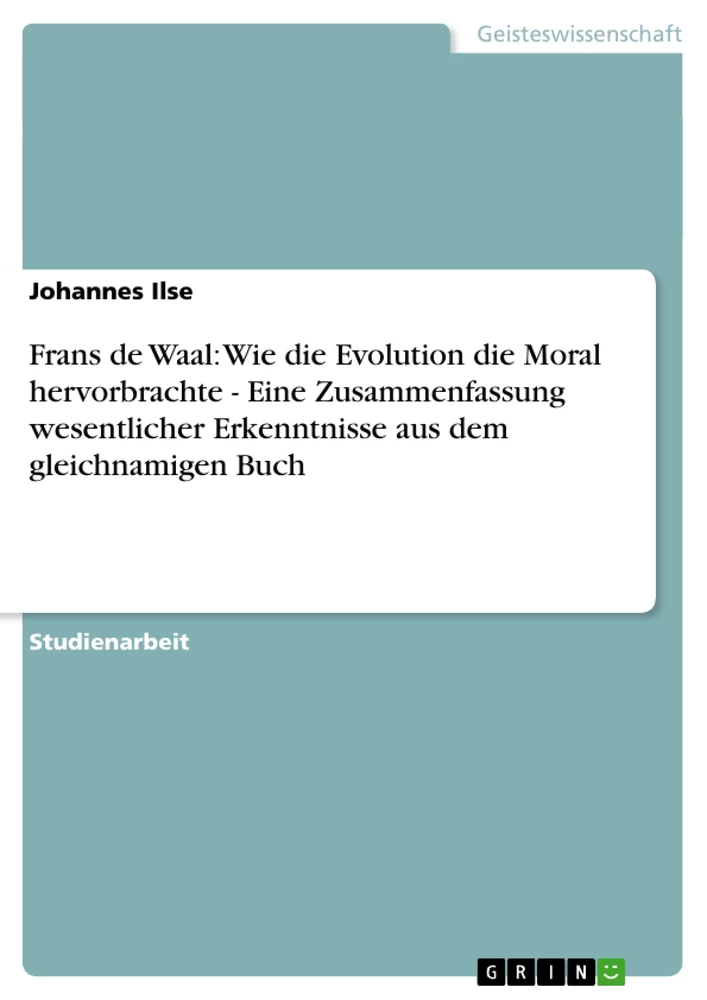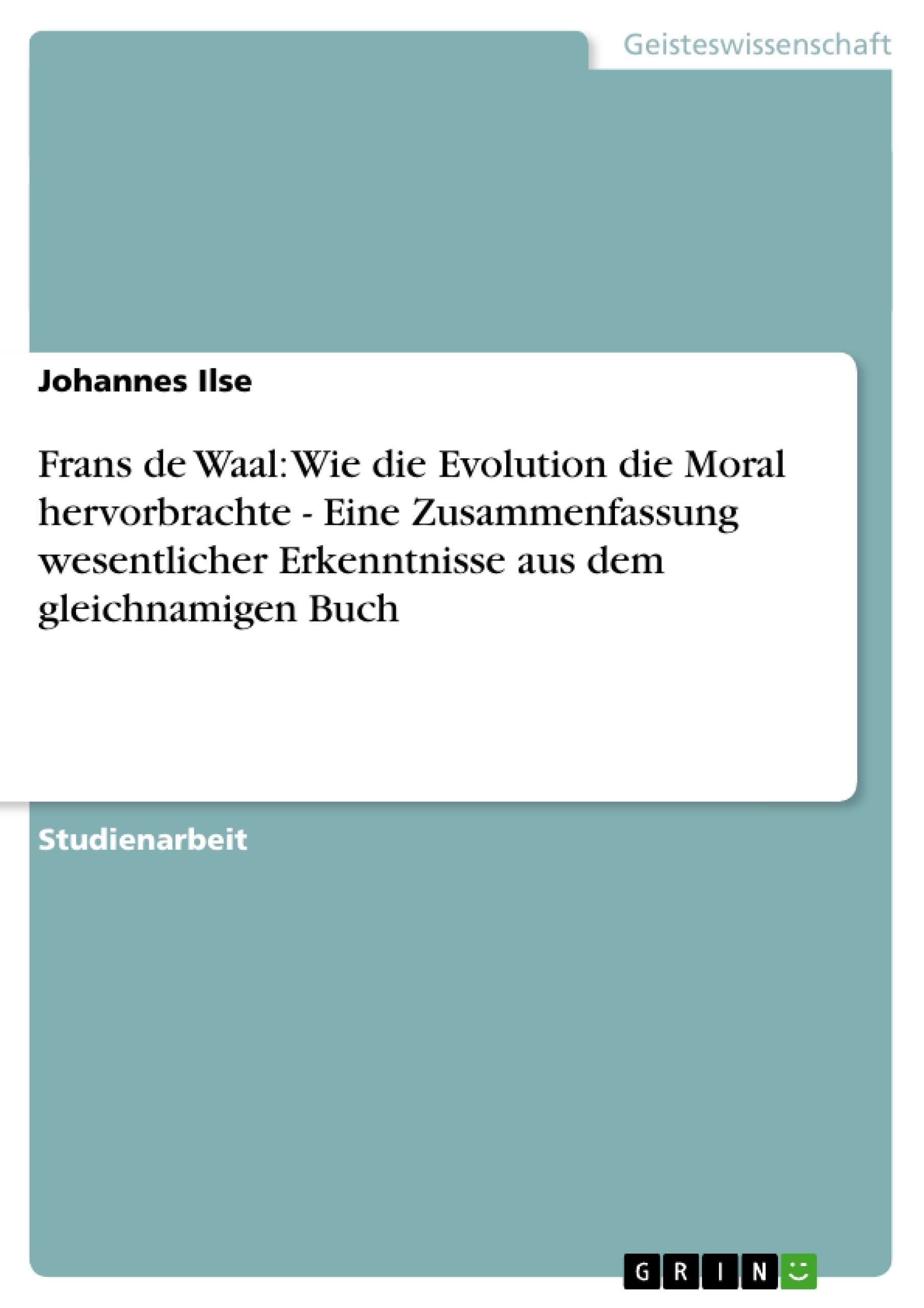Frans de Waal wurde 1948 in den Niederlanden geboren, ist Biologe und Primaten-Verhaltensforscher. In seiner Forschungsarbeit beschäftigt er sich seit den 1970er Jahren vor allem mit der sozialen Intelligenz von Schimpansen, Makaken, Bonobos und Kapuzineraffen. Während 1966 – 1973 studierte er an den Universitäten Nimwegen, Groningen und Utrecht Biologie und Ethologie. 1977 erwarb er seinen Doktortitel in Biologie an der Universität Utrecht. Ab 1988 arbeitete de Waal als Univ.-Prof. für Verhaltensforschung in Milwaukee, Wisconsin (USA). Seit 1990 ist er Prof. für Psychobiologie an der Emory-University in Atlanta (USA). Seit 1991 ist er außerdem Direktor des Living Links Center, dass sich mit der Evolution von Menschenaffen und Menschen beschäftigt.
Weltweit zählt de Waal zu den bekanntesten Affenforschern, nicht zu Letzt wegen seiner zahlreichen Fachpublikationen in Zeitschriften wie der Science und mehreren populärwissenschaftlichen Büchern, die in mehr als zwölf Sprachen übersetzt worden.
Er weist vor allem auf Parallelen im Verhalten von Menschen und Affen hin, die sich z.B. im Streitschlichten, der Moral und der Kultur beobachten ließen.
Inhaltsverzeichnis
1. Wer ist Frans de Waal?
2. Fassadentheorie vs. Evolutive Ethik
2.1 Huxley vs. Darwin
2.2 Edward Westermarck
3. Verhältnis zwischen Moral und Empathie – die Intuitionshypothese
4. Empathie
4.1 Der Unterschied zu Sympathie und Selbstmitleid
4.2 Formen des Altruismus
4.3 Eine Antwortmöglichkeit: Reziproker Altruismus
5. Verhältnis zwischen Empathie und Kognition – das Matroschka-Modell
6. Literatur
1. Wer ist Frans de Waal?
Frans de Waal wurde 1948 in den Niederlanden geboren, ist Biologe und Primaten-Verhaltensforscher. In seiner Forschungsarbeit beschäftigt er sich seit den 1970er Jahren vor allem mit der sozialen Intelligenz von Schimpansen, Makaken, Bonobos und Kapuzineraffen. Während 1966 – 1973 studierte er an den Universitäten Nimwegen, Groningen und Utrecht Biologie und Ethologie. 1977 erwarb er seinen Doktortitel in Biologie an der Universität Utrecht. Ab 1988 arbeitete de Waal als Univ.-Prof. für Verhaltensforschung in Milwaukee, Wisconsin (USA). Seit 1990 ist er Prof. für Psychobiologie an der Emory-University in Atlanta (USA). Seit 1991 ist er außerdem Direktor des Living Links Center, dass sich mit der Evolution von Menschenaffen und Menschen beschäftigt.
Weltweit zählt de Waal zu den bekanntesten Affenforschern, nicht zu Letzt wegen seiner zahlreichen Fachpublikationen in Zeitschriften wie der Science und mehreren populärwissenschaftlichen Büchern, die in mehr als zwölf Sprachen übersetzt worden.
Er weist vor allem auf Parallelen im Verhalten von Menschen und Affen hin, die sich z.B. im Streitschlichten, der Moral und der Kultur beobachten ließen.
2. Fassadentheorie vs. Evolutive Ethik
Im hier behandelten Text verteidigt de Waal die Ansätze Charles Darwins gegen eine Theorie, die sich bis auf Thomas Henry Huxley zurückführen lässt. Dabei argumentiert er, unter Verwendung seiner Forschungsergebnisse, für eine Verwerfung der sog. „Fassadentheorie“. Im Folgenden werden wir uns seine Argumente ausführlicher anschauen, zuvor jedoch einen kurzen Blick auf die widerstreitenden Theorien werfen.
2.1 Huxley vs. Darwin
De Waal stellt zwei Betrachtungsweisen vor, die auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben, was Moralität bedeutet und weshalb sie existiert.
Die erste Perspektive behauptet, dass Moralität durch die kulturelle Entwicklung des Menschen entstanden sei, ausschließlich von unserer Spezies vollbracht wurde und somit ein künstlicher Teil des menschlichen Wesens geworden ist. Irgendwann hätten wir uns zu Moralität entschlossen. Die Vertreter dieses Standpunktes gehen davon aus, dass wir im tiefsten Inneren unmoralisch sind. Moralität ist nur eine kulturelle Fassade, kratzt man ein wenig an ihr, zeigt sich der wahre Kern des Menschen – ein bösartiges, unmoralisches, eigennützig handelndes, asoziales Wesen.
De Waal nennt solche theoretischen Auffassungen deswegen zusammenfassend „Fassadentheorie“. Die Fassadentheorie lässt sich bis auf T. H. Huxley zurückführen, hat aber noch heute viele Fürsprecher.
Die zweite Betrachtungsweise sieht moralisches Verhalten als unmittelbare Folge sozialer Instinkte, die wir mit anderen Tieren teilen. Moralität ist also weder einzigartig menschlich, noch war sie eine bewusste Entscheidung zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern das Produkt der Evolution. Damit richtet sich diese Position u.a. gegen Speziesisten, Kontraktualisten und Deterministen.
Diese zweite Perspektive zum Ursprung und Wesen der Moralität wird von de Waal als „evolutive Ethik“ bezeichnet und persönlich von ihm, sowie von einer breiten Gruppe von Wissenschaftlern vertreten. Charles Darwin hat für diese Theorie mit seiner Evolutionstheorie den Grundstein gelegt.
Im Verlauf des bisherigen Seminars haben wir sowohl Huxleys, wie auch Darwins Standpunkt ausführlich besprochen, weshalb ich an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen möchte.
De Waal hat beide Ansätze nochmals zusammenfassend tabellarisch gegenübergestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[1]
Huxley sagt, dass es die Moral ist, die für das Wesen des Menschen essenziell ist. „Moralisch können wir nur werden, indem wir gegen unsere eigene Natur vorgehen.“[2]
De Waal plädiert für die evolutive Ethik Darwins und führt empirische Belege aus seiner Forschungsarbeit an, die gegen die Thesen von Huxley sprechen.
Ich möchte nun, an Darwins Ideen anknüpfend, einige Informationen über das Schaffen Edward Westermarcks geben, der mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen seiner Zeit weit voraus war.
2.2 Edward Westermarck
Er lebte von 1862 - 1939, war ein skandinavischer Anthropologe und überzeugt von Darwins Evolutionstheorie. Er stellte sich gegen den damaligen Zeitgeist, der in der dualistischen Tradition stand, Körper und Geist sowie Kultur und Natur als Gegensätze anzusehen. Als einer der Ersten vertrat er eine integrierte Sichtweise, die sowohl Menschen und Tiere, als auch Kultur und Evolution einschloss. Westermarck konzentrierte seine Forschungen nur auf den Menschen und war auf Anekdoten über das Verhalten von Tieren angewiesen, das seinerzeit nur wenig erforscht wurde.
Er erkannte, dass so genannte „retributive Emotionen“ als Eckpfeiler der Moralität begriffen werden müssen. „Retributiv“ ist hier sowohl als ausgleichende Gerechtigkeit zu verstehen, im Sinne von „Wie du mir, so ich dir“; als auch positiv, nämlich in Form von Dankbarkeit und Erwiderung von Wohltaten. Mit dieser Feststellung eröffnete Westermarck eine bis heute anhaltende Diskussion über evolutionäre Ethik und die Ursprünge der Moral.
Moral ist ihm zufolge fest in den natürlichen Neigungen und Sehnsüchten unserer Spezies verankert. Gefühle spielen eine zentrale Rolle. Sie seien nicht das Gegenteil von Rationalität, sondern unterstützten unser menschliches Denken. Ohne emotionale Gewichtung nütze auch das schärfste Denken nichts, denn ich käme nicht zu einer Entscheidung oder Überzeugung, die für die moralische Willensbildung so entscheidend sei, weil unser moralisches Verhalten nach festen Überzeugungen verlange.[3] Um solche Überzeugungen erlangen zu können, muss ich mich um andere sorgen können und über Intuitionen verfügen, die es mir erlauben rasch zu beurteilen, was richtig und falsch ist.
Die retributiven Emotionen unterteilt Westermarck in jene, die sich aus Unmut und Wut herleiten, also auf Rache und Bestrafung zielen, und solche, die eher positiv und prosozial sind, hierunter zählt er auch die moralische Zustimmung.
Zu Westermarcks Zeit waren nur wenige Beispiele für moralisches Empfinden bei Tieren bekannt - heute gibt es viele Belege für Parallelen im Verhalten von Menschen und Primaten. Zum Beispiel versöhnen sich Schimpansen nach Kämpfen durch umarmen und küssen und dieses Versöhnen dient dazu, den Frieden innerhalb der Gemeinschaft wiederherzustellen.
Westermarck betrachtete den Schutz anderer vor Aggression als Folge dessen, was er „mitfühlende Missbilligung“ nannte, was einschließt, dass ein solches Verhalten auf Identifikation und Empathie mit anderen beruht.[4] Schutz vor Aggression ist nach de Waal, bei Tier- wie Menschenaffen und vielen anderen Arten weit verbreitet, bei denen man sich für Verwandte und Freunde einsetzt.
Die retributiv freundlichen Emotionen haben offensichtliche Parallelen mit dem heutigen reziproken Altruismus, d.i. die Neigung gut zu denen zu sein, von denen wir Hilfe erfahren haben.
Hierzu hat de Waal geforscht und festgestellt, dass erwachsene Schimpansen, die einander zuvor groomten, mit höherer Wahrscheinlichkeit Nahrung teilen. Eine selbstkritische Erklärung wäre die Gute-Laune-Hypothese. Durch das Groomen seien die Affen gut gelaunt und teilten unterschiedslos mit allen Gruppenmitgliedern ihr Fressen.
Jedoch bestätigte sich seine zweite Erklärung: Die Schimpansen erinnern sich tatsächlich an die Artgenossen, die sie gegroomt hatten - davon kann man sprechen, weil zwischen groomen und Teilen der Nahrung zwischen 1,5 bis 2 Std. lagen - und teilten vermehrt mit diesen. Sie waren sogar vermehrt aggressiv gegen diejenigen, die sie zuvor nicht gegroomt hatten.
Man nennt dieses Verhalten einen „partnerspezifischen reziproken Austausch“. Diesem Prozess liegt ein gedächtnisgestützter Mechanismus zugrunde, den man beim Menschen als Dankbarkeit bezeichnen würde.
Gefühle wie Dankbarkeit oder Ablehnung betreffen unmittelbar die eigenen Interessen – wie man behandelt worden ist oder behandelt werden will – und sind daher zu egozentrisch, um moralisch zu sein. Aber der Dankbarkeit liegen spezielle Fähigkeiten zugrunde, die für moralisches Handeln entscheidend sind, z.B. ein hohes Toleranzniveau, Sensibilität für die Bedürfnisse anderer, reziproker Austausch und das sind in erster Linie empathische Prozesse, auf denen Moralität aufgebaut werden kann.
Westermarck war ein Vordenker, seine Vermutungen haben sich zum Teil durch heutige Forschung bestätigt.
Er hat außerdem nach den Ideen von David Hume neuformuliert, was eine moralische Empfindung moralisch macht. Moralische Empfindungen seien mehr als nur Bauchgefühle bzw. Intuitionen. Moralische Empfindungen zeichneten sich durch „Uninteressiertheit, augenscheinliche Unparteilichkeit und einen Anstrich von allgemeiner Verbreitung“[5] aus, d.h. Universalität, Objektivität, keine Beeinflussung durch Interessen.
[...]
[1] de Waal (2008)a : 41.
[2] Vgl. ebd.: 26.
[3] Vgl. ebd.: 36f.
[4] Ebd.: 37f.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Frans de Waal?
Frans de Waal ist ein niederländischer Biologe und Primatenforscher, geboren 1948. Er forscht seit den 1970er Jahren zur sozialen Intelligenz von Schimpansen, Makaken, Bonobos und Kapuzineraffen. Er ist Professor für Psychobiologie an der Emory-Universität in Atlanta und Direktor des Living Links Center.
Was sind die Hauptthemen, die Frans de Waal in seinen Arbeiten behandelt?
De Waal beschäftigt sich hauptsächlich mit Parallelen im Verhalten von Menschen und Affen, insbesondere in Bezug auf Streitschlichtung, Moral und Kultur.
Was ist die Fassadentheorie?
Die Fassadentheorie besagt, dass Moralität eine rein kulturelle Entwicklung des Menschen ist und eine Art "Fassade" darstellt, die unsere im Kern unmoralische Natur verbirgt.
Wer war ein prominenter Vertreter der Fassadentheorie?
Thomas Henry Huxley wird als ein wichtiger Vertreter der Fassadentheorie genannt.
Was ist die evolutive Ethik?
Die evolutive Ethik betrachtet moralisches Verhalten als eine Folge sozialer Instinkte, die wir mit anderen Tieren teilen. Moralität ist demnach ein Produkt der Evolution.
Wer hat den Grundstein für die evolutive Ethik gelegt?
Charles Darwin hat mit seiner Evolutionstheorie den Grundstein für die evolutive Ethik gelegt.
Wer war Edward Westermarck?
Edward Westermarck (1862-1939) war ein skandinavischer Anthropologe und Anhänger von Darwins Evolutionstheorie. Er betonte die Bedeutung von "retributiven Emotionen" für die Moralität und war überzeugt, dass Moral fest in unseren natürlichen Neigungen verankert ist.
Was sind "retributive Emotionen" nach Westermarck?
"Retributive Emotionen" beziehen sich sowohl auf ausgleichende Gerechtigkeit ("Wie du mir, so ich dir") als auch auf positive Aspekte wie Dankbarkeit und die Erwiderung von Wohltaten.
Was verstand Westermarck unter "mitfühlender Missbilligung"?
Westermarck betrachtete den Schutz anderer vor Aggression als Folge von "mitfühlender Missbilligung," was auf Identifikation und Empathie mit anderen beruht.
Was ist reziproker Altruismus?
Reziproker Altruismus ist die Neigung, gut zu denen zu sein, von denen wir zuvor Hilfe erfahren haben.
Wie hat Frans de Waal den reziproken Altruismus bei Schimpansen untersucht?
De Waal fand heraus, dass Schimpansen, die einander zuvor groomten, mit höherer Wahrscheinlichkeit Nahrung teilten. Dies deutet auf einen "partnerspezifischen reziproken Austausch" hin.
Welche Eigenschaften sind für moralisches Handeln entscheidend, laut de Waal in Bezug auf Westermarck?
Ein hohes Toleranzniveau, Sensibilität für die Bedürfnisse anderer und reziproker Austausch sind wichtige Eigenschaften, die auf empathischen Prozessen beruhen und für moralisches Handeln entscheidend sind.
Wie definierte Westermarck moralische Empfindungen?
Moralische Empfindungen zeichnen sich durch "Uninteressiertheit, augenscheinliche Unparteilichkeit und einen Anstrich von allgemeiner Verbreitung" aus, d.h. Universalität, Objektivität und keine Beeinflussung durch eigenen Interessen.
- Quote paper
- B.A. Johannes Ilse (Author), 2009, Frans de Waal: Wie die Evolution die Moral hervorbrachte - Eine Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse aus dem gleichnamigen Buch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203278