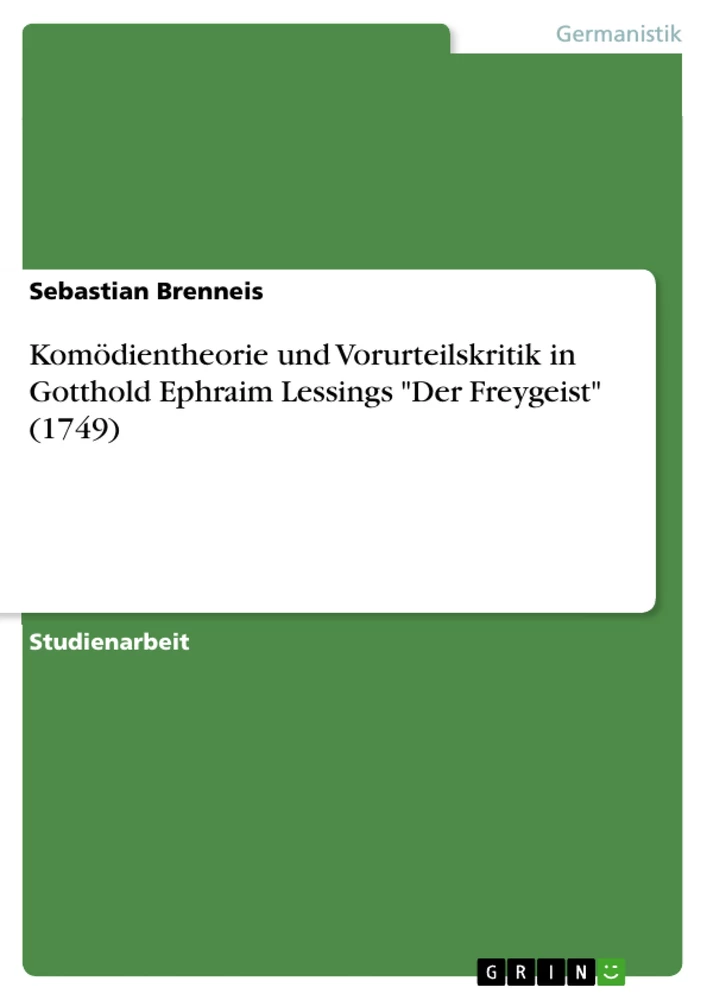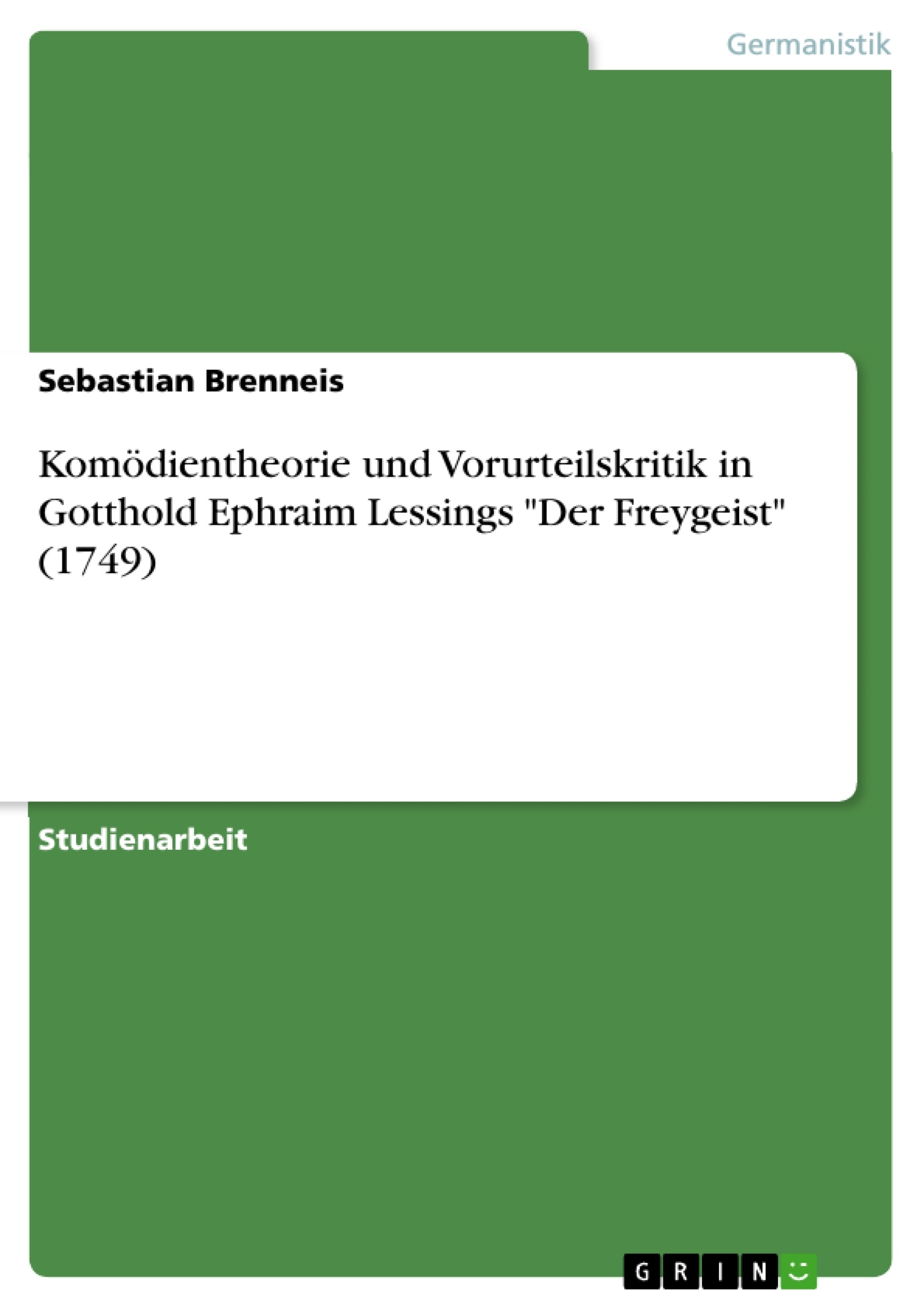Lessing war nicht nur vielschaffender Autor, sondern auch einer der aktivsten Poetologen der Aufklärung. Diese Arbeit nimmt eine kritische Analyse von Theorie und Praxis anhand Lessings "Freygeist" vor. Setzt er seine eigene Komödientheorie um? Welche Wirkungsästhetik liegt dem "Freygeist" zugrunde?
Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, wie Lessing seine Komödientheorie nutzt und alterniert, um sich an der zeitgenössischen Debatte um das 'Freidenkertum' zu beteiligen und Vorurteilskritik zu betreiben. Um zu verstehen, warum Lessing den Freigeist schrieb, wird zunächst das 'Freidenkertum' behandelt. Anhand Gellerts dritter moralischer Vorlesung, in der er über die «freygeisterische Moral» doziert, sollen die Charakterzüge des Stereotyps 'Freidenker' skizziert werden. Nachfolgend wird dann der Charakter des 'Freidenkers' Adrast in Lessings Stück in den Fokus gerückt.
Im Anschluss wird Lessings Komödientheorie in ihren Grundzügen erläutert und darauf eingegangen, wie er seine Theorie umsetzt und dadurch Vorurteilskritik betreibt. Obwohl das Einbeziehen weiterer Komödien wie Die Juden oder Nathan der Weise, in welchen Vorurteilskritik im Zentrum steht, durchaus lohnenswert und sicherlich ertragreich gewesen wäre, musste hier eine Beschränkung auf den Freigeist erfolgen, da der Rahmen dieser Proseminarsarbeit sonst sicherlich gesprengt worden wäre.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. 'Freidenkertum'
2.1. Gellerts 'Freidenker' als Spiegel eines zeitgenössischen Stereotyps
2.2. Ein Gegenkonzept: Lessings Adrast
3. Vorstellung und Wirklichkeit: Komödientheorie und Vorurteilskritik
4. Conclusio
5. Literaturangaben
5.1. Quellen
5.2. Forschungsliteratur
1. Einleitung
Die folgende Proseminarsarbeit entstand im Rahmen des Proseminars I: „Die Komödie der Aufklärung“ im Sommersemester 2011 am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg. Im Fokus dieser Arbeit steht Lessings Vorurteilskritik anhand des Stücks Der Freigeist. Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, wie Lessing seine Komödientheorie nutzt und alterniert, um sich an der zeitgenössischen Debatte um das 'Freidenkertum'[1] zu beteiligen und Vorurteilskritik zu betreiben. Um zu verstehen, warum Lessing den Freigeist schrieb, wird zunächst das 'Freidenkertum' behandelt. Anhand Gellerts dritter moralischer Vorlesung, in der er über die « freygeisterische Moral » doziert, sollen die Charakterzüge des Stereotyps 'Freidenker' skizziert werden. Nachfolgend wird dann der Charakter des 'Freidenkers' Adrast in Lessings Stück in den Fokus gerückt. Im Anschluss wird Lessings Komödientheorie in ihren Grundzügen erläutert und darauf eingegangen, wie er seine Theorie umsetzt und dadurch Vorurteilskritik betreibt. Obwohl das Einbeziehen weiterer Komödien wie Die Juden oder Nathan der Weise, in welchen Vorurteilskritik im Zentrum steht, durchaus lohnenswert und sicherlich ertragreich gewesen wäre, musste hier eine Beschränkung auf den Freigeist erfolgen, da der Rahmen dieser Proseminarsarbeit sonst sicherlich gesprengt worden wäre.
2. 'Freidenkertum'
2.1. Gellerts 'Freidenker' als Spiegel eines zeitgenössischen Stereotyps
In seiner dritten Moralischen Vorlesung Von dem Vorzuge der heutigen Moral vor der Moral der alten Philosophen, und von der Schrecklichkeit der freygeisterischen Moral [2] entwirft Gellert einen Stereotyp des 'Freidenkers', also eine Charaktermatrix, wie sie in zahlreichen literarischen Denunziationen dieser Person zur Zeit Lessings an den Tag trat. Nachdem Gellert den ersten Teil seiner Vorlesung, den Vergleich der alten und der neuen Moral, mit der Conclusio schließt, die neue Moral sei der alten nicht zuletzt wegen ihren Anleihen aus der göttlichen Offenbarung vorzuziehen, widmet er sich „dem System der freygeisterischen Moral“[3].
Nach Gellert konstituiert sich diese aus dem Grundsatz: „Suche dein Vergnuͤgen. Was dieses befoͤrdert, ist erlaubt und weise; was dich davon abhaͤlt, ist Thorheit, Furchtsamkeit und Aberglaube. Die Selbstliebe ist dein Gesetz;“[4]. 'Freidenker' sein bedeutet folglich nach Gellert zunächst Egoist zu sein. Alle Mittel und Wege, das eigene Vergnügen zu mehren werden durch eben diese Mehrung legitimiert. Dabei hat sich der 'Freidenker' zwangsläufig vom Pöbel zu separieren. Diese indoktrinierte Masse wisse nämlich nicht, was sie glaube. Daraus ergibt sich für den 'Freidenker' der Lehrsatz: „Was viele glauben, glaubet nicht“[5]. Damit bezieht sich Gellert offenbar auf die Orthodoxie, denn er fährt damit fort, dass der 'Freidenker' der Natur zu folgen habe. „Was jeden ruhig macht, ist jedem sein Gesetze; / Mehr glaubt und braucht ein Kluger nicht.“[6]. 'Freidenker' sein heißt damit auch, sich von jeglichen Leitlinien, seien sie juristischer oder moralischer Natur, loszusprechen, sofern sie konträr zu den eigenen Vorstellungen verlaufen. Die Konsequenz daraus sei dann ein Ringen um das eigene Vergnügen. Indem Gellert den 'Freidenkern' den Gott der Orthodoxie abspricht und ihn mit Eigennutz, Selbstliebe und dem Vergnügen der Sinne substituiert, macht er den 'Freidenker' erhaben über jegliche göttliche Instanz. Die Folge daraus, „keine ewige Belohnung oder Strafe“[7] erwarten oder fürchten zu müssen, ist ein Perpetuum mobile, das er als „Ewiger Krieg des Eigennutzes“[8] klassifiziert. Dieser findet statt in einer „Gesellschaft der Betrüger, der Undankbaren, der Meyneidigen, der Raüber, der Mörder, der Blutschänder, der Gottesleugner“, final summiert als „Feinde der Menschen und Gottes“[9]. Interessanterweise setzt Gellert die Moral all jener, welche die geoffenbarte Religion ablehnen, zunächst nicht zwangsläufig mit der Moral der 'Freidenker' gleich. Faktoren wie „äußerliche Umstände, in denen sie sich befinden, ihr persönlicher Charakter und [...] wohlthaetige[n] Eindruecke [...] der Religion[...]“[10] können nach ihm dafür verantwortlich sein, dass deren Moral der 'freidenkerischen' nicht in Gänze gleiche. Letztlich münde aber jede Moral durch die 'Freidenkerei' in der oben Skizzierten. Erst in Annäherung des Todes würde der Freygeist seine Verfehlung erkennen und seine eigene Lebensweise ablehnen. Sei man aber im „Taumel der Leidenschaften“[11] gefangen, verhülle sich das Gewissen.
Der Apologetiker Gellert zeichnet den 'Freidenker' also als eine Persona non grata, als eine Gefahr für Bürger und Staat. Daraus entsteht der Stereotyp des egoistischen, keine Grenzen kennenden Religionsfeinds, der nichts scheut, um seinen Eigennutz zu steigern[12]. Lessing hingegen war allerdings auch bestens vertraut mit der „nicht von religiöser Propaganda verfälschte[n] und verzerrte[n] Freigeisterei“[13]. Wie Nisbet anmerkt, sah das Lessing´sche Umfeld, allen voran sein Vetter Mylius, die
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Freigeisterei nicht als pauschale Ablehnung der Religion [zu verstehen], sondern lediglich als wohlüberlegter Gebrauch der eigenen Vernunft und als Weigerung, sich ein Dogma irgendwelcher Art gedankenlos zu eigen zu machen“.[14]
2.2. Ein Gegenkonzept: Lessings Adrast
Lessings Der Freigeist handelt von dem 'Freidenker' Adrast und dem Theologen Theophan, die beide um die Töchter des Lisidor werben und deren friedvolles Miteinander zunächst von unüberbrückbaren persönlichen Differenzen verhindert zu sein scheint. Diese Differenzen stellen sich jedoch bald, als Folge von Theophans Initiative, als Irrtum heraus und deren Beseitigung ebnet den Weg für zwei glückliche Hochzeiten. Folglich nutzt auch Lessing den Charakter des Freidenkers in seinem gleichnamigen Stück Der Freigeist, allerdings in alternierter Form. Welches 'Freidenkerbild' Lessing zeichnet, soll im Folgenden gezeigt werden.
Schon im Dramatis Personae wird Adrast dem Leser als 'der Freigeist' vorgestellt, für den Religion (die er pauschal mit Irrtümern gleichsetzt) nur etwas für den Pöbel ist und als Stütze des Staates dient[15]. Es hat also zunächst einmal den Anschein, als hätte man hier ein Stück zu erwarten, dass in der Tradition der Typenkomödie verwurzelt ist. Die Exposition des Stücks verstärkt diesen Eindruck. Dem Leser wird bereits im ersten Redebeitrag vermittelt, dass das Geschehen maßgeblich von der gattungstypischen Heiratshandlung bestimmt sein wird. Zusätzlich leitet Lessing einen Konflikt zwischen Adrast und Theophan ein, der sich durch das gesamte Stück entwickelt und maßgeblich von Adrast aufrecht erhalten und von Theophan beeinflusst wird. Im Hinblick auf die ausstehenden Hochzeiten zeigt Theophan sein Interesse an Versöhnung mit den Worten: „Bedenken Sie doch, Adrast! Können wir noch dringender eingeladen werden, uns zu lieben, und eine Freundschaft unter uns zu stiften, wie sie unter Brüdern sein sollte?“[16] Adrast hingegen zeigt kein Interesse an einer Freundschaft. Vielmehr unterstellt er seinem künftigen Schwager mit dessen Bestreben Unaufrichtigkeit, indem er behauptet: „Gleichgültig wollen wir einander bleiben. Und ich weiß, eigentlich wünschen Sie dieses selbst.“[17] Früh schon erweckt Lessing damit den Eindruck, dass Adrast ein Skeptiker ist und initiiert damit einen Charakterzug, der ihm bis kurz vor Schluss anhaften wird. Bohnen hält dahingehend trefflich fest, dass „Zwischen dem Freigeist und dem Theologen [scheinen] alle Bindungen von vornherein zerrissen“[18] scheinen.
[...]
[1] Eine wahrhaft ausführliche Analyse der Etymologie und Spielarten des Begriffs 'Freidenker' gibt: Wild, Reiner: Freidenker in Deutschland. In: Zeitschrift für historische Forschung 1979 [1], S. 253-285.
[2] Gellert, Christian Fürchtegott: Gesammelte Schriften. Kritische, kommentierte Ausgabe. (Hrsg.): Bd. VI: Moralische Vorlesungen. Moralische Charaktere. Hrsg. von Sibylle Späth. Berlin, New York: de Gruyter, 1992, S. 33-48.
[3] Gellert: Gesammelte Schriften, S. 44.
[4] Ebd., S. 44.
[5] Ebd., S. 44.
[6] Ebd., S. 45
[7] Ebd., S. 45.
[8] Ebd., S. 45
[9] Ebd., S. 45.
[10] Ebd., S. 46.
[11] Ebd., S. 46.
[12] Von einem poetologischen Standpunkt aus würde sich der 'Freidenker' nach Gellert daher bestens in den Figurenkanon der sächsischen Typenkomödie einreihen und als der aufgrund seiner Eigenschaften zu Verlachende fungieren.
[13] Barner, Wilfried; Grimm, Gunther E.; Kiesel, Helmuth: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. München: C.H. Beck, 1998, S. 129.
[14] Nisbet, Hugh Barr: Lessing. Eine Biographie. München: C.H. Beck, 2008, S. 53.
[15] Lessing, Gotthold Ephraim: Der Freigeist. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen verfertigt im Jahre 1749. Nachwort und Anmerkungen von Klaus Bohnen. Stuttgart: Reclam, 2005, 6f..
[16] Ebd., S. 6.
[17] Ebd., S. 6.
[18] Bohnen, Klaus: Nachwort zu Lessing, Gotthold Ephraim: Der Freigeist. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen verfertigt im Jahre 1749. Stuttgart: Reclam, 2005, S. 101-117, S. 105.
- Quote paper
- Sebastian Brenneis (Author), 2011, Komödientheorie und Vorurteilskritik in Gotthold Ephraim Lessings "Der Freygeist" (1749), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203104