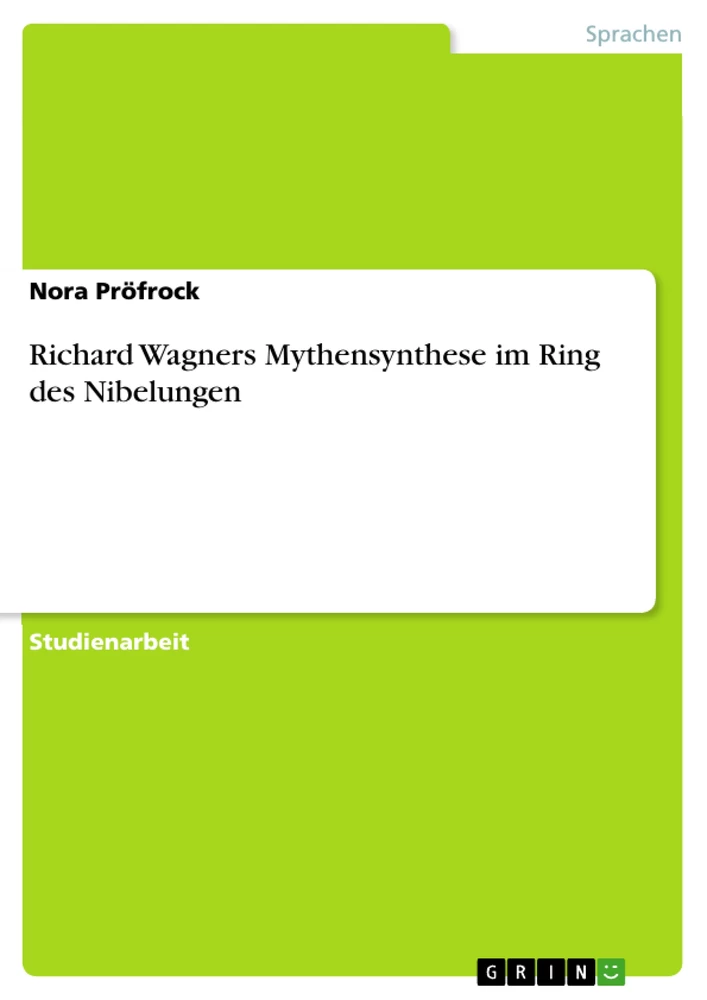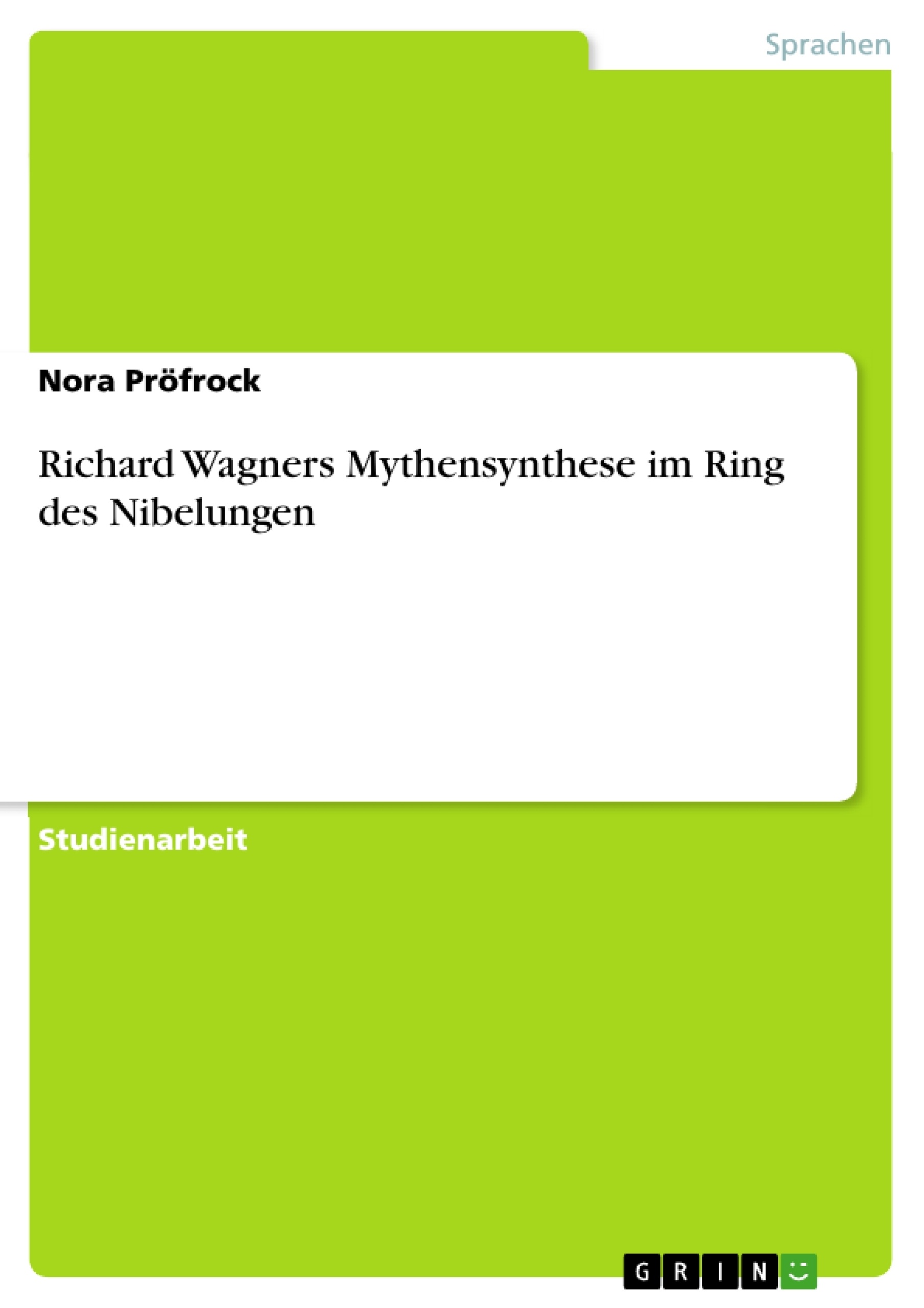Gegenstand dieser Arbeit ist Richard Wagners Rezeption des Nibelungenstoffes in Form seiner 1863 zum ersten Mal offiziell erschienenen Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Bei der Schaffung dieses Werkes hat Wagner eine Technik verwendet, die Volker Mertens „Mythensynthese“ nennt und folgendermaßen beschreibt: „Er fügt eine Zahl unterschiedlicher, teils aus verschiedenen Traditionen stammender, teils selbsterfundener Mythen zusammen zu seinem neuen Mythos“. Im folgenden sollen zunächst die wichtigsten der mittelalterlichen Quellen, auf die Wagner bei der Schaffung dieses neuen Mythos zurückgegriffen hat, und die Art und Weise, wie er dabei mit diesen Quellen umgegangen ist, genauer betrachtet werden. Des weiteren werden Texte aus der wissenschaftlichen Literatur zu Wagners Zeit und die Art und Weise, wie diese Texte möglicherweise seine Schaffensweise beeinflusst haben, zu untersuchen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wagners mittelalterlichen Quellen
- Das Nibelungenlied
- Die Lieder-Edda und die Snorra-Edda
- Die bioreks Saga und die Völsunga Saga
- Wagners „Sekundärliteratur“
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Richard Wagners Rezeption des Nibelungenstoffes in seiner Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“. Die Zielsetzung besteht darin, Wagners Quellen und die Art und Weise seiner Mythensynthese zu analysieren. Hierbei wird sowohl auf mittelalterliche Quellen als auch auf die wissenschaftliche Literatur seiner Zeit eingegangen.
- Wagners Verwendung mittelalterlicher Quellen (Nibelungenlied, Eddas, Sagas)
- Analyse von Wagners „Mythensynthese“ und seinem Umgang mit den Quellen
- Der Einfluss der zeitgenössischen wissenschaftlichen Literatur auf Wagners Werk
- Wagners Abkehr vom Nibelungenlied zugunsten einer mythischen Darstellung
- Die Entwicklung der Ring-Tetralogie und ihre dramaturgische Struktur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein: die Analyse von Richard Wagners Rezeption des Nibelungenstoffes im Ring des Nibelungen und seiner Methode der Mythensynthese. Sie skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit, der die mittelalterlichen Quellen und die wissenschaftliche Sekundärliteratur beleuchten wird, welche Wagners Werk beeinflusst haben.
Wagners mittelalterlichen Quellen: Dieses Kapitel analysiert die mittelalterlichen Quellen, die Wagner für seinen Ring des Nibelungen heranzog. Es beginnt mit einer detaillierten Betrachtung des Nibelungenliedes, wobei sowohl die Verwendung des ersten als auch des zweiten Teils des Epos im Werk Wagners analysiert wird. Der Fokus liegt auf der Auswahl und Adaption der Elemente aus dem Nibelungenlied, einschließlich der Weglassungen wie Siegfrieds königlicher Herkunft und des höfischen Ambientes. Weitere Quellen wie die Lieder-Edda, die Snorra-Edda, die Volsunga Saga und andere werden ebenfalls behandelt, und es wird untersucht, wie Wagner diese verschiedenen Quellen zu seinem neuen Mythos zusammenfügte. Die Bedeutung von Lachmanns Ausgabe und Simrocks Übersetzung des Nibelungenliedes wird ebenfalls herausgestellt.
Wagners „Sekundärliteratur“: Dieses Kapitel befasst sich mit den wissenschaftlichen Texten, die Wagners Arbeit beeinflusst haben könnten. Es untersucht die Art und Weise, wie Wagner diese Texte verwendet hat, und setzt sie in Beziehung zu seiner Komposition des Rings. Die Bedeutung von Werken zu Wagners Zeit sowie die Art ihres Einflusses auf sein Schaffen werden untersucht. Die Liste der von Wagner selbst angegebenen Quellen wird hier analysiert und in den Kontext seiner Arbeit gestellt.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Mythensynthese, Nibelungenlied, Eddas, Sagas, mittelalterliche Quellen, Sekundärliteratur, Oper, Drama, Musikdrama, Germanische Mythologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Richard Wagners Rezeption des Nibelungenstoffes
Welche Quellen werden in der Arbeit zu Wagners "Ring des Nibelungen" untersucht?
Die Arbeit analysiert umfassend die Quellen, die Richard Wagner für seine Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" nutzte. Dies beinhaltet sowohl mittelalterliche Quellen wie das Nibelungenlied, die Lieder-Edda, die Snorra-Edda und die Völsunga Saga als auch die wissenschaftliche Sekundärliteratur seiner Zeit. Die Analyse konzentriert sich auf Wagners Auswahl, Adaption und Synthese dieser Quellen zu seinem eigenen Mythos.
Wie wird Wagners Umgang mit den mittelalterlichen Quellen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert, wie Wagner die mittelalterlichen Quellen für seinen "Ring" verwendete. Es wird untersucht, welche Elemente er auswählte, wie er sie adaptierte und welche Teile er weglasste. Beispielsweise wird die Behandlung des Nibelungenliedes im Detail analysiert, wobei die Unterschiede zwischen Wagners Version und der ursprünglichen Erzählung hervorgehoben werden. Die Bedeutung von Lachmanns Ausgabe und Simrocks Übersetzung des Nibelungenliedes wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die "Sekundärliteratur" in Wagners Werk?
Ein Kapitel der Arbeit widmet sich der wissenschaftlichen Literatur, die Wagner beeinflusst haben könnte. Es wird analysiert, wie Wagner diese Texte in seine Komposition des "Rings" integrierte und wie diese Texte seinen Umgang mit den mittelalterlichen Quellen beeinflussten. Die Untersuchung umfasst die von Wagner selbst genannten Quellen und deren Kontextualisierung innerhalb seines Werkes.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Wagners Rezeption des Nibelungenstoffes in seiner Tetralogie zu untersuchen und seine Methode der Mythensynthese zu analysieren. Es geht darum, die Quellen zu identifizieren und zu beleuchten, wie Wagner diese Quellen zu einem neuen, eigenständigen Mythos verarbeitet hat. Die Analyse umfasst sowohl mittelalterliche als auch wissenschaftliche Quellen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themenschwerpunkte, darunter Wagners Verwendung mittelalterlicher Quellen (Nibelungenlied, Eddas, Sagas), die Analyse seiner "Mythensynthese" und seines Umgangs mit den Quellen, den Einfluss der zeitgenössischen wissenschaftlichen Literatur, Wagners Abkehr vom Nibelungenlied hin zu einer mythischen Darstellung und die Entwicklung der Ring-Tetralogie und ihrer dramaturgischen Struktur.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Wagners mittelalterliche Quellen, Wagners „Sekundärliteratur“ und Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein, das Kapitel zu den mittelalterlichen Quellen analysiert die Quellen wie das Nibelungenlied, die Eddas und die Sagas. Das Kapitel zu Wagners „Sekundärliteratur“ befasst sich mit den wissenschaftlichen Texten, die Wagners Werk beeinflusst haben könnten. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit charakterisieren, sind: Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Mythensynthese, Nibelungenlied, Eddas, Sagas, mittelalterliche Quellen, Sekundärliteratur, Oper, Drama, Musikdrama, Germanische Mythologie.
- Quote paper
- Nora Pröfrock (Author), 2003, Richard Wagners Mythensynthese im Ring des Nibelungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20289