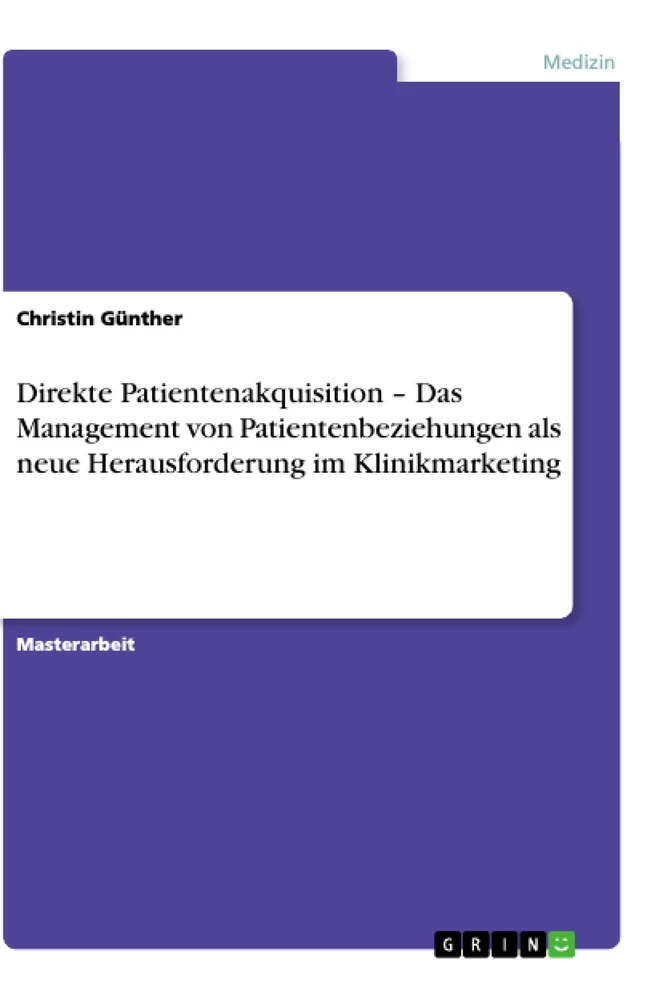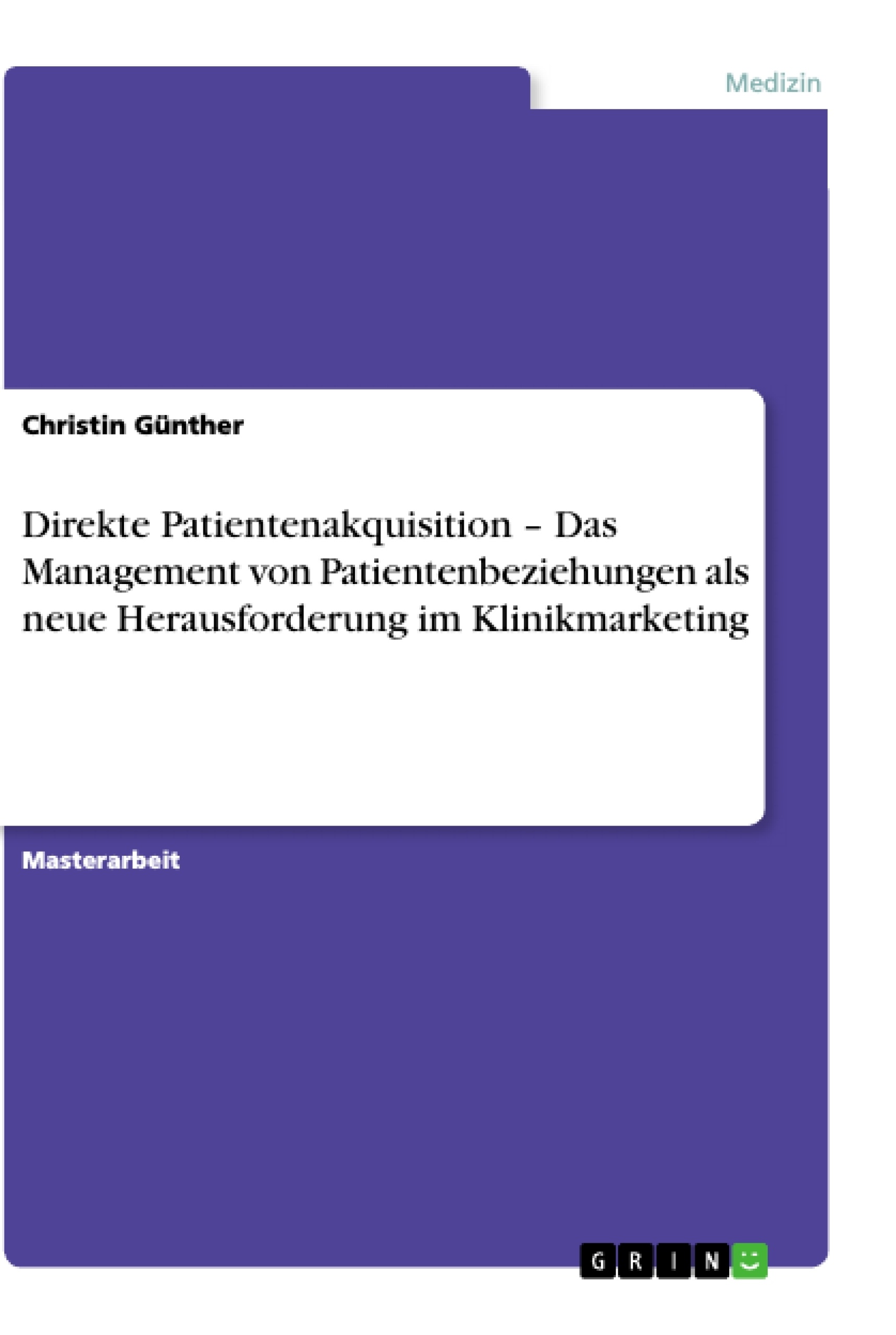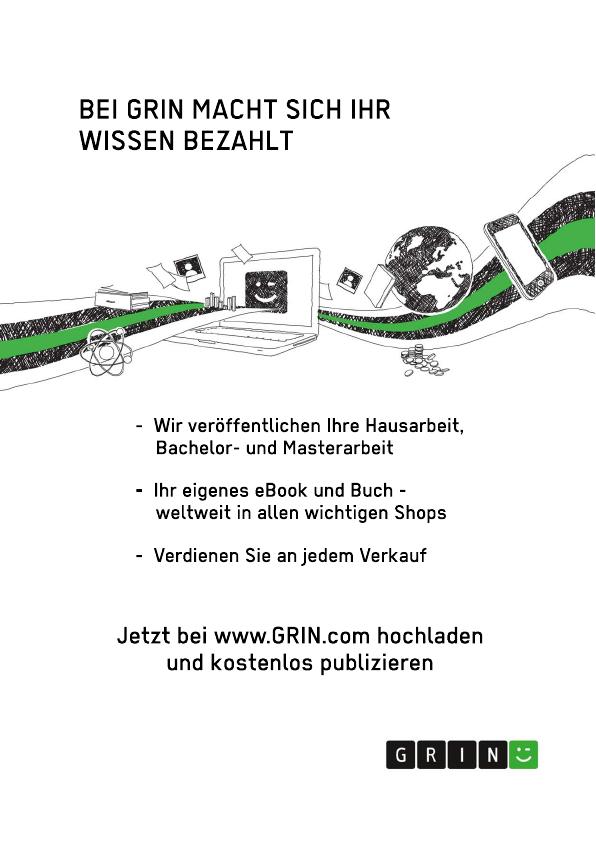Das Krankenhaus gilt als zentrale Einrichtung der Gesundheitsversorgung, Zentrum für medizinischen Fortschritt und bedeutender Wirtschaftsfaktor. Im internationalen Vergleich können deutsche Krankenhäuser einen hohen Leistungsstandard aufweisen, dem jedoch hohe Kosten gegenüber stehen. Im Jahr 2010 betrugen die gesamten Gesundheitsausgaben 287,3 Mrd.Euro, wobei allein auf Krankenhäuser ein Betrag von 74,3 Mrd.Euro entfiel.
Als Konsequenz aus den steigenden Gesundheitsausgaben zielt der Gesetzgeber aufseiten der Versorgungsanbieter darauf ab, durch die Einführung und kontinuierliche Erhöhung des Kosten- und Wettbewerbsdrucks, die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung in den Versorgungseinrichtungen zu verbessern. Durch zahlreiche Veränderungen im Gesundheitssystem und im politischen Umfeld sind Krankenhäuser nun einem immer größer werdenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt und sehen sich erstmalig zu einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung gezwungen.
Daher bedarf es einer professionellen Vermarktung guter Leistungen, durch die es dem Krankenhaus möglich ist, sich gegenüber Wettbewerbsteilnehmern gut zu positionieren. Ein Management-Ansatz für die aktive und umfassende Gestaltung der Beziehung zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen und dem Krankenhaus wird notwendig. Dieser Ansatz muss in der Lage sein, den zukünftigen und langfristigen Erfolg des Krankenhauses zu sichern.
Die Zielgruppe aller Aktivitäten sind dabei die Kunden. In einem Krankenhaus zählen drei Anspruchsgruppen zu den Kunden: der Patient als Empfänger der Krankenhausleistung, die Krankenversicherung als Kostenträger und letztlich der Einweiser, der die „Kaufentscheidung“ des Kunden wesentlich beeinflusst. Neben Notfalleinweisungen und Verlegungen in andere Häuser, findet der Patient bei elektiven Behandlungen in erster Linie über Einweisungen niedergelassener Ärzte den Weg ins Krankenhaus. Dies betrifft mit 45% aller Patienten den größten Teil, der dort zu behandelnden. Somit stellt der Einweiser die wichtigste Anspruchsgruppe des Krankenhauses dar.
In dieser Arbeit steht jedoch die direkte Patientenakquisition und somit der Patient im Mittelpunkt der Betrachtung. Thema dieser Arbeit ist das Management von Patientenbeziehungen als neue Herausforderung im Klinikmarketing. Dabei soll herausgestellt werden, ob die direkte Patientenakquisition im Rahmen eines Managements von Patientenbeziehungen tatsächlich eine Option zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele eines Krankenhauses darstellt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Veränderungstreiber auf dem Krankenhausmarkt
2.1 Politisch-rechtliche und ökonomische Veränderungstreiber
2.2 Der souveräne Patient als Veränderungstreiber
3 Das Management von Patientenbeziehungen
3.1 Das klassische Kundenbeziehungsmanagement
3.1.1 Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen
3.1.2 Die Grundzüge des klassischen Kundenbeziehungsmanagements
3.2 Das Patientenbeziehungsmanagement im Krankenhaus
3.2.1 Besonderheiten der Krankenhausdienstleistung
3.2.2 Der Patientenbeziehungsmanagement-Ansatz
4 Handlungsoptionen und Marketing-Maßnahmen im Rahmen des Patientenbeziehungsmanagements
4.1 Handlungsoptionen des Patientenbeziehungsmanagements
4.1.1 Ausgestaltung des normativen Managements
4.1.2 Ausgestaltung des strategischen Managements
4.1.3 Ausgestaltung des operativen Managements
4.2 Einsatz von Marketing-Maßnahmen im Krankenhaus
4.2.1 Maßnahmen im Rahmen der Produktpolitik
4.2.2 Maßnahmen im Rahmen der Preispolitik
4.2.3 Maßnahmen im Rahmen der Distributionspolitik
4.2.4 Maßnahmen im Rahmen der Kommunikationspolitik
5 Die Bedeutung eines wertorientierten Patientenbeziehungsmanagements
6 Die direkte Patientenakquisition als eine Option zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele eines Krankenhauses
7 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Die Abgrenzung des CRM von verwandten Begriffen
Abb. 2 Phasen des Kundenbeziehungslebenszyklus
Abb. 3 Wirkungskette der Kundenbindung
Abb. 4 Die vier Perspektiven des PRM-Ansatzes
Abb. 5 Die Management-Perspektive des PRM-Ansatzes
Abb. 6 Die Module „Angebots- und Nachfragemanagement“
Abb. 7 Beziehungsintensität im Kundenbeziehungslebenszyklus
Abb. 8 Determinanten des Kundenwerts
Abb. 9 Patient Lifetime Value
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Das Krankenhaus[1] gilt als zentrale Einrichtung der Gesundheitsversorgung, Zentrum für medizinischen Fortschritt und bedeutender Wirtschaftsfaktor.[2] Im internationalen Vergleich können deutsche Krankenhäuser einen hohen Leistungsstandard aufweisen, dem jedoch hohe Kosten gegenüber stehen.[3] Im Jahr 2010 betrugen die gesamten Gesundheitsausgaben 287,3 Mrd. Euro, wobei allein auf Krankenhäuser ein Betrag von 74,3 Mrd. Euro entfiel.[4]
Als Konsequenz aus den steigenden Gesundheitsausgaben zielt der Gesetzgeber aufseiten der Versorgungsanbieter darauf ab, durch die Einführung und kontinuierliche Erhöhung des Kosten- und Wettbewerbsdrucks, die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung in den Versorgungseinrichtungen zu verbessern.[5] Durch zahlreiche Veränderungen im Gesundheitssystem und im politischen Umfeld sind Krankenhäuser nun einem immer größer werdenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt[6] und sehen sich erstmalig zu einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung gezwungen.[7]
Daher bedarf es einer professionellen Vermarktung guter Leistungen, durch die es dem Krankenhaus möglich ist, sich gegenüber Wettbewerbsteilnehmern gut zu positionieren. Ein Management-Ansatz für die aktive und umfassende Gestaltung der Beziehung zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen und dem Krankenhaus wird notwendig.[8] Dieser Ansatz muss in der Lage sein, den zukünftigen und langfristigen Erfolg des Krankenhauses zu sichern.[9]
Die Zielgruppe aller Aktivitäten sind dabei die Kunden.[10] In einem Krankenhaus zählen drei Anspruchsgruppen zu den Kunden: der Patient als Empfänger der Krankenhausleistung, die Krankenversicherung als Kostenträger und letztlich der Einweiser, der die „Kaufentscheidung“ des Kunden wesentlich beeinflusst.[11] Neben Notfalleinweisungen und Verlegungen in andere Häuser, findet der Patient bei elektiven Behandlungen in erster Linie über Einweisungen niedergelassener Ärzte den Weg ins Krankenhaus. Dies betrifft mit 45 Prozent aller Patienten den größten Teil, der dort zu behandelnden.[12] Somit stellt der Einweiser die wichtigste Anspruchsgruppe des Krankenhauses dar.
In dieser Arbeit steht jedoch die direkte Patientenakquisition und somit der Patient im Mittelpunkt der Betrachtung. Thema dieser Arbeit ist das Management von Patientenbeziehungen als neue Herausforderung im Klinikmarketing. Dabei soll herausgestellt werden, ob die direkte Patientenakquisition im Rahmen eines Managements von Patientenbeziehungen tatsächlich eine Option zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele eines Krankenhauses darstellt.
Zunächst werden im 2. Kapitel Veränderungstreiber des Krankenhausmarktes dargestellt. Dabei werden politisch-rechtliche und ökonomische Strukturänderungen im Krankenhaussektor aufgeführt, durch die sich Krankenhäuser einem steigenden Wettbewerbsdruck gegenübersehen. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird die Rolle des Patienten im Gesundheitserstellungsprozess in den Fokus der Betrachtung gerückt und dessen neu gewonnene Souveränität aufgezeigt. Diese Souveränität macht es letztlich erst möglich, den Patienten als einen Kunden im Unternehmen „Krankenhaus“ betrachten zu können und in der Konsequenz auch zu müssen.
Darauf aufbauend setzt das 3. Kapitel seinen Schwerpunkt auf das beziehungsorientierte Management, dessen Einsatz im Krankenhaus durch die im 2. Kapitel dargestellten Veränderungstreiber begründet ist. Zunächst erfolgen kurze Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen. Danach wird das klassische Kundenbeziehungsmanagement in seinen Grundzügen dargestellt. Im zweiten Abschnitt wird im Speziellen auf das Patientenbeziehungsmanagement im Krankenhaus eingegangen. Um das klassische Kundenbeziehungsmanagement jedoch auf das Krankenhaus übertragen zu können, müssen zunächst die Besonderheiten einer Krankhausdienstleistung aufgezeigt werden, die eine einfache Übertragung des Kundenmanagements so nicht möglich machen. Damit sind die Grundlagen gelegt, um im weiteren Verlauf des 3. Kapitels schließlich den Patientenbeziehungsmanagement-Ansatz vorstellen zu können.
Um Patienten zu gewinnen und an sich zu binden, muss ein Krankenhaus verschiedene Maßnahmen ergreifen und seine Aktivitäten patientenorientiert ausgestalten. Diese werden im 4. Kapitel dargestellt. Im ersten Abschnitt werden die Ausgestaltungsmöglichkeiten verschiedener Management-Ebenen des Patientenbeziehungsmanagement-Ansatzes dargestellt, wobei hier auch die Verortung von Marketing-Instrumenten stattfindet. Marketing-Maßnahmen bilden dann im zweiten Abschnitt den Schwerpunkt, da sie unverzichtbar sind, um das Interesse potenzieller Patienten für das Krankenhaus zu wecken.
Im 5. Kapitel wird die Bedeutung eines wertorientierten Patientenbeziehungsmanagements hervorgehoben. Hierbei steht der Patient Lifetime Value als Möglichkeit zur Ermittlung des Kundenwertes im Mittelpunkt. Dabei werden dessen Bestandteile und die Bedeutsamkeit einzelner Wertpotenziale aufgezeigt.
Abschließend stellt sich die Frage, ob die direkte Patientenakquisition im Rahmen eines Managements von Patientenbeziehungen tatsächlich eine Option zur Erreichung der wirtschaftlichen Ziele eines Krankenhauses darstellt. Dies wird im 6. Kapitel beantwortet.
Den Abschluss bildet das 7. Kapitel, in dem eine kurze Schlussbetrachtung gezogen und ein Ausblick gegeben wird.
2 Veränderungstreiber auf dem Krankenhausmarkt
Deutschland befindet sich mit seinen Gesundheitsausgaben von 11,6 Prozent des BIP hinter den USA, Niederlande und Frankreich, an vierter Stelle der Welt.[13] Krankenhäuser sind ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Gesundheitssystems. Sie haben dabei einen Anteil von fast 26 Prozent an den Gesamtausgaben des deutschen Gesundheitswesens.[14] Krankenhäuser können in drei Gruppen nach Art der Trägerschaft und der Rechtsform eingeteilt werden. Erstens sind dies öffentliche Krankenhäuser, die in öffentlich-rechtlicher Form oder aber auch in privatrechtlicher Form betrieben werden können. Zweitens die freigemeinnützigen, die von Trägern der kirchlichen und freien Wohlfahrtspflege, Kirchgemeinden, Stiftungen, Vereinen unterhalten werden und drittens gibt es die privaten Krankenhäuser, die als gewerbliche Unternehmen einer Konzession nach §30 Gewerbeordnung bedürfen.[15]
Die stationäre Versorgung ist nach wie vor nicht erwerbs-, sondern bedarfswirtschaftlich ausgerichtet und somit ein stark reglementierter und durch staatliche Einflussnahme kontrollierter Markt.[16] Strukturänderungen im Gesundheitsmarkt nehmen aktuell einen sehr großen Einfluss auf die Situation der Krankenhäuser in Deutschland[17] und können daher als Veränderungstreiber bezeichnet werden. Sie resultieren zum einen aus den politisch-rechtlichen und ökonomischen Faktoren und zum anderen aus der sich wandelnden Rolle des Patienten. Nachfolgend werden die Veränderungstreiber näher betrachtet.
2.1 Politisch-rechtliche und ökonomische Veränderungstreiber
In einer Marktwirtschaft funktioniert der Wettbewerb über das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage und den Ausgleich über den Preismechanismus. In fast allen Gesundheitssystemen wird jedoch die Preisbildung für Gesundheitsleistungen vom Staat mehr oder weniger reguliert. Dahinter steht die Vorstellung, dass Patienten im Krankheitsfall weder über genügend Marktransparenz noch über Konsumentensouveränität verfügen. Der deutsche Gesundheitsmarkt ist massiv reguliert. Im Krankenhauswesen geschieht dies vor allem durch die staatliche Investitionslenkung, über Krankenhauspläne und staatliche Fördermittel sowie durch staatlich regulierte landes- bzw. bundeseinheitliche Preise[18] in Form von Basisfallwerten.[19]
Die Krankenhausplanung wurde 1972 mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) auf die jetzt gültige Basis gestellt.[20] Zweck des KHG ist dabei „die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.“[21]
Von der Grundidee her entspricht die deutsche Krankenhausplanung dem Modell der staatlichen Angebotsplanung, denn die Kapazitäten werden nach vorausgegangener Bedarfsschätzung vom Staat geplant und festgelegt. Diese Festlegung schlägt sich in den Krankenhausplänen der Bundesländer nieder,[22] denn die Länder sind verpflichtet, Krankenhauspläne aufzustellen.[23] Hier werden die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser ermittelt. Zumeist orientiert sich die Planung hauptsächlich an der Zahl und Art der Krankenhausbetten einer Region. Zudem muss die Abschätzung für circa 25 Jahre im Voraus erfolgen, da ein Krankenhausbett ungefähr solange genutzt wird.[24] Das Land kann dabei unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen und dem Gebot der Vielfalt der Krankenhausträger, zwischen verschiedenen Krankenhäusern entscheiden und jene wählen, die den Zielen der Krankenhausplanung am ehesten gerecht werden.[25]
Krankenkassen dürfen nach §108 SGB V Krankenhausbehandlungen nur durch Krankenhäuser erbringen lassen, die entweder als Hochschulklinik anerkannt sind, die in den Krankenhausplan eines Landes aufgenommen sind, also Plankrankenhäuser, oder durch Krankenhäuser, die einen Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen oder den Verbänden der Ersatzkassen abgeschlossen haben.[26] Plankrankenhäuser haben dahingehend Privilegien, dass Krankenkassen mit ihnen Versorgungsverträge schließen müssen.[27] Durch den Kontrahierungszwang für Krankenkassen erhalten Plankrankenhäuser somit eine Lizenz zur Abrechnung von Krankenhausleistungen.[28]
Das System der Krankenhausfinanzierung wird als dualistisch bezeichnet.[29] Es unterscheidet nach §4 KHG zwischen einer Investitionsfinanzierung und einer Betriebsfinanzierung. Im Rahmen der Investitionsfinanzierung werden die Investitionskosten eines Krankenhauses ganz oder zum Teil durch öffentliche Förderungen der Länder aufgebracht.[30] Ist ein Krankenhaus einmal in den Plan eines Landes aufgenommen, hat es einen Anspruch auf öffentliche Investitionsförderung.[31] Des Weiteren können die Länder die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und kleiner baulicher Maßnahmen durch feste jährliche Pauschalbeträge fördern. Mit dieser Pauschalförderung kann das Krankenhaus im Rahmen der Zweckbindung der Fördermittel frei wirtschaften.[32] Zudem sollte gemäß §10 KHG seit Januar dieses Jahres auch die Möglichkeit bestehen, eine Investitionsförderung über leistungsorientierte Investitionspauschalen zu realisieren. Dabei werden Investitionspauschalen nach einer bestimmten Bewertungsrelation an die DRG-Systematik[33] geknüpft. Die Entscheidung zwischen der herkömmlichen Einzel- und Pauschalförderung oder einer leistungsorientierten Förderung soll zudem weiterhin den Ländern obliegen. Dieses Vorhaben kann jedoch aufgrund von Schwierigkeiten in der Umsetzung erst frühestens 2013 erfolgen.[34]
Die Fördermittel der Länder sind laut Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) innerhalb von 10 Jahren seit 1998 real um 34,5 Prozent zurückgegangen.[35] Die Länder sind nicht in der Lage, die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um im Leistungswettbewerb mit anderen Krankenhäusern bestehen zu können, und so beispielsweise in die EDV-Infrastruktur oder in neue medizinisch-technische Geräte investieren zu können.[36] Die Mindestinvestitionsrate eines Akutversorgungshauses sollte bei circa 10 Prozent liegen. Die durch Fördermittel im Jahr 2008 getätigten Investitionen betrugen jedoch lediglich 5 Prozent des Umsatzes.[37] Die Fördermittel reichen zur Deckung der Investitionen nicht aus und es ergibt sich dadurch ein Finanzierungsdefizit, welches durch Eigenfinanzierung der Krankenhäuser unter anderem aus den Vergütungen der Krankenhausleistungen querfinanziert werden muss. Es ist festzuhalten, dass die Länder ihrem gesetzlichen Auftrag zur Investitionskostenfinanzierung nicht nachkommen.[38]
Zur Deckung der laufenden Betriebskosten im Rahmen der Betriebsfinanzierung dienen zum einen die Erlöse aus den Pflegesätzen und zum anderen die Erlöse aus der Vergütung für vor- und nachstationäre Behandlungen und für ambulantes Operieren.[39] Die laufenden Betriebskosten werden durch die Patienten bzw. durch deren Kostenträger, den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen, finanziert.[40]
Den wichtigsten Teil der Betriebsfinanzierung stellen jedoch die Erlöse aus den Pflegesätzen dar. Die allgemeinen Krankenhausleistungen, die unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Krankenhauses im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung des Patienten notwendig sind,[41] werden durch ein leistungsorientiertes und pauschalierendes Vergütungssystem vergütet.[42] Jeder Behandlungsfall eines Patienten wird dabei in einem ersten Schritt einer Diagnosis Related Group (DRG) zugeordnet. Mit deren Hilfe lässt sich die Leistung eines Krankenhauses messen. Sie bildet damit eine Basis für die Finanzierung, Budgetierung und Abrechnung.[43] Für die einzelnen DRGs sind im Fallpauschalenkatalog Bewertungsrelationen, also Kostengewichte, angewiesen, die die grundsätzliche Vergütung der DRGs im Verhältnis zueinander beschreiben. Auf Landesebene vereinbaren die Landesverbände der Krankenkassen, die Ersatzkassen und der Landesausschuss des Verbandes der privaten Krankenversicherung mit der jeweiligen Landeskrankenhausgesellschaft jährlich einen landesweiten, für alle Krankenhäuser gültigen Basisfallwert. Der fixierte Basisfallwert wird mit der über die DRG-Systematik ermittelten effektiven Bewertungsrelation multipliziert, sodass sich ein Preis für die erbrachten Leistungen eines Falles ergibt. Zudem werden sie ergänzt um Zu- bzw. Abschläge, die sich aus der Über- und Unterschreitung von sogenannten Grenzverweildauern sowie der Verlegung von Patienten ergeben.[44]
Je kürzer die Verweildauer, desto höher ist der Erlös pro Tag. Nach dem Erreichen der oberen Grenzverweildauer bleibt der durchschnittliche Tageserlös konstant. Dieser Betrag ist im Verhältnis zum durchschnittlichen Tageserlös bei durchschnittlicher Verweildauer jedoch so gering, dass eine Fallkostendeckung kaum mehr möglich ist. Dadurch besteht kein finanzieller Anreiz, die Verweildauer zu verlängern. Die Gefahr, durch Verkürzung der Verweildauer kurzfristig die Erträge zu steigern, besteht weiter, jedoch muss bedacht werden, dass die untere Grenze so niedrig gelegt ist, dass es bei Unterschreitung meist zu einer „blutigen“ Entlassung käme, die dann wiederum zu Qualitäts- und Imageverlusten führen würde und somit langfristig zu einer sinkenden Nachfrage nach Krankenhausleistungen. Die daraus resultierende Wiederaufnahme des Falls führt dann aber zu keiner neuen abrechenbaren DRG, sondern zu einer Neueinstufung des ursprünglichen Falls.[45]
Mit den Krankenkassen wird stattdessen grundsätzlich prospektiv auf Basis eines Case-Mix ein Budget für das Folgejahr verhandelt.[46] Jeder DRG wird ein Kostengewicht zugewiesen. Die Summe aller Kostengewichte einer Periode eines Krankenhauses wird als Case-Mix bezeichnet. Der Quotient aus Case-Mix und Fallzahl entspricht dem Case-Mix-Index. Er ist ein Maß der durchschnittlichen Leistungsintensität bzw. der durchschnittlichen ökonomischen Komplexität der behandelten Fälle und ist unabhängig von der Leistungsmenge eines Krankenhauses.[47]
Wird das verhandelte Leistungsvolumen nicht erreicht, sieht der Gesetzgeber Ausgleichszahlungen vor. Das Krankenhaus zahlt für jeden über den Plan erbrachten Case-Mix-Punkt 65 Prozent an die Krankenkasse zurück und behält 35 Prozent selbst ein. Bei Nichterreichen des Planes werden die Mindererlöse mit 20 Prozent ausgeglichen. Das heißt, das Krankenhaus erhält für nicht erbrachte Leistungen immerhin noch einen Erlös von 20 Prozent[48] und hat somit den Antrieb, den geplanten Case-Mix zumindest zu erreichen. Liegt der Fixkostenanteil[49] sogar über 65 Prozent, besteht ein Anreiz, das Leistungsvolumen auszuweiten, da ein Gewinn möglich ist. Diese Ausgleichssystematik impliziert, dass Krankenhäuser, die ihren geplanten Case-Mix nicht erreichen, tendenziell ihre Fixkosten nicht decken können.[50] Betten, die nicht genutzt werden, sind als reine Fixkostentreiber anzusehen.[51]
Langfristig führt ein zu geringer Case-Mix zum Konkurs, was vom Gesetzgeber auch so vorgesehen ist. Einrichtungen, die für die Einzugsbevölkerung unattraktiv sind und damit eine geringe Nachfrage haben, werden mittelfristig aus dem Markt gedrängt.[52] Der Gesetzgeber wollte mit der Einführung der DRGs die stationären Kapazitäten indirekt reduzieren und initiieren, dass Krankenhäuser, die mit ihren Kosten über den Erlösen liegen, ihre Strukturen und Prozesse anpassen, um wenigstens einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen.[53] Anreize, Erträge über die Verweildauer zu generieren, sind tatsächlich verloren gegangen,[54] denn durch die Einführung der DRG-Systematik ist es zu verkürzten Verweildauern gekommen. Im Gegenzug wurden die vorgehaltenen Planbetten jedoch nur in einem unterproportionalem Maß abgebaut.[55] Daher fällt Deutschland im internationalen Vergleich durch eine hohe Bettendichte auf. Im Jahr 2009 betrug diese 8,2 Betten pro 1.000 Einwohner, wobei der OECD-Durchschnitt bei 4,9 Betten lag.[56] Das spiegelt sich auch in der Rate der Bettenauslastung wider. Hieran kann abgelesen werden, ob die Betten tatsächlich genutzt werden.[57] In Deutschland lag diese im Jahr 2010 bei 77,4 Prozent. Bei insgesamt 502.769 Betten sind das 113.626, die leer blieben.[58] Der von den meisten Ländern vorgegebene Mindestauslastungsgrad von 85 Prozent wird damit um 7,6 Prozent unterschritten.[59]
Die staatlichen Krankenhausplanungen in den einzelnen Bundesländern haben letztlich die Verkürzungen der Verweildauer unterschätzt, wodurch es zu Überkapazitäten kam.[60] Die Bundesländer haben allerdings aufgeschoben, ihre Zielvorgaben entsprechend anzupassen. „Es scheint grundsätzlich schwierig, mit den derzeitigen Verfahren der Krankenhausplanung genau die Kapazitäten zu prognostizieren, die auch beansprucht werden. Schwankungen der Inanspruchnahme der Kapazitäten, insbesondere der Reservekapazitäten, sind als gegeben anzusehen und auf diese Art nicht „wegzuplanen“.“[61]
Die entstandenen Bettenüberhänge werden nur ungern abgebaut. Ein Grund dafür ist, dass für Krankenhausbetten entsprechendes Personal vorgehalten wird, dieses jedoch aufgrund der restriktiven Arbeitsgesetzgebung nur langsam abgebaut wird.[62] Des Weiteren ist anzumerken, dass die staatlichen Fördermittel oftmals noch an der Anzahl der Betten anknüpfen.[63] So werden Kapazitäten teilweise nur zum reinen Selbstzweck betrieben.[64]
Wollen sie ihre Bettenzahl behalten, müssen bei verkürzter Verweildauer mehr Patienten behandelt werden. Die hohen Fixkosten und die dadurch notwendige hohe Kapazitätsauslastung machen Krankenhäuser bereits für einen geringen Nachfragerückgang hoch sensibel.[65]
Ein Wettbewerbstreiber liegt zudem darin, dass vormals stationäre Behandlungen nun auch ambulant durchführt werden können.[66] Die Auslagerung von Versorgungsleistungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor wird auch als „Ambulantisierung“ bezeichnet. Zum einen wollte man damit auf den durch die demografische Alterung und Zunahme chronischer Erkrankungen verursachten Wandel der gesundheitlichen Problemlagen der Bevölkerung reagieren. Zum anderen wollte man dadurch die Nutzung kostenintensiver stationärer Versorgungsangebote einschränken, den stationären Sektor entlasten und den Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen bremsen.[67] Nun stehen nicht nur Krankenhäuser untereinander im Wettbewerb um Patienten, sondern auch zusätzliche Wettbewerber, wie beispielsweise ambulante Spezialpraxen.[68]
Die Unternehmensberater von Ernst & Young sehen laut einem Gutachten aus dem Jahr 2005 zur Gesundheitsversorgung 2020 für kommunale Krankenhäuser geringe Überlebenschancen. Sie sagen einen Rückgang von 70 Prozent voraus, der aber zum Teil durch Privatisierung ausgeglichen wird. Begründet wird diese Prognose vor allem mit wirtschaftlichem Druck und knappen Kassen der öffentlichen Hand sowie dem technologischen und medizinischen Fortschritt, der unter anderem kürzere stationäre Aufenthalte ermöglicht. Man geht weiterhin davon aus, dass von diesen Schließungen vor allem die kleineren Krankenhäuser in ländlichen Regionen betroffen sein werden.[69] Besonders die Alterung der Gesellschaft in Verbindung mit der Abwanderung der Jüngeren, aus strukturschwachen Regionen, führt zu Bevölkerungs- und damit Krankenhausnachfragerückgängen, was einen wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhäuser in diesen Regionen zunehmend erschwert.[70]
Durch die sinkenden Fördermittel, dem zunehmenden Investitionsbedarf und dem wachsenden ökonomischen Druck am wettbewerbsorientierten Markt verschob sich im Laufe des letzten Jahrzehnts der Anteil öffentlicher in Richtung privater Krankenhäuser.[71] Im Jahr 2010 wurde mit 679 privaten Krankenhäusern von gesamt 2.064 bereits ein Marktanteil von rund 33 Prozent generiert.[72] 2006 lag dieser noch bei rund 28 Prozent.[73] Die fehlenden staatlichen Investitionsförderungen erschweren es immer mehr Krankenhäusern, durch Rationalisierungsmaßnahmen ihre Betriebskosten zu senken und somit am stark wettbewerbsorientierten Markt bestehen zu bleiben. Hier haben private Krankenhäuser und besonders Klinikketten einen Vorteil gegenüber öffentlichen oder freigemeinnützigen Krankenhäusern. Je nach Rechtsform stehen ihnen neben der staatlichen Förderung Kapitalquellen wie die Börse bei aktiennotierten Unternehmen, Bankdarlehen oder Gelder privater Investoren zur Verfügung. Durch die Möglichkeit eines schnelleren und autonomen Agierens am Markt ergibt sich ein Wettbewerbsvorteil.[74]
Auch die Mindestmengenregelung nach §137 SGB V[75] unterstützt die zunehmende Privatisierung, da gerade die kleinen bis mittleren Krankenhäuser veranlasst sind, sich in größere auch private Verbünde zu integrieren, um so über Spezialisierungen innerhalb des Verbundes die kritischen Leistungsmengen zu erreichen.[76]
Private Krankenhäuser orientieren sich vordergründig an der Erzielung von Gewinnen und haben deshalb ein natürliches Interesse daran, die Effizienz ihrer Prozesse zu verbessern. Dadurch üben sie einen zusätzlichen Druck auf Krankenhäuser in öffentlicher oder freigemeinnütziger Trägerschaft aus, bei denen bis dato primär die Bedarfsdeckung im Rahmen des Versorgungsauftrages im Vordergrund steht.[77] Die Privatisierungstendenzen im Bereich der öffentlichen Krankenhäuser tragen dazu bei, dass sich eine verstärkte Konkurrenz um den Patienten entwickelt.[78]
So wie das Gesundheitssystem im Ganzen, befindet sich auch der Krankenhaussektor in einer „Phase des umfassenden Strukturwandels“.[79] Die Verschärfung des Wettbewerbs lässt sich auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückführen. Durch die Krankenhausplanung der Länder in Verbindung mit der Leistungsvergütung über DRGs, der damit einhergehenden Verkürzung der Verweildauern, der bis dato schlechten Anpassung der Bettenkapazitäten, der bestehenden Investitionslücke, der Ambulantisierung und der voranschreitenden Tendenz zur Privatisierung stehen Krankenhäuser neuen Herausforderungen gegenüber. Sie müssen mehr Patienten behandeln, um die hohen Fixkosten decken zu können. Der Druck auf die unrentablen Krankenhäuser nimmt weiter zu. Eine verstärkte Ausrichtung an Wirtschaftlichkeitszielen wird somit unabdingbar. Sie müssen sich folglich immer mehr an die Prinzipien und Herangehensweisen von Wirtschaftsunternehmen orientieren, um sich letztlich im wachsenden Wettbewerb behaupten zu können.[80]
2.2 Der souveräne Patient als Veränderungstreiber
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient kann mittels verschiedener soziologischer Ansätze beschrieben und im Hinblick auf den Grad der Einflussmöglichkeiten, der als zentraler Parameter für die Souveränität eines Patienten in der Leistungsbeziehung gilt, differenziert werden.[81] Historisch gesehen ist die älteste Rollendefinition zwischen Arzt und Patient im „Paternalismus“ zu sehen.[82] Der paternalistische Ansatz beschreibt die Beziehung zwischen Arzt und Patient als eine Art „Vater-Kind-Verhältnis“. Der Arzt gibt Anweisungen an den Patienten, die dieser zu seinem eigenen Wohl zu erfüllen hat, unabhängig davon, ob er diese versteht oder nicht. Die Transparenz über das Therapieziel oder den Therapieplan ist hier lediglich als unterstützender Faktor bei der Durchführung der Behandlung notwendig.[83] Die Zustimmung zur Behandlung ist der einzige Punkt, an dem der Patient einen wirklichen Einfluss hat.[84]
Eine andere Rollendefinition findet sich im partnerschaftlichen Modell wieder. Dieses sieht eine quasi-gleichberechtigte Rolle des Patienten und des Arztes am Heilungsprozess vor. Beide nehmen dabei unterschiedliche Rollen ein. Die Aufgabe des Arztes liegt darin, den Patienten durch Aufklärung und Information in die Lage zu versetzen, eine eigene Entscheidung zu treffen und damit „mündig“ zu machen.
Die Rolle des Patienten als tatsächlich frei entscheidender Konsument von Gesundheitsleistungen findet sich schließlich im Konsumerismus wieder. In diesem Ansatz kommt dem Patienten sowohl die Funktion des Entscheiders als auch die der Selbstinformation zu. Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Transparenz über die Leistungsinhalte und mit steigendem Zuzahlungsanteil der Patienten auch über die Kosten. Aufgrund der höheren Selbstinformation ist der Patient in der Lage, eigenständige Präferenzen zu bilden und eine Kaufentscheidung zu treffen. Die Entscheidung fällt letztlich unabhängig von der Beratung des Arztes, der hier lediglich als Leistungserbringer auftritt. Somit wird ein marktwirtschaftlicher Prozess in Gang gesetzt.[85]
Aufgrund des gesellschaftlichen Status und des bereits im 19. Jahrhundert begründeten hohen Selbstbewusstseins der Ärzte war eine gleichberechtigte Arzt-Patienten-Beziehung undenkbar. Das Autoritätsgefälle lag vor allem im Wissensmonopol der Ärzteschaft begründet und gewährleistete ihm dadurch die ausschließliche Entscheidungsmacht über Indikationen und Interventionen.[86] In der Vergangenheit wurden die Patienten als jene betrachtet, deren einziger Anspruch darin lag, dass das Leiden rasch beseitigt wird.[87] Der Patient hatte sich den Entscheidungen des Arztes als erduldender, unmündiger Kranker zu fügen.[88] „In kaum einer anderen Position als der des Patienten wird den Menschen fast automatisch ein so hohes Maß an Unmündigkeit unterstellt.“[89]
Durch Trends in Bildung, gesellschaftlichem Diskurs und durch den informationstechnologischen Fortschritt wird der Wandel des Patienten vorangetrieben und ermöglicht.[90] Bei den sozialpsychologischen Veränderungen kann in den letzten beiden Jahrzehnten in den westlichen Industrienationen ein Trend zu erhöhtem Gesundheitsbewusstsein festgestellt werden. Die Gesundheit wird mittlerweile als einer der wichtigsten Lebensaspekte gesehen.[91] Der Wertewandel hat einen starken Einfluss auf die Rolle des Patienten im Gesundheitswesen.[92] „Dem tradierten und überwiegend paternalistisch bestimmten Rollenverständnis von Patient und Arzt treten somit kontrapunktische Entwicklungen entgegen, in denen der klassische Heilauftrag – Heilen – Lindern – Vorbeugen – immer mehr zugunsten einer Kunden-Leistungserbringer-Konstellation weicht.“[93] Die Patienten sehen sich immer weniger als rein passive und gefügige Leistungsobjekte und -empfänger, sondern mehr als nachfragende Leistungsnehmer, die gemäß ihren Bedürfnissen eine möglichst adäquate Dienstleistung suchen und in Anspruch nehmen. Es wächst die Anspruchshaltung der Patienten an die Medizin und das an Versorgungssystem.[94] Patienten formulieren ihre Versorgungsansprüche selbstständiger, individualisieren ihre Wahl und Beurteilung von Krankenhausanbietern und entwickeln sich darüber hinaus zu proaktiven „Gesundheitskonsumenten“, die verstärkt Verantwortung für ihren aktuellen Gesundheitsstatus sowie für entsprechende Krankheitspräventionsmaßnahmen übernimmt.[95]
Die paternalistische Sichtweise der Arzt-Patienten-Beziehung hat somit zugunsten der partnerschaftlichen Beziehungsstrukturen an Ansehen verloren.[96] Sogar ein Trend hin zum Konsumerismus mit dem Patienten in einer für den Gesundheitssektor spezifischen Kundenrolle ist zu verzeichnen.[97]
Das partnerschaftliche Modell wird heute von den meisten Ärzten vertreten.[98] Doch auch weiterhin stehen einige Faktoren der voll-souveränen Konsumentenrolle des Patienten entgegen. Der paternalistische Ansatz wird künftig auch dann eine wichtige Rolle einnehmen, wenn der Patient diese Art der Leistungsbeziehung entweder erwartet oder aufgrund von psychischen Erkrankungen, aber auch physischen Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, eine andere Rolle einzunehmen, wie es beispielsweise in der Akutversorgung der Fall ist.[99]
Die für eine rationale Entscheidung im Krankenhausfall notwendigen Informationen sind auch weiterhin asymmetrisch zwischen Arzt und Patient verteilt. Der Patient besitzt einen Informationsvorsprung hinsichtlich seines behandlungsbegleitenden Verhaltens, der Arzt einen deutlichen Informationsvorsprung im Bereich medizinischer Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Kosten.[100] Informationen kann der Patient zwar vor seinem Erfahrungshintergrund und seinen kognitiven Fähigkeiten reflektieren, das wissenschaftlich begründete Verständnis kann er nicht aufbringen.[101] Der Patient muss somit, trotz Aufklärungspflicht seitens des Arztes und der Klinik, auf Grundlage eines Informationsnachteils wichtige Entscheidungen treffen.[102]
[...]
[1] Krankenhäuser sind „Einrichtungen, in denen durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können“. KHG §1 Abs. 1.
[2] Vgl. Kleinfeld (2002), S. 1.
[3] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 1.
[4] Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), S. 14f.
[5] Vgl. Sibbel (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 188.
[6] Vgl. Neudam, Haeske-Seeberg (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 81.
[7] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 13.
[8] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 6.
[9] Vgl. Deutz (1999), S. 2.
[10] Vgl. Neudam, Haeske-Seeberg (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 81.
[11] Vgl. Raab, Drissner (2011), S. 19.
[12] Vgl. Bahar, Wichels (2009), in: Amelung, Sydow, Windeler (Hrsg.), S. 350.
[13] Vgl. OECD (2011), S. 151.
[14] Vgl. Statistisches Bundesamt (2012), S. 14f., Der Wert wurde ermittelt aus den Gesamtgesundheitsausgaben und Ausgaben für Krankenhäuser.
[15] Vgl. Heinrich (2011), S. 37.
[16] Vgl. Clausen (2010), S. 19.
[17] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 11.
[18] Die landesweiten Basisfallwerte werden bis 2014 schrittweise an einen bundeseinheitlichen Basisfallwertkorridor angeglichen. Vgl. KHEntG §10 Abs. 8.
[19] Vgl. Neubauer, Beivers, Paffrath (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 150.
[20] Vgl. Schönbach, Wehner, Mahlzahn (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 182.
[21] KHG §1 Abs. 1.
[22] Vgl. Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 235.
[23] Vgl. KHG §6 Abs. 1.
[24] Vgl. Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 237.
[25] Vgl. KHG §8 Abs. 2.
[26] Vgl. SGB V §108.
[27] Vgl. Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 237.
[28] Vgl. Schönbach, Wehner, Mahlzahn (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 182.
[29] Vgl. Heinrich (2011), S. 32.
[30] Vgl. KHG §4.
[31] Vgl. KHG §8 Abs. 1.
[32] Vgl. KHG §9 Abs. 3.
[33] Zur Erklärung der DRG-Systematik siehe Seite 7.
[34] Vgl. KHG §10 Abs. 1. i.V.m. Laufer, Mörsch (2011).
[35] Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2009), S. 66.
[36] Vgl. Heinrich (2011), S. 42f.
[37] Vgl. Augurzky et al. (2010), S. 102.
[38] Vgl. Malzahn, Wehner (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 113f.
[39] Vgl. KHG §4 Nr. 2.
[40] Vgl. Heinrich (2011), S. 33.
[41] Vgl. KHEntG §2 Abs. 2.
[42] Vgl. Heinrich (2011), S. 33.
[43] Vgl. InEK (2011), S. 2.
[44] Vgl. Heinrich (2011), S. 35f.
[45] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 361.
[46] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362.
[47] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 360.
[48] Vgl. Heinrich (2011), S. 37; Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362.
[49] Fixkosten sind die festen Kosten des laufenden Betriebs, aber hier gerechnet ohne Kosten für Gebäude und Geräte, da diese im Rahmen der dualen Finanzierung von den Ländern bereits finanziert werden. Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362f.
[50] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362.
[51] Vgl. Geissler, Wörz, Busse (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 27.
[52] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362.
[53] Vgl. Geissler, Wörz, Busse (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 38.
[54] Vgl. Fleßa, Weber (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 362.
[55] Vgl. Neubauer, Beivers (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 9; Heinrich (2011), S. 30.
[56] Vgl. OECD (2011), S. 85.
[57] Vgl. Geissler, Wörz, Busse (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 27.
[58] Vgl. Statistisches Bundesamt (2012).
[59] Vgl. Weigl (2008), S. 2.
[60] Vgl. Neubauer, Beivers (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 6; Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 235.
[61] Schönbach, Wehner, Mahlzahn (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 185.
[62] Vgl. Neubauer, Beivers (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 6.
[63] Vgl. Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 235.
[64] Vgl. Geissler, Wörz, Busse (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 38.
[65] Vgl. Neubauer, Ujlaky, Beivers (2010), in: Busse, Schreyögg, Tiemann (Hrsg.), S. 245.
[66] Vgl. Geraedts (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 101.
[67] Vgl. Schaeffer, Ewers (2001), S. 13.
[68] Vgl. Fuchs (2003), in: Hermanns, Hanisch (Hrsg.), S. 43f.; Weilnhammer (2005), S. 11.
[69] Vgl. Böhlke, Söhnle, Viering (2005), zitiert nach Geraedts (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 98.
[70] Vgl. Geraedts (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 101.
[71] Vgl. Reschke (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 150.
[72] Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2010).
[73] Vgl. Weigl (2008), S. 8ff.
[74] Vgl. Reschke (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 153.
[75] Mit Bezug auf die Qualitätssicherung dürfen Leistungen nicht erbracht werden, die die erforderliche Mindestmenge bei planbaren Leistungen voraussichtlich nicht erreichen. Vgl. SGB V §137.
[76] Vgl. Heinrich (2011), S. 43.
[77] Vgl. Heinrich (2011), S. 9.
[78] Vgl. Deutz (1999), S. 18.
[79] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 1.
[80] Vgl. Neudam, Haeske-Seeberg (2011), in: Klauber et al. (Hrsg.), S. 82, Heinrich (2011), S. 44. Jedoch sei an dieser Stelle angemerkt, dass durch die im KHG festgelegte Trägervielfalt davon ausgegangen werden kann, dass auch in Zukunft hier keine rein marktwirtschaftliche Gestaltung der Krankenhausanzahl erfolgt. Vgl. Geraedts (2010), in: Klauber, Geraedts, Friedrich (Hrsg.), S. 102 i.V.m. KHG §1 Abs. 2.
[81] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 132.
[82] Vgl. Dierks, Schwartz (2001), in: Dierks et al. (Hrsg.), S. 7.
[83] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 132f.
[84] Vgl. Dierks, Schwartz (2001), in: Dierks et al. (Hrsg.), S. 89.
[85] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 134.
[86] Vgl. Dierks, Schwartz (2001), in: Dierks et al. (Hrsg.), S. 8.
[87] Vgl. Deutz (1999), S. 21.
[88] Vgl. Dierks, Schwartz (2001), in: Dierks et al. (Hrsg.), S. 8.
[89] Etgeton (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 40.
[90] Vgl. Fleige, Philipp (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 107.
[91] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 59.
[92] Vgl. Sibbel (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 190.
[93] Weilnhammer (2005), S. 164.
[94] Vgl. Sibbel (2011), in Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 190.
[95] Vgl. Fleige, Philipp (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 108.
[96] Vgl. Clausen (2010), S. 44.
[97] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 164.
[98] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 134.
[99] Vgl. Weilnhammer (2005), S. 132f.
[100] Vgl. Cassel (2002), in: Arnold, Klauber, Schellschmidt (Hrsg.), S. 10.
[101] Vgl. Dierks, Schwartz (2001), in: Dierks et al. (Hrsg.), S. 2.
[102] Vgl. Fleige, Philipp (2011), in: Fischer, Sibbel (Hrsg.), S. 109.
- Quote paper
- Christin Günther (Author), 2012, Direkte Patientenakquisition – Das Management von Patientenbeziehungen als neue Herausforderung im Klinikmarketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202808