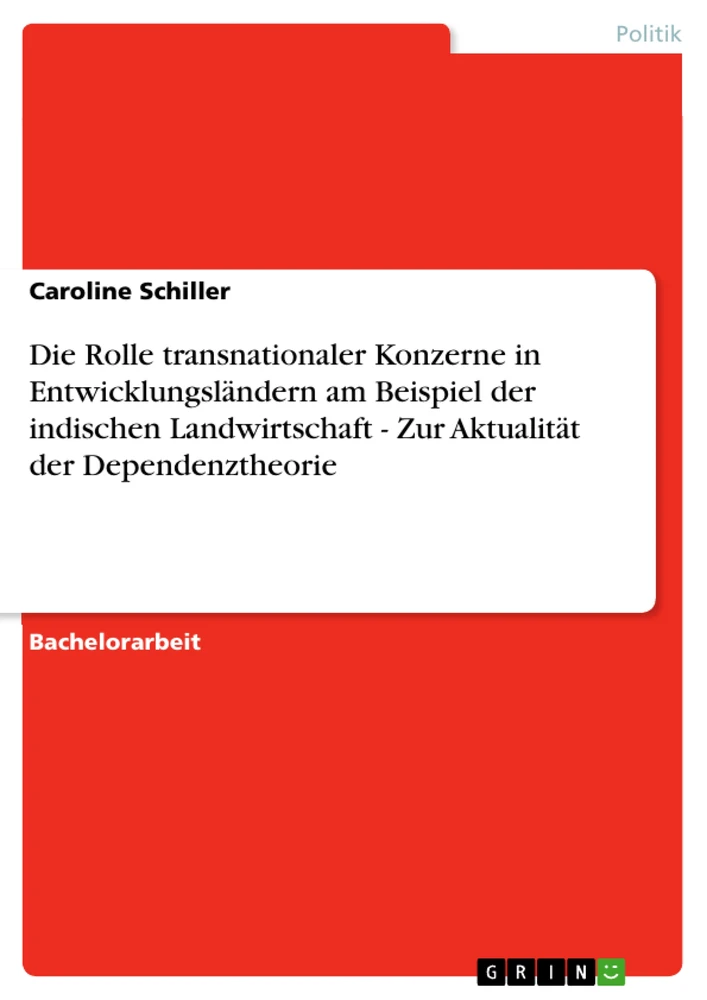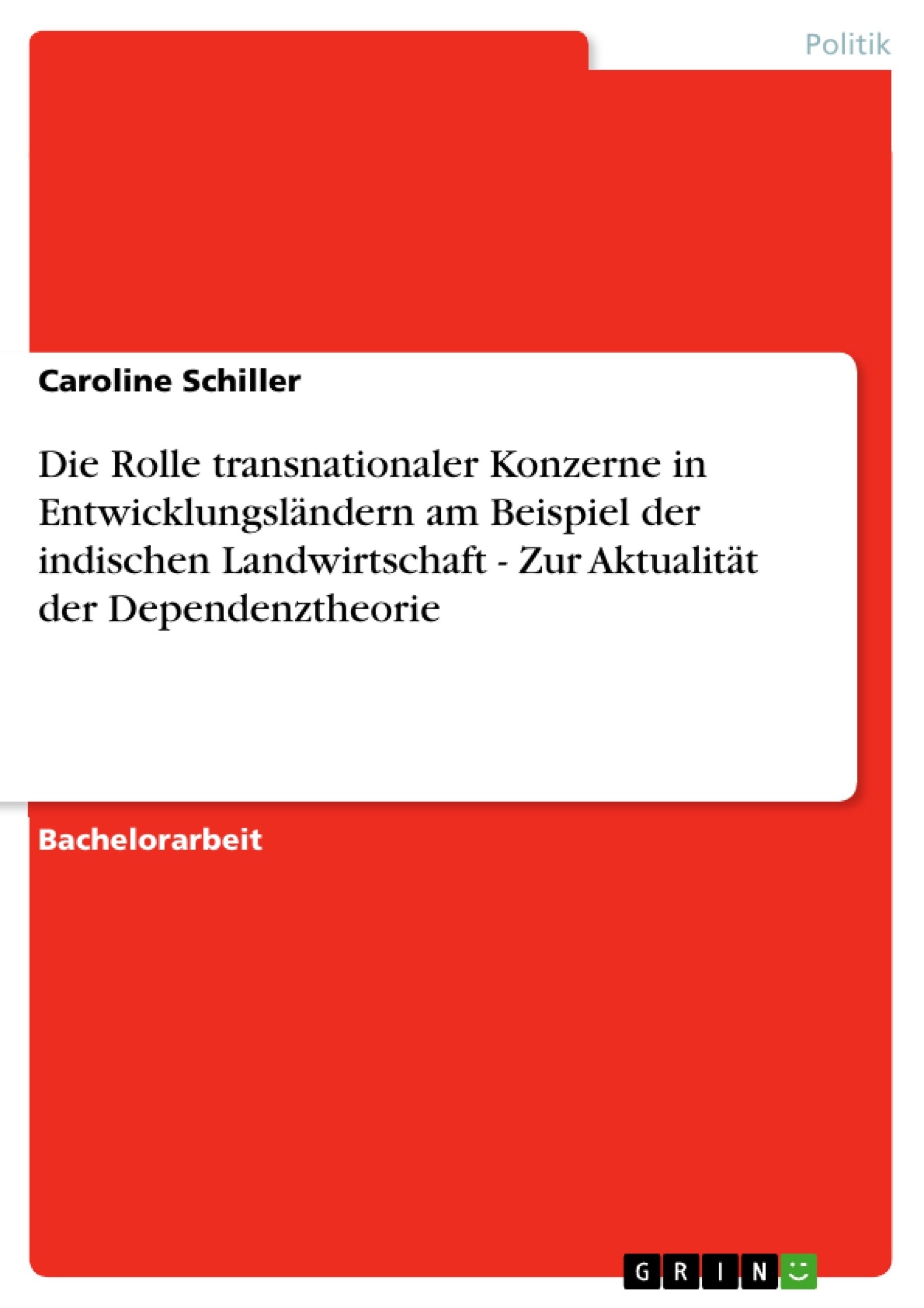Die seit den 1980er Jahren immer schneller voranschreitende Globalisierung hat zur Integration der Volkswirtschaften vieler Entwicklungsländer (EL) in die internationale Produktion und den Welthandel geführt. Dabei ist jedoch von Land zu Land unterschiedlich, ob diese Integration die Entwicklung aller wirtschaftlichen Sektoren fördert und zur Verminderung der Armut beiträgt oder ob sie die Not der Bevölkerung sogar noch vergrößert. Denn die Öffnung der Märkte und Liberalisierung des Handels bedeutet auch eine Zunahme an ausländischen Direktinvestitionen durch Transnationale Konzerne (Transnational Corporations, TNCs) sowie die Verstärkung der internationalen Arbeitsteilung.
Die erhöhte wirtschaftliche Aktivität von TNCs in Entwicklungsländern bedingt auf der einen Seite zwar wirtschaftliches Wachstum. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Negativeffekte, die unter anderem an der sozialen Situation einzelner Bevölkerungsgruppen erkennbar sind. In Indien beispielsweise müssen Kleinbauern als Folge der internationalen Arbeitsteilung von der Subsistenzwirtschaft (der gebrauchswertorientierten Produktion für den Eigenbedarf sowie lokale und regionale Märkte) zur kommerzialisierten Form der Landwirtschaft übergehen, um größere Mengen für den Export zu produzieren. Dafür Anbau bedarf es heutzutage jedoch einer kapital- und chemikalienintensiven Methode des Landbaus sowie des Gebrauchs von gentechnisch verändertem Saatgut, wodurch Transnationale Agrarkonzerne profitieren.
Einer dieser Konzerne ist Monsanto, ein Transnationales Agrarunternehmen mit Sitz in den USA, der in Indien u.a. die gentechnisch veränderte Bt-Baumwolle (oder auch Bt cotton) vertreibt. Laut Konzern steigert Bt cotton den Ertrag und verringert die Kosten für Bauern, sodass es aktiv zur Armutsminderung beiträgt. Doch seit einigen Jahren häufen sich Beiträge in Presse und Literatur, die Sorte halte nicht das, was sie verspreche, sondern führe vor allem unter den Kleinbauern Indiens zu hohen Schulden und sogar Selbstmord. Monsanto hingegen mache durch den Verkauf des Saatguts Millionengewinnen. Anhand dieses Beispiels diskutiert die vorliegende Arbeit, ob und inwieweit die Tätigkeiten Transnationaler Konzerne positive oder negative Folgen für Entwicklungsländer haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Dimensionen der Dependenztheorie
- 2.1 Entstehungsgeschichte und theoretischer Ursprung
- 2.2 Kernaussagen
- 2.3 Modelltheoretisches Fundament
- 2.4 Theoretische Ansätze
- 2.4.1 Strukturalistischer Ansatz
- 2.4.2 Die Ausbeutungsthese
- 2.4.2.1 Indirekte Ausbeutung
- 2.4.2.2 Direkte Ausbeutung
- 2.5 Merkmale Transnationaler Konzerne
- 2.6 Die dependenztheoretische Sicht auf Transnationale Konzerne
- 3 Transnationale Konzerne in Entwicklungsländern – Das Beispiel Indien und Bt cotton
- 3.1 Die Rolle Transnationaler Agrarkonzerne in Entwicklungsländern
- 3.2 Indien - Schwellen- oder Entwicklungsland?
- 3.3 Geschichte des indischen Agrarsektors von der Kolonialzeit bis heute
- 3.4 Was ist Bt cotton?
- 3.5 Die Einführung von Bt cotton in Indien
- 3.6 Der Misserfolg von Bt cotton in Andhra Pradesh
- 3.6.1 Finanzielle und soziale Folgen für die indischen Kleinbauern
- 3.6.2 Die wirtschaftlichen Gewinne Monsantos
- 4 Die Konsequenzen der wirtschaftlichen Tätigkeit Transnationaler Konzerne in Entwicklungsländern – Globalisierungsproblem oder Folge struktureller Abhängigkeit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Aktivitäten transnationaler Konzerne in Entwicklungsländern anhand des Beispiels der indischen Landwirtschaft und Bt cotton. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und inwieweit die Tätigkeit dieser Konzerne positive oder negative Folgen für Entwicklungsländer hat. Als theoretischer Rahmen dient die Dependenztheorie, die die Ursachen für die Unterentwicklung und Armut von Entwicklungsländern in der spezifischen Einbindung in den von den kapitalistischen Staaten beherrschten Weltmarkt sieht.
- Die Rolle transnationaler Konzerne in Entwicklungsländern
- Die Bedeutung der Dependenztheorie für die Analyse der Beziehung zwischen Entwicklungsländern und transnationalen Konzernen
- Das Beispiel Indien und die Einführung von Bt cotton
- Die Auswirkungen von Bt cotton auf die indischen Kleinbauern
- Die aktuelle Relevanz der Dependenztheorie in Bezug auf die globalen Wirtschaftsbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei stellt die Dependenztheorie vor und grenzt sie von der Modernisierungstheorie ab. Kapitel drei beleuchtet die Geschichte des indischen Agrarsektors und konzentriert sich auf die Einführung von Bt cotton in Andhra Pradesh im Jahr 2002, sowie die daraus resultierenden Folgen für die dort ansässigen Kleinbauern. Kapitel vier diskutiert dieses Beispiel mit Hilfe der Dependenztheorie und zeigt die Auswirkungen der Aktivitäten transnationaler Konzerne auf Entwicklungsländer.
Schlüsselwörter
Transnationale Konzerne, Entwicklungsländer, Dependenztheorie, Globalisierung, Indien, Landwirtschaft, Bt cotton, Kleinbauern, Ausbeutung, strukturelle Abhängigkeit.
- Quote paper
- Caroline Schiller (Author), 2011, Die Rolle transnationaler Konzerne in Entwicklungsländern am Beispiel der indischen Landwirtschaft - Zur Aktualität der Dependenztheorie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202785