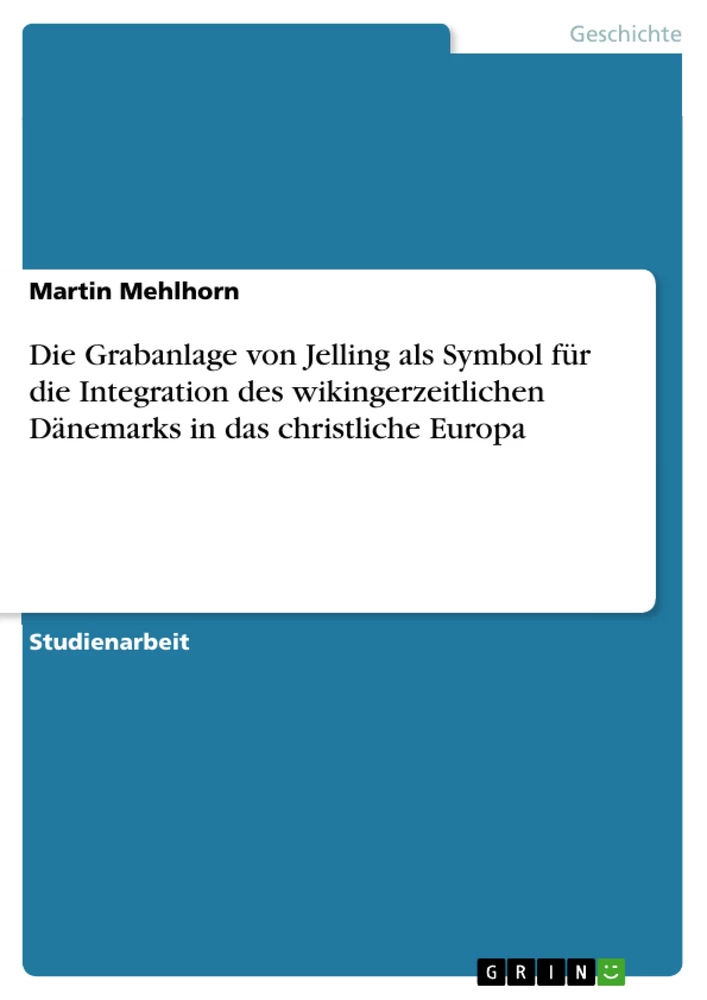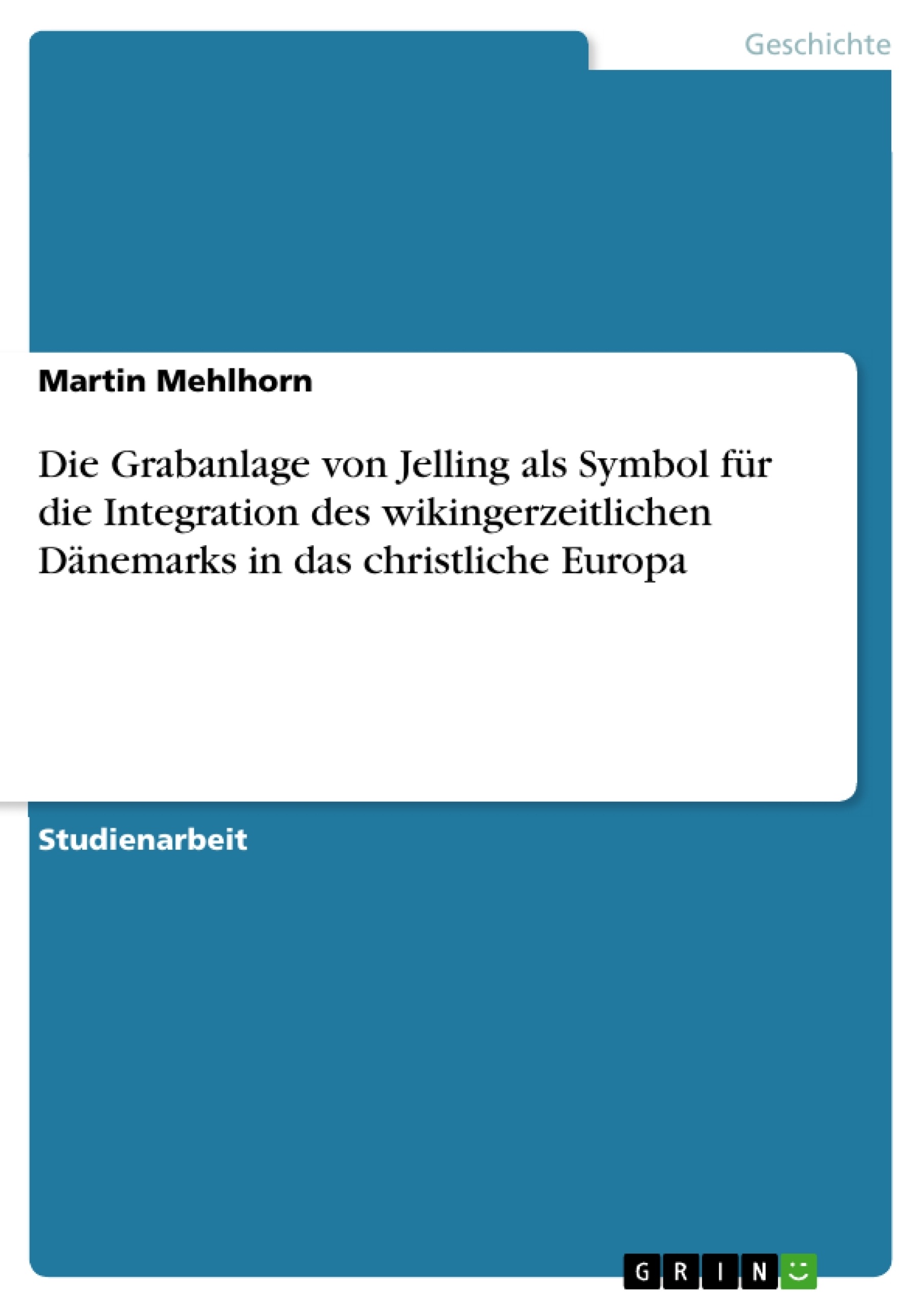Der kleine Ort Jelling im Herzen Jütlands zählt heute etwa 3000 Einwohner. Jährlich zieht er aber 150 000 Besucher an. Verantwortlich für dieses große Interesse ist ein einmaliges Monument aus der Wikingerzeit, welches seit 1994 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Es kündet davon, dass es eine Zeit gab, in der Jelling Königsitz einer gleichnamigen Dynastie war und die Geschichte Dänemarks genau an dieser Stelle eine maßgebliche Wendung erfuhr. Die Protagonisten dieser Veränderung, König Gorm und sein Sohn Harald Blauzahn, werden in schriftlichen Quellen über das 10. Jahrhundert fassbar und in Kombination mit deren archäologischem Vermächtnis entsteht ein Bild, welches eine Vorstellung von der Zeit vermittelt, als das Land den Schritt vom Heiden- zum Christentum und damit in das christliche Europa hinein vollzog.
Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass die spärlichen schriftlichen Überlieferungen über den Ort Jelling als Königsitz um den archäologischen Befund erweitert werden müssen, um sich ein aussagekräftiges Bild machen zu können. Nachdem ausführlich auf die einzelnen Elemente eingegangen wurde, die dem Komplex in Jelling erst in der Gesamtbetrachtung zu seiner Bedeutung verhelfen, soll der Befund interpretiert werden. Dabei wird sich zeigen, dass die Wissenschaft zwar eine wahrscheinliche Erklärung für das einmalige Ensemble aus Runensteinen, Grabhügeln und Kirche gefunden hat, sie aber gut beraten wäre dieser Erklärung keinen Alleingültigkeitsanspruch zuzusichern. Dafür sind noch zu viele Fragen ungeklärt, die einen fruchtbaren Diskurs mit sich bringen könnten, wenn nicht von den meisten Historikern und Archäologen schon ein Schlussstrich gezogen worden wäre, wo noch keiner gezogen werden sollte.
Abschließend soll vor Augen geführt werden, dass der Übertritt Dänemarks zum Christentum, versinnbildlicht durch die Taufe Harald Blauzahns um 965 , nicht zufällig im 10. Jahrhundert stattfindet. Er ist das Resultat einer langen Entwicklung und christlichen Durchdringung des Landes, an deren Ende ein einmaliges Symbol gleichsam für nationale Identität und europäische Integration steht - die Anlage von Jelling.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Grabanlage von Jelling
- 1.1 Der Königsitz Jelling in schriftlichen Quellen
- 1.2 Der archäologische Befund
- 1.2.1 Überblick über die Anlage von Jelling
- 1.2.2 Die Runensteine
- 1.2.3 Nordhügel und Grabkammer
- 1.2.4 Südhügel und Steinsetzung
- 1.2.5 Kirche und Kirchengrab
- II. Interpretation des archäologischen Befundes
- 2.1 Die Translatio-Hypothese
- 2.2 Jelling - ein Einzelfall?
- 2.3 Offene Fragen und Alternativtheorien
- III. Dänemark am Übergang vom Heiden- zum Christentum
- 3.1 Die Dänen und das Christentum
- 3.2 Verbindungen zwischen Harald Blauzahn und Otto dem Großen
- 3.3 Jelling als National- und Integrationssymbol
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Grabanlage von Jelling als Symbol für die Integration des wikingerzeitlichen Dänemarks in das christliche Europa. Die Zielsetzung besteht darin, die spärlichen schriftlichen Quellen mit dem umfangreichen archäologischen Befund zu verknüpfen, um ein umfassendes Bild des Übergangs Dänemarks zum Christentum zu erhalten und verschiedene Interpretationen des Fundkomplexes zu diskutieren.
- Die Grabanlage von Jelling: Archäologische Befunde und ihre Interpretation
- Die Runensteine von Jelling als Quellen und ihre Symbolik
- Die Rolle Haralds Blauzahns bei der Christianisierung Dänemarks
- Jelling als nationales und europäisches Integrationssymbol
- Alternativtheorien zur Interpretation der Grabanlage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Grabanlage von Jelling und ihre Bedeutung als UNESCO-Weltkulturerbe vor. Sie führt die zentralen Akteure, König Gorm und seinen Sohn Harald Blauzahn, ein und skizziert die Forschungsfrage: Wie lässt sich der Übergang Dänemarks zum Christentum anhand der schriftlichen Quellen und der archäologischen Funde in Jelling rekonstruieren? Die Arbeit verspricht eine ausführliche Analyse der einzelnen Elemente der Anlage und deren Interpretation, wobei auch alternative Theorien zur Debatte stehen.
I. Die Grabanlage von Jelling: Dieses Kapitel präsentiert zunächst die wenigen schriftlichen Quellen, die sich auf Jelling als Königsitz beziehen, wobei die Werke von Saxo Grammaticus und Sven Aggesen kritisch gewürdigt werden. Der Schwerpunkt liegt dann auf der detaillierten Beschreibung der archäologischen Funde: die zwei großen Grabhügel, die Runensteine (großer und kleiner Jellingstein), die Kirche und das Kirchengrab. Für jedes Element werden die Funde, ihre Datierung und die verschiedenen Deutungsansätze ausführlich dargestellt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der komplexen Zusammensetzung der Anlage, bestehend aus sichtbaren und nur archäologisch erschlossenen Komponenten.
II. Interpretation des archäologischen Befundes: Dieses Kapitel widmet sich der Interpretation der in Kapitel I präsentierten Funde. Im Mittelpunkt steht die Translatio-Hypothese von Krogh, die die Überführung Gorms aus seinem heidnischen Grab in die christliche Kirche postuliert. Vergleichbare Fälle in Skandinavien werden diskutiert, um die Einzigartigkeit Jellings zu beleuchten. Der Abschnitt „Offene Fragen und Alternativtheorien“ kritisiert die Translatio-Hypothese und beleuchtet alternative Erklärungen, unter Einbezug von unterschiedlichen Deutungen der Funde (z.B. die Identität der im Kirchengrab begrabenen Person), die die Geschichte der Anlage von Jelling in ein komplexeres Licht rücken.
III. Dänemark am Übergang vom Heiden- zum Christentum: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Christianisierung Dänemarks. Es werden die langjährigen Missionsbemühungen und der synkretistische Charakter des Glaubenswechsels erörtert. Die Beziehungen zwischen Harald Blauzahn und Otto dem Großen werden beleuchtet, um die machtpolitischen Aspekte der Christianisierung zu verdeutlichen. Das Kapitel schließt mit einer Analyse der Bedeutung Jellings als Symbol für nationale Identität und Integration in das christliche Europa, wobei die geschickte Kombination heidnischer und christlicher Elemente in der Anlage hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Jelling, Harald Blauzahn, Gorm der Alte, Thyra, Christianisierung, Wikingerzeit, Runensteine, Grabanlage, Translatio-Hypothese, nationales Integrationssymbol, archäologische Befunde, heidnisches Christentum, ottonisches Reich, Dänemark.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Grabanlage von Jelling
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Grabanlage von Jelling in Dänemark und ihre Bedeutung als Symbol für die Integration des wikingerzeitlichen Dänemarks in das christliche Europa. Sie verknüpft schriftliche Quellen mit archäologischen Befunden, um den Übergang Dänemarks zum Christentum zu rekonstruieren und verschiedene Interpretationen der Funde zu diskutieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Grabanlage von Jelling (archäologische Befunde und Interpretation), die Runensteine von Jelling und ihre Symbolik, die Rolle Haralds Blauzahns bei der Christianisierung Dänemarks, Jelling als nationales und europäisches Integrationssymbol und alternative Theorien zur Interpretation der Grabanlage.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf schriftliche Quellen wie die Werke von Saxo Grammaticus und Sven Aggesen (kritisch gewürdigt) sowie auf den umfangreichen archäologischen Befund der Grabanlage von Jelling. Dieser umfasst die beiden großen Grabhügel, die Runensteine (großer und kleiner Jellingstein), die Kirche und das Kirchengrab.
Welche zentralen Figuren werden behandelt?
Zentrale Figuren sind König Gorm der Alte und sein Sohn Harald Blauzahn. Die Arbeit untersucht deren Rolle im Prozess der Christianisierung Dänemarks und deren Beziehung zur Grabanlage von Jelling.
Was ist die Translatio-Hypothese?
Die Translatio-Hypothese von Krogh postuliert die Überführung Gorms aus seinem heidnischen Grab in die christliche Kirche. Die Arbeit diskutiert diese Hypothese kritisch und beleuchtet alternative Erklärungen.
Welche Interpretationen der Grabanlage werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Interpretationen der Grabanlage, einschließlich der Translatio-Hypothese und alternativer Theorien. Sie berücksichtigt unterschiedliche Deutungen der Funde und deren Bedeutung für die Geschichte Jellings.
Wie wird der historische Kontext der Christianisierung Dänemarks dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Christianisierung Dänemarks, die langjährigen Missionsbemühungen, den synkretistischen Charakter des Glaubenswechsels und die machtpolitischen Aspekte der Christianisierung im Kontext der Beziehungen zwischen Harald Blauzahn und Otto dem Großen.
Welche Bedeutung hat Jelling als Symbol?
Jelling wird als Symbol für nationale Identität und Integration in das christliche Europa analysiert. Die geschickte Kombination heidnischer und christlicher Elemente in der Anlage wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jelling, Harald Blauzahn, Gorm der Alte, Thyra, Christianisierung, Wikingerzeit, Runensteine, Grabanlage, Translatio-Hypothese, nationales Integrationssymbol, archäologische Befunde, heidnisches Christentum, ottonisches Reich, Dänemark.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel (Die Grabanlage von Jelling; Interpretation des archäologischen Befundes; Dänemark am Übergang vom Heiden- zum Christentum) und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern und einer Zusammenfassung der Kapitel.
- Quote paper
- Martin Mehlhorn (Author), 2011, Die Grabanlage von Jelling als Symbol für die Integration des wikingerzeitlichen Dänemarks in das christliche Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202632