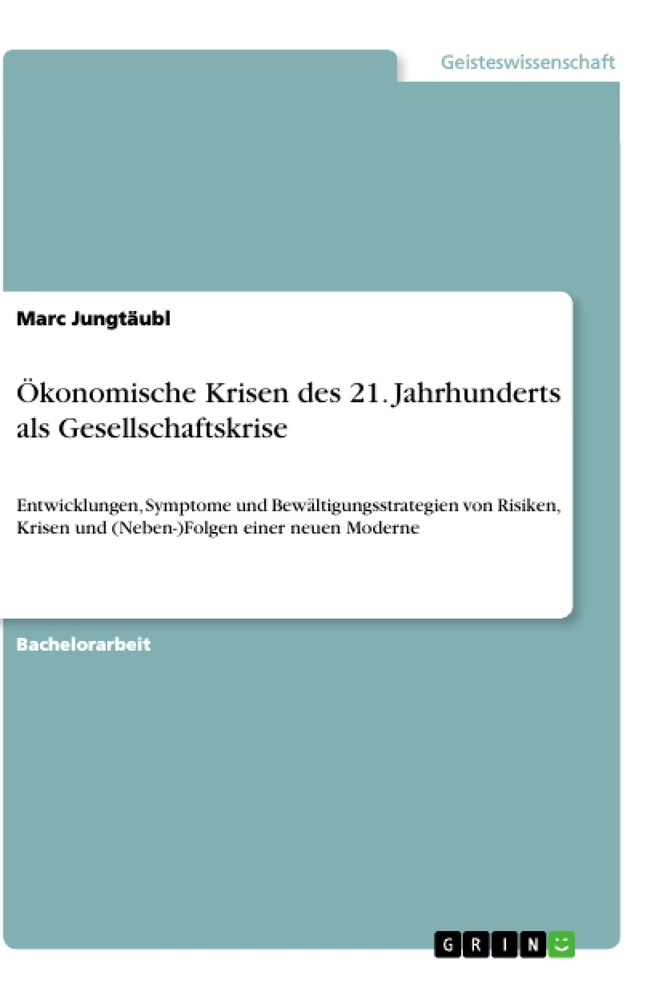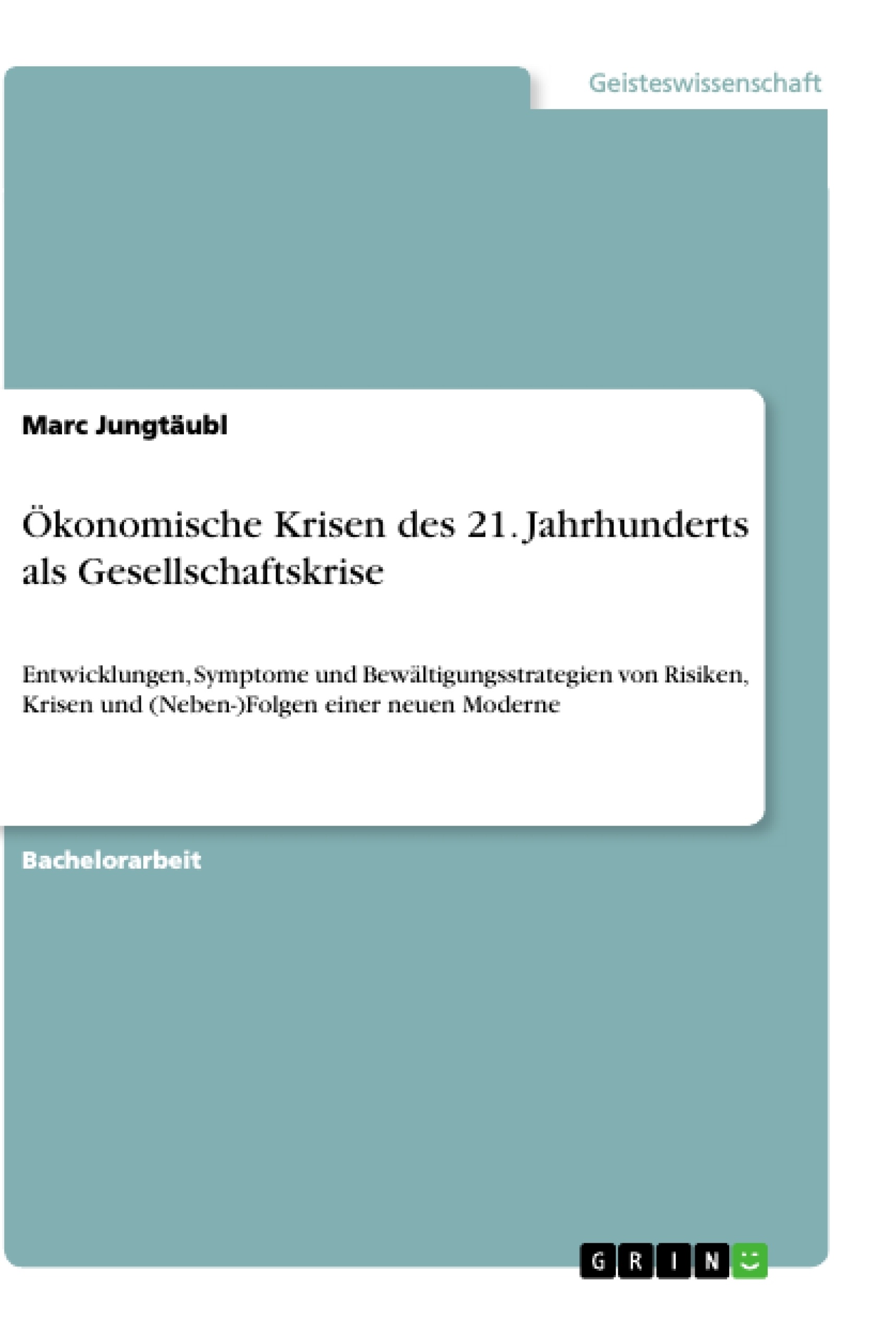In Anbetracht diverser Krisen drängt sich die Frage auf, ob der aktuelle (Turbo-/Finanz-) Kapitalismus zu Krisen noch größeren Ausmaßes und noch größeren gesellschaftlichen Verwerfungen tendiert, als ohnehin bisher soziale Ungleichheit einhergehend mit der Logik kapitalistischen Handelns entstand. Besteht die Gefahr von Gesellschaftskrisen bzw. inwieweit liegen diese bereits vor?
In einem ersten Schritt werden vor einem historischen Hintergrund grundlegende (wirtschaftliche) Fakten und Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts beleuchtet, sowie die Fragen aufgeworfen, wie es zur Entfesselung des Marktes und seiner Macht kam und wie es darüber hinaus in der Folge der historischen Entwicklungen zu den heutigen Missständen und prekären Situationen kommen konnte und ob bzw. welche Alternativen existieren.
Darauf aufbauend wird an den Beispielen Europas und den USA untersucht, welche gesellschaftlichen Auswirkungen die jüngste Krise des Kapitalismus für Gesellschaften hat und ob sich die zerstörerischen Tendenzen der entwucherten Form kapitalistischen Handelns auch andernorts zu katastrophalen Entwicklung potenzieren können. Stets im Fokus dabei stehen jeweils gesellschaftliche Folgen, um auf mögliche künftige Entwicklungen schließen zu können und Alternativen bzw. Handlungsvorschläge herausarbeiten zu können.
In einem zweiten Schritt werden die gesellschaftlichen Folgen und Charakteristika des Finanzkapitalismus aus Perspektive der Theorie reflexiver Modernisierung betrachtet. Darüber hinaus sollen zum einen Lösungsansätze präsentiert und diskutiert werden, zum anderen schließlich ein Ausblick auf weitere drohende Gefahren und Risiken sowie eine kritische Stellungnahme erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hintergrund
2.1 Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik und feste Wechselkurse
2.2 Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft/der Finanzmärkte
2.3 Krisen(-entwicklungen) eines „neuen“ Kapitalismus
3 Ökonomische Krisen des 21. Jahrhunderts
3.1 Entstehung, Verlauf und Eskalation
3.2 Steigerung zur Gesellschaftskrise
3.2.1.. Die (Gesellschafts-) Krise in Griechenland
3.2.2. Die (Gesellschafts-) Krise in weiteren Staaten
4 Perspektiven
4.1 Die Theorie reflexiver Modernisierung
4.2 Krisen einer neuen Moderne
4.3 Lösungsansätze für eine neue Moderne, ihre Krisen und Ursachen
4.3.1. Erfahrungswissen zur Bewältigung der Krisennormalität
4.3.2 Politische und wirtschaftliche Ansätze
4.3.3.. Erneuerung und Besinnung: Alternatives Denken, Handeln und neue Moral
5 Resümee und Schlusswort
Literaturverzeichnis.
1 Einleitung
Die kapitalistische Organisation der Wirtschaft hat seit Zerfall der Sowjetunion und des Sozialismus (sowie insbesondere der Planwirtschaft) im Jahre 1991 neben den Staaten des „Westens“, in denen diese Form der („Gesellschafts-") und Wirtschaftsorganisation sich mit dem Frühkapitalismus bereits im 15. Jahrhundert zu manifestieren begonnen hatte, auch in diesen ehemaligen sozialistischen Staaten Einzug gehalten. Waren sich bis zur Auflösung der Sowjetunion noch diese zwei Arten von Systemen konträr gegenübergestellt, so existiert – bis auf wenige Ausnahmen – weltweit nur noch die oftmals als „überlegen“ bezeichnete, da (bisher vermeintlich) „siegreiche“ kapitalistische Wirtschaftsordnung. In Anbetracht jedoch diverser teils schwerer Krisen drängt sich die Frage auf, ob der aktuelle (Turbo-/Finanz-) Kapitalismus[1] zu Krisen noch größeren Ausmaßes und noch größeren gesellschaftlichen Verwerfungen tendiert, als ohnehin bisher soziale Ungleichheit einhergehend mit der Logik kapitalistischen Handelns entstand. Besteht so letztlich gar die Gefahr von Gesellschaftskrisen bzw. inwieweit bedeuten die aktuellen Weltfinanz- und Schuldenkrisen bereits tiefe Krisen in und für Gesellschaften?
Speziell betrachtet hierfür wird im Folgenden der historische Hintergrund, der grundlegende Fakten und Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts beinhaltet. Wie kam es zur Entfesselung des Marktes und seiner Macht? Wie konnte es darüber hinaus in der Folge dieser Entwicklungen zu den heutigen Missständen und prekären Situationen (besonders, aber bei Weitem nicht nur) in finanzieller Hinsicht kommen und gibt es Alternativen?
Darauf aufbauend wird an den Beispielen Europas und Griechenlands untersucht, welche gesellschaftlichen Auswirkungen die jüngste Krise (seit 2007) dieses Kapitalismus für dortige Gesellschaften hat, ob sich die zerstörerischen Tendenzen der entwucherten Form (finanz-) kapitalistischen Handelns auch in anderen Nationen zu einer derartig katastrophalen Entwicklung potenzieren können. Darüber hinaus soll kurz und dieser Argumentationslinie folgend in einem „Überblick“ die Situation in den USA seit Ausbruch der Krise beleuchtet werden. Stets im Fokus dabei sollen jeweils gesellschaftliche Folgen stehen, um letzten Endes perspektivisch auf mögliche künftige Entwicklungen schließen zu können und ggf. Alternativen bzw. Handlungsvorschläge für von der Krise betroffene Akteure herausarbeiten zu können.
Des Weiteren sollen die gesellschaftlichen Folgen und die Charakteristika des Finanzkapitalismus aus Perspektive einer neuen Moderne unter Zuhilfenahme der Theorie reflexiver Modernisierung stehen (Kap. 4). Darüber hinaus sollen – unter 4.2 und 4.3 – zum einen Lösungsansätze präsentiert und diskutiert werden, zum anderen unter 5. schließlich ein Ausblick auf m. E. nach weitere drohende Gefahren und Risiken sowie eine kritische Stellungnahme erfolgen.
Zuvor sei noch angemerkt, dass der Titel dieser Arbeit zwar Krisen im Plural thematisiert und dies in der Arbeit wohl auch berücksichtigt wird und diverse Krisen behandelt werden. Mittlerweile jedoch werden die fortdauernden Finanz-, Euro- und Schuldenkrisen oftmals als Schuldenkrise (singulär) zusammengefasst. Entgegen des Gefahrlaufens einer Vereinheitlichung und singulären Betrachtung (bspw. hinsichtlich medialer Berichterstattung), sollen diese Krisen aber keineswegs generalisiert werden. Es handelt sich um mehrere Krisen, die zu einer Großkrise und in diesem Sinne evtl. doch „singulären“ Gesamtkrise eines wirtschaftlichen Systems geführt haben und in Gesellschaftskrisen resultieren, deren künftiges Konflikt- und Katastrophenpotenzial zum einen nicht oder kaum abschätzbar ist und zum anderen in hohem Maße Unsicherheit, Unplanbarkeit und Pessimismus schürt.
2 Hintergrund
2.1 Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik und feste Wechselkurse
Wirtschaftspolitisches Modell nach Keynes Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in den meisten westlichen (Industrie-)Nationen die sog. nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik in Anlehnung an das Modell von John M. Keynes praktiziert. Eine solche Wirtschaftspolitik sieht staatliche Eingriffe unter Zuhilfenahme fiskalischer und geldpolitischer Instrumente in die Ökonomie vor, um die Nachfrage in einer Volkswirtschaft zu stimulieren und somit gesamtwirtschaftliches Wachstum zu fördern, einen hohen Grad an Beschäftigung herzustellen oder zu sichern, um letztlich mehr Wohlstand zu generieren (vgl. Donges et al. 2010). In diesem Kontext greift der Staat zur Steuerung und Ankurbelung des Konsums und somit unterstützend für die Wirtschaft antizyklisch in die Ökonomie ein, d. h. in Phasen wirtschaftlichen Abschwungs oder Stagnation werden die staatlichen Ausgaben erhöht. Finanziell möglich werden die steigenden Staatsausgaben – zumindest theoretisch – durch in ökonomisch positiven Phasen erwirtschaftete Überschüsse und gebildete Rücklagen. Boomt die Wirtschaft, steigt auch der Konsum, wodurch der Fiskus höhere Steuereinnahmen erwirtschaftet und parallel dazu antizyklisch die Ausgaben drosselt, also selbst weniger als Nachfrager am Markt auftritt. Durch in Boomphasen gebildete Rücklagen kann somit in Rezessionen oder Krisen wiederum die Staatsnachfrage erhöht werden. Nachfrageorientierte, antizyklische staatliche Eingriffe zur Konjunkturbelebung dienen also nach Keynes dazu, den gesellschaftlichen Konsum anzuregen, in dessen Folge wiederum die Unternehmen zur Produktion angeregt werden. Nicht bspw. die Senkung von Löhnen (angebotsorientiert) zur Kostenersparnis soll Unternehmen veranlassen (mehr) zu produzieren, sondern eine steigende Nachfrage, die durch staatliche Anreize wie Sozialleistungen zusätzlich zu stimulieren ist. Die unsichtbare Hand des Marktes wird somit durch einen helfenden Staat unterstützt, um soziale Ungleichheit zu mindern und Wohlstand zu fördern. Als ein konkretes Beispiel für nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik nach Keynes kann der sog. „New Deal“ in den USA angeführt werden. Unter Präsident Franklin D. Roosevelt wurden infolge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er und zu Beginn der 1930er Jahre diverse wirtschaftliche und soziale Reformen durchgeführt, die der angeschlagenen US-Wirtschaft und Gesellschaft aus der Rezession helfen sollten. Hierzu wurden die Staatsausgaben drastisch erhöht und u. a. massiv in Infrastruktur investiert, Sozialversicherungen wie eine Arbeitslosenversicherung und eine staatliche Pensionskasse eingerichtet sowie aber auch die Steuern für Wohlhabende und Reiche erhöht und im Gegenzug steuerliche Erleichterungen für „Arme“ und den Mittelstand gewährt (vgl. Schäfer 2009: 36ff.). Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden ähnliche Maßnahmen auch im vom Krieg stark zerstörten Europa und Japan angewendet, um die dortigen Wirtschaften wieder aufzubauen. Um nach dem Krieg eine stabile Weltwirtschaftsordnung zu schaffen, wurde – ebenfalls in Anlehnung an John M. Keynes – ein System fester Wechselkurse und ein Finanzmarkt unter staatlicher Aufsicht etabliert, um in der Vergangenheit gemachte Fehler und daraus resultierende wirtschaftliche Krisen (Große Depression) sowie deren Folgen künftig zu vermeiden (vgl. ebd.).
Das Bretton-Woods-System Im Jahre 1944 wurde in Bretton Woods in den USA eine internationale Währungs- und Finanzkonferenz abgehalten, an der 44 Nationen (z. B. USA, Frankreich, Griechenland, China, UdSSR, Mexiko uvm.) teilnahmen. Am Ende der Verhandlungen stand ein Abkommen, das Vereinbarungen hinsichtlich der Strukturen der Weltwirtschaft, ihrer Umstrukturierung und vor allem auch bezüglich währungspolitischer Maßnahmen und Regulierungen enthielt und 1945 in Kraft trat.[2] So wurden hinsichtlich der globalen Devisenordnung feste Wechselkurse nationaler Währungen gegenüber dem US-Dollar verabschiedet, um gegen Protektionismus nationaler Ökonomien anzugehen, wie aber auch bspw. um monolaterale Abwertungsprozesse einzelner nationaler Währungen zu begrenzen bzw. zu verhindern. Der US-Dollar als Leitwährung wurde demgegenüber fest an das Edelmetall Gold gekoppelt (35,- $/Feinunze Gold). Der Wechselkurs von US-$ und Gold konnte durch Interventionen des US-Notenbanksystems Fed (Federal Reserve System) mithilfe von Käufen oder Verkäufen kontrolliert, angepasst oder/und konstant gehalten werden. Zur Kontrolle, Durchführung und Unterstützung devisenpolitischer Reglementierungen, des (wirtschaftlichen) Wiederaufbaus vom Krieg vernichteter Nationen sowie aber bspw. auch generell zur Unterstützung (durch Kreditvergabe) ökonomisch unterentwickelter oder/und sich entwickelnder Staaten wurden im Zuge dieses Abkommens die internationalen Organisationen – in Form von Sonderorganisationen der UN (Vereinte Nationen) – der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (kurz auch: Weltbank) und des International Monetary Funds (IMF; Internationaler Währungsfonds IWF) gegründet. Ziel des Abkommens von Bretton Woods war somit u. a. die Schaffung und Aufrechterhaltung eines stabilen internationalen Währungssystems, auf dem die Weltwirtschaft aufbauen und stabil existieren kann, wodurch in der Konsequenz – so die damaligen Absichten und Kenntnisse – der weltweite Wohlstand ausgeweitet und gesteigert werden sollte sowie krisenhafte Tendenzen eines freien Finanzmarktes und ungebändigten Kapitalismus vermieden oder wenigstens begrenzt werden sollten. Mit der Bindung der nationalen Währungen aller teilnehmenden Nationen (deren Anzahl in den Nachkriegsjahren weiter zunahm) an den US-Dollar und dessen Kopplung wiederum an Gold sollte die weltweit sich im Umlauf befindliche Geldmenge gesteuert und stets durch real vorliegendes Gold gedeckt sein (vgl. BMF 2011; Pfister, Fertig 2004; Sylla 2002). Des Weiteren lagen die Absichten dieses Übereinkommens in der Überwachung und Kontrolle der Finanzmärkte, speziell der Kontrolle und kontrollierten Durchführung von Devisengeschäften, die nur mit Genehmigungen und unter Aufsicht des IWF durchgeführt werden durften. Im Allgemeinen existierten zu Zeiten des Bretton-Woods-Systems unter den Bedingungen internationaler Finanzkontrollen weitaus weniger Kapitalbewegungen als in der Post-Bretton-Woods-Ära, da in diesem Kontext bspw. auch „Private internationale Kapitalbewegungen (…) im Wesentlichen auf Direktinvestitionen beschränkt“ (Kamppeter 2011: 3) blieben.
Seit dem Jahr 1969 jedoch kam es aufgrund struktureller Probleme des Bretton Woods Systems dazu, dass die US-Notenbank Fed nicht mehr in Lage war, sämtliche Dollarreserven der verschiedenen Nationen der Welt mit Gold abzudecken, weshalb die USA in der Folge im Jahre 1971 ihre in Bretton Woods eingegangene Verpflichtung aufkündigten und das System fester Wechselkurse allmählich zusammenbrach (offizielle Kündigung 1973). So stellten ab 1971 neben der Fed in den USA erste Notenbanken, wie bspw. die Deutsche Bundesbank, ihre Interventionen zur Aufrechterhaltung fester Wechselkurse ein, wodurch Devisen von nun an frei und flexibel am Markt festgesetzt wurden und bis heute nach wie vor werden (vgl. BMF 2011).
Strukturelle Probleme des Bretton Woods Währungssystems lagen u. a. darin, dass sämtliche an diesem System teilnehmenden Nationen einen Teil ihrer Souveränität abtraten und sich in Abhängigkeit US-geldpolitischer Interventionen begaben. Die Geldpolitik der Vereinigten Staaten jedoch war inflationär geprägt, um die immensen Kosten bspw. für den Vietnamkrieg durch „neues“ Geld zu decken und Handelsbilanzdefizite der USA zu kompensieren, die durch einen wertmäßig höheren Import als Export entstanden. Diese höchst inflationäre Geldpolitik jedoch führte unweigerlich zu einem Vertrauensverlust unter den am Bretton-Woods-System beteiligten Nationen gegenüber dem Dollar-Gold-Konvertibilitätsversprechen der US-Notenbank. Darüber hinaus wollten diverse Staaten und deren Notenbanken die Folgen der US-Geldpolitik nicht mittragen, die zwangsläufig auch Inflationen in anderen Nationen mit sich brachte bzw. zu bringen drohte. So wurde bspw. die Deutsche Mark Mitte 1970 von der Deutschen Bundesbank monolateral aufgewertet, was konträr zum System der festen Wechselkurse lief (vgl. Kamppeter 2011). Derartige, von Notenbanken alleine durchgeführte Aktionen waren Resultat des in den 1950er Jahren einsetzenden Wohlstandszuwachses und damit auch des zunehmenden internationalen Kapitals, dessen Mengen bald die Goldreserven der USA überschritten bzw. die USA mit der Förderung neuen Goldes zur Aufrechterhaltung der Gold-Dollar-Konvertibilität nicht mehr nachkamen. Weitere Mängel des Systems bestanden in der Vakanz eindeutiger Regelungen zur Anpassung der Wechselkurse der einzelnen Teilnehmernationen und der Benachteiligung der Staaten – ausgenommen die USA – die defizitäre Handelsbilanzen aufzuweisen hatten. So konnten festgelegte Wechselkurse nur dann angepasst respektive variiert werden, wenn ein tief gehendes Währungsungleichgewicht, ein „fundamental balance-of-payments disequilibrium“ (Sylla 2002: 81; vgl. Pfister/Fertig 2004), vorlag. Insgesamt lässt sich gegen Ende des Bretton-Woods-Systems festhalten, dass sich aufgrund der hohen Inflationsrate in den USA und der sich immer verstärkt gegen die US-Geldpolitik sträubenden und handelnden Notenbanken anderer Mitgliedsnationen die Goldkonvertibilität des US-Dollars auflöste und die Wirtschaften der entsprechenden Nationen – speziell auch die der USA – sich immer mehr von einer Realwirtschaft, in der monetäre Ressourcen an die reale wirtschaftliche Entwicklung und Produktion gekoppelt sind, zu einer Finanzwirtschaft und Finanzgeschäften entwickelten. Als Folge hieraus und mit der Aufkündigung der festen Wechselkurse entstanden unter Beeinflussung bzw. durch einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie bedingt flexible Wechselkurse und allmählich Finanzmärkte, wie sie heute aufzufinden sind.
2.2 Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft/der Finanzmärkte
Schon vor dem Bretton-Woods-System existierten wirtschaftliche Regulierungen und feste Währungsregulierungen, wie bspw. der Goldstandard der Jahre 1870-1914, die jedoch auch immer wieder abgeschafft und durch freie, flexible Pendants ersetzt wurden. Infolge sowohl der Abschaffung des Goldstandards mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges sowie während des Krieges eingeführter Kapitalkontrollen als auch nach Aufkündigung des Bretton-Woods-Systems Anfang der 1970er Jahre zeigte sich jedoch die Krisenanfälligkeit freier Finanzmärkte in beeindruckender Weise. Bevor es aber zu der letztgenannten Entwicklung kommen konnte, bedurfte es der Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte und der Etablierung flexibler und freier Wechselkurse. Den Anstoß hierfür lieferte die sog. Chicago School (hier: wirtschaftswissenschaftlich) u. a. um Milton Friedman, der der Auffassung war, dass eine keynesianische und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik und –regulierung inklusive fester Wechselkurse und überwachter Finanztransaktionen lediglich zu unflexiblen Preisen und Löhnen führt, auf deren Basis wiederum ein nationales und auch speziell internationales Marktgleichgewicht nicht hergestellt werden kann. Dem Gegenargument, dass vollkommen freie Märkte zwangsläufig und historisch betrachtet zu übermäßigen Spekulationen führen, hielt Milton entgegen, dass derartige Spekulationen sich stabilisierend auf die Märkte auswirken und Überhand nehmende Spekulationen wiederum durch die unsichtbaren Kräfte des Marktes – der zu Gleichgewichten tendiert – von selbst ausgesondert werden. Der neoliberale (in den USA auch als Neokonservatismus bezeichnete) Ansatz, der in letzter Konsequenz zu dem Paradigmenwechsel weg von nachfrageorientierter und hin zu angebotsorientierter Wirtschaftspolitik führte, hatte/hat zum Hauptziel, den Markt zu „entfesseln“ und von staatlichen Eingriffen zu befreien, sodass der Markt selbst zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage finden kann, da auch nur eben dieser dazu vollkommen in der Lage ist. In dieser Hinsicht sind auch die flexiblen Wechselkurse zu sehen und zu etablieren, sodass Devisenkurse sich frei bilden und ihren Volkswirtschaften (theoretisch) leistungsgerecht jeweils optimal anpassen können, nationale Zentralbanken eigenständig auf dem Devisenmarkt agieren und intervenieren können, um Inflationen (oder ggf. Deflationen) zu bekämpfen und Staaten – ganz im Allgemeinen – das „absolut ideale[n] System[s] (…) des radikal freien Marktes (…)“ (Schröder 2009: 2) nicht stören. In (neo-) liberaler Argumentation sind es so auch die Staaten, die durch ihre Interventionen die perfekten Marktabläufe empfindlich stören und es somit infolge externer Eingriffe irgendwann zu krisenhaften Anomalien kommt bzw. kommen muss. Krisen sind von diesem Standpunkt aus betrachtet also jeweils von „außen“ in den Markt getragen; ihre Ursachen sind keinesfalls im Markt zu suchen, der auf vollkommener Rationalität beruhend, dem stetigen Verfolgen von Eigeninteressen (unter Voraussetzung vollkommener Information; Homo oeconomicus) treu bleibend und daraus resultierend der Nutzenmaximierung für Marktteilnehmer ohne externe Einflüsse einwandfrei funktionieren würde. Staatsaktivitäten die Märkte betreffend dienen lediglich der Schaffung und dem Schutze von Rahmenbedingungen, wie z. B. dem Schutz von Eigentum, die Gewährleistung von Sicherheit gegenüber „externen“ und „internen“ Einflüssen oder auch die Etablierung und Sicherstellung von Vertragssicherheit (vgl. ebd.). Im Weiteren sind in Zusammenhang mit dem Rückzug des Staates dessen Unternehmen zu privatisieren, wobei dies im idealen Falle sämtliche Institutionen betrifft, wie bspw. das Bildungswesen oder das Gesundheitssystem. Damit einhergehend bedeutet der Rückzug bzw. die Verkleinerung des Staates um das größtmögliche Maß auch den Abbau des Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaates.[3] Darüber hinaus sind nach Friedmans und neoliberalem Standpunkt die Steuern, speziell auch die Unternehmenssteuern, zu senken, wodurch den Konsumenten mehr Mittel zum Konsum zur Verfügung stehen und – vielmehr noch – den Unternehmen auf der anderen Seite mehr Mittel zur Investition und günstigeren Produktion. Der neoliberale Staat hat zusätzlich zum bisher Genannten deregulierend zu wirken, indem ggf. bestehende Markt- oder/und Preiskontrollen, Mindestlöhne, Subventionen und – im Sinne des Freihandels – Zölle, Embargos etc. sowie aber auch die bereits näher aufgeführten festen Wechselkurse beseitigt werden.
Die theoretischen Folgen aus der Realisierung der beschriebenen Voraussetzungen für einen derartig neoliberal organisierten Staat sind sinkende Arbeitslosigkeit, geringere Staatsausgaben parallel und teils einhergehend mit dem Abbau von Bürokratie, steigende Produktion und somit steigendes Angebot der Unternehmen sowie mehr Investitionen der Unternehmen und steigender Konsum der Gesellschaft wie aber auch mehr Konkurrenz auf dem Markt, die einerseits zu mehr Innovationen führt und andererseits ein quasi natürliches Selektionsmittel für nicht Markt taugliche Produkte (und Teilnehmer) darstellt.
In der Praxis wurde das neoliberale Paradigma ca. seit 1971 mit der Präsidentschaft von Richard Nixon in den USA nach und nach durchgesetzt. War die Nachkriegsperiode mit dem Bretton-Woods-System noch von wirtschaftlichem Aufschwung und steigendem Wohlstand verbunden, führte der Vietnamkrieg der USA und eine damit verbundene Steigerung der US-Dollar-Geldmenge zu einer Inflation, die durch steigende Rohölpreise noch verstärkt wurde. In der Konsequenz drohten die Ökonomien der USA und weiterer (Industrie-) Nationen in eine Rezession zu rutschen; das Wachstum schrumpfte oder stagnierte, die Zahl der Arbeitslosen stieg. Die ersten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Tendenzen unter Nixon werden auch als „Nixon-Schock“ (Schäfer 2001: 41) bezeichnet, da zur Stabilisierung der US-Finanzen verhängt wurde, sowohl Löhne und Preise über drei Monate nicht zu erhöhen als auch zusätzlich dazu einen Sonderzoll von 10 % auf Importgüter zu erheben (vgl. ebd.). Auf diese Weise sollte die Geldmenge stabil gehalten und der Konsum ausländischer Waren durch inländische Produkte (teilweise) substituiert werden. Gleichzeitig jedoch stand das System fester Wechselkurse aufgrund der vorliegenden $-Inflation bereits unter großem Druck, da nun auch fremde Notenbanken und $-Besitzer damit begannen, ihre Währungsreserven in Gold umzutauschen. Nachdem absehbar war, dass die Goldreserven der USA den weltweiten Dollar-Bedarf bzw. die Dollar-Nachfrage nicht decken konnten, tauschten die USA von Juni 1971 an keine US-Dollar mehr gegen Gold ein. Das Ende des Bretton-Woods-Systems war besiegelt. In den darauf folgenden Jahren war die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierungen ehemals staatlicher oder teilstaatlicher Unternehmen geprägt. Die Aufkündigung des Systems fester Wechselkurse hatte dabei den freien und flexiblen Devisenhandel an Börsen und somit variable und stark schwankende Währungskurse zur Folge, was wiederum in der Konsequenz auch (zunehmende) Spekulationen mit sich brachte, die ihrerseits wiederum in den darauf folgenden Jahren auf weitere Bereiche, wie bspw. den Rohstoffmarkt oder gar den Lebensmittelmarkt, „übergriffen“. Deregulierungen und Liberalisierungen ergaben sich unter Nixon – speziell im Zusammenhang mit den Finanzmärkten – auch für den Finanzdienstleistungssektor in den USA.
Als Beispiele für die Privatisierungen und die Deregulierung diverser Wirtschaftszweige können in den USA die Entmonopolisierung der Telefonbranche wie auch des Energiesektors angeführt werden (vgl. Schäfer 2001: 43). Für die Kapitalmärkte bedeutete das „neue“ wirtschaftspolitische Paradigma eine Abkehr von der Orientierung realwirtschaftlicher Entwicklung und Produktion sowie die Öffnung der Finanzmärkte für ausländische Finanzdienstleister. Waren bis zur Nixon-Ära der Kredit- wie auch Wertpapierhandel, speziell darunter die Aktienmärkte, auf jeweils inländische Transaktionen beschränkt und bspw. nur regionale Banken zur Kreditvergabe befugt (bzw. war dies der Habitus), so öffneten sich diese Märkte von nun an ebenfalls für überregionale und ausländische Anbieter. Finanzielle Mittel zur Bereitstellung von Krediten wurden nunmehr nicht wie zuvor aus (nationalen) Spareinlagen finanziert, sondern konnten international bezogen werden und separierten sich einerseits sowohl von ihrem ehemals realwirtschaftlichen Äquivalent als auch von den „Guthaben“ (z. B. Spareinlagen) von Anlegern. Die starken Finanzregulierungen der US-Notenbank, die bisher zumindest für eine gewisse Kontrolle der Preise und Geldmenge standen und ein gleichmäßiges Wirtschaftswachstum zum Ziel hatten, wurden aufgehoben, die Börsenaufsicht reduziert und Märkte geschaffen für neue, spekulative und kurzfristigere Anlageformen. Nach und nach etablierten sich so neue Formen von Finanzdienstleistern wie bspw. Investmentbanken, Pensions- und Hedgefonds u. a., deren Ziel die Profitmaximierung in möglichst kurzen Zeitspannen ist und mittels immer neu entstehender „Wertpapiere“ u. Ä. realisiert werden sollen (exemplarisch darunter: Derivate, Optionsscheine, Swaps, private-equity-fonds etc.) (vgl. ebd.: 43ff.).
Letzten Endes entstanden durch die Liberalisierung der Finanzmärkte nicht nur Spekulationsblasen in den Folgejahrzehnten, sondern in Kombination mit der Deregulierung und Liberalisierung der „Kredit- und Hypothekenmärkte“ auch die Voraussetzungen für die Verbriefung von Krediten und Hypotheken in sog. „mortgage backed securities“ u. Ä. sowie deren Handel, was wiederum das Entstehen und Explodieren einer weiteren Spekulationsblase und daraus resultierend eine Immobilienkrise und nachfolgend die Weltfinanz- und Schuldenkrise mit sich brachte. Während diese Entwicklungstendenzen ihren Ursprung in den USA hatten, folgten bald darauf weitere Nationen dem Paradigmenwechsel hin zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik und einer Abkehr vom „starken Staat“; so bspw. ab 1986 auch Großbritannien unter M. Thatcher (Thatcherismus) mit der Deregulierung der Finanzmärkte und der Öffnung der Börsen für internationale Akteure oder ebenso Deutschland ab den 1990er Jahren zur Anpassung des deutschen Finanzmarktes an den „neuen“ internationalen Standard.[4] In den USA wiederum erlebte der unter Nixon (bis 1974) eingeleitete Paradigmenwechsel mit dem späteren Präsidenten Ronald Reagan (1981-1989) einen weiteren fördernden Impuls hin zu einer Wirtschaftspolitik und –gestaltung im Sinne der Chicagoer Schule. Im Detail wurden Steuersenkungen durchgesetzt in der Hoffnung, hierdurch einerseits den Konsum zu erhöhen und andererseits – als Hauptabsicht – gerade den Unternehmen durch niedrigere Abgaben weitere Investitions- und Produktionsanreize zu liefern. Als Ziel sollten darüber hinaus durch steigenden Absatz und Konsum die Staatseinnahmen zunehmen (wobei gleichzeitig der Staat selbst „schlanker“ gemacht werden sollte, um Ausgaben einzusparen) – trotz der zuvor erfolgten Steuersenkungen. Im Weiteren sollte die Aufnahme neuer Staatsverbindlichkeiten zurückgefahren bzw. vollständig gestoppt werden und durch höhere Zinsen sollten die Preise stabilisiert werden (vgl. Schäfer 2009: 53ff.). Hierüber hinaus ein wichtiges Kriterium im Zuge der Deregulierung (speziell des Bankensektors) war außerdem die Abschaffung fester Zinsen für regionale Sparkassen (savings banks), wodurch nun auch diese ihrerseits variabel die Zinsen für Darlehensnehmer gestalten konnten und mussten. Parallel zu den Erhöhungen des Leitzinses durch die Fed zur Inflationsbekämpfung jedoch erhöhten sich die langfristigen Hypothekendarlehenszinsen rasant auf teilweise beinahe 19 % (ebd.). Die Deregulierung der Finanzmärkte setzte sich in späteren Jahren auch unter der Präsidentschaft Bill Clintons fort, der verantwortlich dafür war, dass sämtliche bis dato noch existente Beschränkungen für Finanzdienstleister zur nationalen Expansion abgeschafft wurden. Neben den ohnehin flexibel gestalteten Zinssätzen bei regionalen Sparkassen kam nun starker Konkurrenzkampf hinzu und überdies in viel höherem Maße erschwerend zudem, dass die Verantwortung von Finanzdienstleistern für eine jeweilige (wirtschaftliche) regionale Entwicklung durch das Profitstreben und die Konkurrenz zu anderen, neu hinzugetretenen Akteuren im Finanzsektor unterminiert wurde. Einher mit dieser Deregulierung unter Clinton ging des Weiteren die Abschaffung der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung von Investitions- und Geschäftsbanken, was in der Konsequenzen einerseits zu wachsenden Geschäftsfeldern und Tätigkeiten führte, andererseits aber auch die Komplexität des Bankensektors steigerte und die Konkurrenzsituation erneut anhob (vgl. ebd.: 87).
Die Auswirkungen sowie nicht erwarteten und nicht bedachten Nebenfolgen, die sich aus dem Wandel der Wirtschaftspolitik – nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weit über deren Grenzen und auch die Grenzen der westlichen entwickelten Nationen hinaus – entwickelten, werden nachfolgend eingehender beleuchtet.
2.3 Krisen(-entwicklungen) eines „neuen“ Kapitalismus
Die soeben beschriebenen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und ihrer freieren Gestaltung versprachen bereits nach kurzer Zeit positive Auswirkungen. So erlebte bspw. Großbritannien nach der angebotsorientierten Umstellung der Wirtschaftspolitik und den damit verbundenen Umstrukturierungen der Ökonomie unter Thatcher eine kurze Erholung, die aber bereits Ende der 1980er Jahre wieder abflaute, in eine erneute Rezession folgte und u. a. steigende Arbeitslosenzahlen mit sich brachte. Ähnlich verhielt es sich in den USA, in denen die Steuersenkungen und weiteren Investitions- und Produktionsanreize für Unternehmen zwar vorerst zu fruchten schienen, jedoch schon bald von hohen Zinsen „aufgefressen“ wurden. Zwar stand einem Teil der Bevölkerung und den Unternehmen durch niedrigere Steuerbelastungen theoretisch mehr Kapital für Konsum und Investition zur Verfügung, doch die Geldpolitik des US-Präsidenten und der Notenbank, die Zinsen anzuheben, um die Inflation gering zu halten und die Preise zu stabilisieren, führte dazu, dass die Nachfrage nach Krediten stark zurückging und somit sowohl die Konsumenten als auch die Unternehmen ihre Nachfrage nach Darlehen drosselten. In der Folge war auch die US-Wirtschaft von einem erneuten Rückfall in eine Rezession bedroht. Diese aufzufangen sollte abermals mit Steuersenkungen gelingen, die ihrerseits wiederholt verhinderten, dass der US-Staat keine weiteren Schulden aufnahm – ganz im Gegenteil: Die Steuerreformen unter Reagan gingen dem Staat mit 700 Mrd. US-Dollar zulasten und die simultane Erhöhung von Rüstungsausgaben veranlassten im Weiteren zur Aufnahme von 200 Mrd. US-$ neuer Kredite. Insgesamt verdoppelten sich die Schulden der USA unter Reagan auf zwei Billionen USD im Jahr 1989 (vgl. Schäfer 2011: 56f.).
Generell betrachtet und nun auch hinsichtlich kritischer Auswirkungen sind in der Phase der Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte bzw. seither sowie nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems statistisch gesehen die meisten Finanzkrisen der Geschichte zu verorten, speziell in sog. „sich entwickelnden“ Nationen der Erde. Derartige Krisen sind wie folgt definiert:
„ Finanzkrisen sind Störungen des Finanzsektor, die mit schweren Problemen bei der Versorgung mit Geld und Krediten verbunden sind. Sie können durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden: Schocks an den Wertpapiermärkten, politische Verknappung von Krediten, Druck auf Wechselkurse und Währungen, technologische Entwicklungen (durch Veränderungen der Produktions- und Investitionsstruktur), politische Ereignisse und anderes mehr. In den meisten Fällen geht den Krisen ein Boom voraus, in dem die Geld- und Kreditmenge stark steigt und die Risiken auch durch spekulative Finanzanlagen zunehmen. Wenn die Spekulationsblase platzt, kommt es zu massiven Zusammenbrüchen und/oder zu plötzlichen Kapitalabflüssen. Von deren Folgen sind auch nicht-spekulative Investoren, das ökonomische Wachstum, die Beschäftigung und der Wohlstand großer Bevölkerungsteile betroffen.“ (BpB 2010a; Hervorhebung im Original)
Die Bemessungsgrundlage für die Ausmaße einer solchen Krise stellen die „Kreditausfallrate[n], (…) fiskalischen Kosten (…) [und] die krisenbedingten Wachstumsverluste (…)“[5] (ebd.) dar. Krisen größeren Ausmaßes werden unter Erfüllung mindestens einer der folgenden drei Bedingungen als solche bezeichnet: (1) die Kreditausfallrate übersteigt 20 %, (2) der Staat büßt 1/5 seiner Einnahmen ein oder (3) das Wirtschaftswachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt sinkt um mindestens 10 % (vgl. ebd.). Wagt man im Kontext der soeben angeführten Indikatoren einen historischen Rückblick auf vergangene Krisen, so zeigt sich u. a., dass es seit dem 19. Jahrhundert in (westlichen) industriell entwickelten und entwickelteren Staaten tendenziell absolut mehr Krisen gegeben hat als in anderen Nationen. Allerdings waren die Ausmaße und Folgen solcher Krisen für betroffene Staaten und Gesellschaften dort weniger tief greifend als bspw. in sich entwickelnden Nationen. Das soll heißen, dass Krisen in Industrienationen z. B. seltener zu Staatsinsolvenzen geführt haben, als dies in sich entwickelnden Staaten zu beobachten ist. Im Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg veränderten sich jedoch die Umstände und es ist festzustellen, dass seither kaum irgendeine Nation der Erde von Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrisen verschont geblieben ist, wobei wiederum im Besonderen seit den 1970er Jahren ein verstärktes Auftreten großer Krisen auszumachen ist und lediglich im kurzen Zeitraum der beiden Dekaden der 1950er und 60er relativ weniger krisenhafte Erscheinungen auftraten (vgl. BpB 2010a). Diese Erscheinungen hängen wiederum scheinbar stark von der Geschwindigkeit des Globalisierungsprozesses ab, der sich im 20. Jahrhundert und darin speziell seit dem Zweiten Weltkrieg beschleunigte und intensivierte. Die relativ geringere Anzahl an Krisen nach diesem Krieg mag dabei einerseits darauf zurückzuführen sein, dass in der Periode nach dem Krieg der Wiederaufbau zerstörter Nationen weltweit Vorrang hatte und dadurch – rein ökonomisch gesehen – Ressourcen für eben diese Zwecke verwendet wurden, womit u. a. Baubooms einhergingen.[6] Auf der anderen Seite jedoch erscheint ebenfalls ein Zusammenhang zur in dieser Zeitspanne (wieder) vorherrschenden nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik und dem Keynesianismus zu bestehen sowie zum System fester Wechselkurse. Vor diesem Hintergrund wiederum ist es auffällig, dass mit dem Zusammenbruch des letztgenannten Systems und der abermaligen Angebotsorientierung im Sinne der Chicagoer Schule speziell seit den 1970er Jahren wieder vermehrt und gerade große Krisen auftraten und auftreten.
Hervorragende Beispiele für Krisen des Finanzsektors in verschiedenen Nationen, deren gesellschaftliche Folgen in keinem Falle zu vernachlässigen und die anhand der im Folgenden dargestellten Ausmaße teils offensichtlich zu folgern sind – jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht explizit betrachtet werden können –, sind die argentinischen Krisen der Jahre 1980, 1989, 1995 und 2001, die Staats- und Wirtschaftskrisen Mexikos 1981 und 1994 oder die Krisen asiatischer Länder im Zuge der Asienkrise[7] Ende der 1990er Jahre (siehe Tabelle):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Datenquelle: Laeven, Valencia 2008; vgl. BpB 2010a)
Darüber hinaus sind ebenfalls seit den 1970er Jahren insgesamt 124 Banken-, 326 Währungs- sowie 64 staatliche Verschuldungskrisen zu zählen (vgl. Laeven, Valencia 2008; BpB 2010a).
Zusätzlich zu den Entwicklungen der Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte im betreffenden Zeitraum kommt mit ihrer Gründung (1960) der OPEC im Laufe der folgenden Jahrzehnte eine maßgebliche Rolle in diesem Prozess zu. Mit der Festsetzung des Ölpreises durch diese Organisation und die Erhöhung des Selbigen ergaben sich weitreichende Konsequenzen für die Import- und Produktionskosten Erdöl importierender Nationen (und Unternehmen). Durch die immensen Kosten, die der Erwerb von Erdöl aus OPEC-Staaten mit sich brachte,[9] erfolgte eine Abwertung des US-Dollars durch „Flutung“ des Marktes mit durch den Erdölhandel erwirtschafteten sog. „Petro-Dollars“, die wiederum zu großen Teilen – begünstigt und gar erst möglich durch die Öffnung nationaler Börsen für den internationalen Handel sowie der Öffnung des Finanzsektors für internationale Finanzdienstleister – in Form von Investitionen aus den OPEC-Staaten zurück in die industrialisierten Länder flossen. Aufgrund der hohen Investitionen und der gestiegenen Geldmenge entstand neues Geldvolumen bspw. zur Vergabe von Krediten u. Ä.
[...]
[1] Seit ca. den 1970/1980er Jahren; siehe ausführlicher unter 2.2 und 2.3.
[2] Bereits während des Ersten Weltkrieges wurden in diversen Nationen wie den USA u. a. Kapitalkontrollen eingeführt, darunter im Speziellen sog. „short term capital movement controls“ (Sylla 2002), um kurzfristige Kapitalflüsse und Investitionen zu kontrollieren sowie Spekulationen zu unterbinden. Nach dem Krieg wurden diese Kontrollen wieder abgeschafft, was als eine begünstigende Voraussetzung für die in den späten 1920er und frühen 1930er Jahre auftretende Weltwirtschaftskrise erachtet wird (vgl. ebd.).
[3] Der nach Friedman gar als nicht moralisch zu bezeichnen ist, verteilt er doch Ressourcen der Wohlhabenden zwangsweise redistributiv an nicht Wohlhabende.
[4] Konkret auf Großbritannien bezogen bedeutete dies ebenfalls Privatisierungen, die Reduzierung des Staates, Steueranpassungen (der Spitzensteuersatz wurde gesenkt, die Umsatzsteuer angehoben) wie aber auch eine „Entmachtung der Gewerkschaften“ (ebd.: 49) durch den sog. „Employment Act“ (ebd.).
[5] Die Wachstumsverluste werden gemessen an der Differenz des durchschnittlichen BIPs der drei Vorjahre und dem in der Krise errechneten BIPs (vgl. BpB 2010a).
[6] Man betrachte hier bspw. das sog. Deutsche Wirtschaftswunder der 1950er Jahre.
[7] Asienkrise: Ausgegangen ebenfalls infolge von Deregulierungen und Liberalisierungen besonders im Finanzsektor und in diesem Zuge mitunter auch der Abschaffung fester Wechselkurse der thailändischen Währung (vgl. Dieter 2002).
[8] Ausfall der Steuereinnahmen oder/und „Wegfall“ der Staatseinnahmen durch Investition in Wachstumsprogramme gegen die Krise (vgl. BpB 2010a).
[9] Gleiches gilt für andere Erdöl fördernde Nationen, die die Preise ebenfalls anpassten.
Häufig gestellte Fragen
Wann wird eine ökonomische Krise zur Gesellschaftskrise?
Eine Gesellschaftskrise entsteht, wenn wirtschaftliche Verwerfungen wie Schulden- oder Finanzkrisen zu tiefer sozialer Ungleichheit, Unsicherheit, Pessimismus und dem Zusammenbruch sozialer Sicherungssysteme führen, wie am Beispiel Griechenlands gezeigt wird.
Was war das Ziel des Bretton-Woods-Systems?
Das 1944 geschaffene System sollte durch feste Wechselkurse und die Bindung des US-Dollars an Gold eine stabile Weltwirtschaftsordnung schaffen und protektionistische Fehler der Vergangenheit vermeiden.
Was besagt die Theorie der reflexiven Modernisierung?
Diese Theorie betrachtet die Risiken und Krisen der heutigen Gesellschaft als Nebenfolgen der Moderne selbst. Sie analysiert, wie die Gesellschaft mit den Unsicherheiten umgeht, die sie durch technologischen und ökonomischen Fortschritt selbst erzeugt hat.
Was versteht man unter nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik nach Keynes?
Hierbei greift der Staat aktiv in die Wirtschaft ein, um die Nachfrage in Krisenzeiten durch Ausgabenerhöhungen (antizyklisch) zu stimulieren und so Beschäftigung und Wohlstand zu sichern.
Welche Rolle spielt der „Finanzkapitalismus“ in der aktuellen Krise?
Der moderne Finanzkapitalismus wird kritisch hinterfragt, da er durch Deregulierung und Entfesselung der Märkte zu Missständen geführt hat, die über rein finanzielle Aspekte hinausgehen und das soziale Gefüge bedrohen.
- Quote paper
- Marc Jungtäubl (Author), 2012, Ökonomische Krisen des 21. Jahrhunderts als Gesellschaftskrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202596