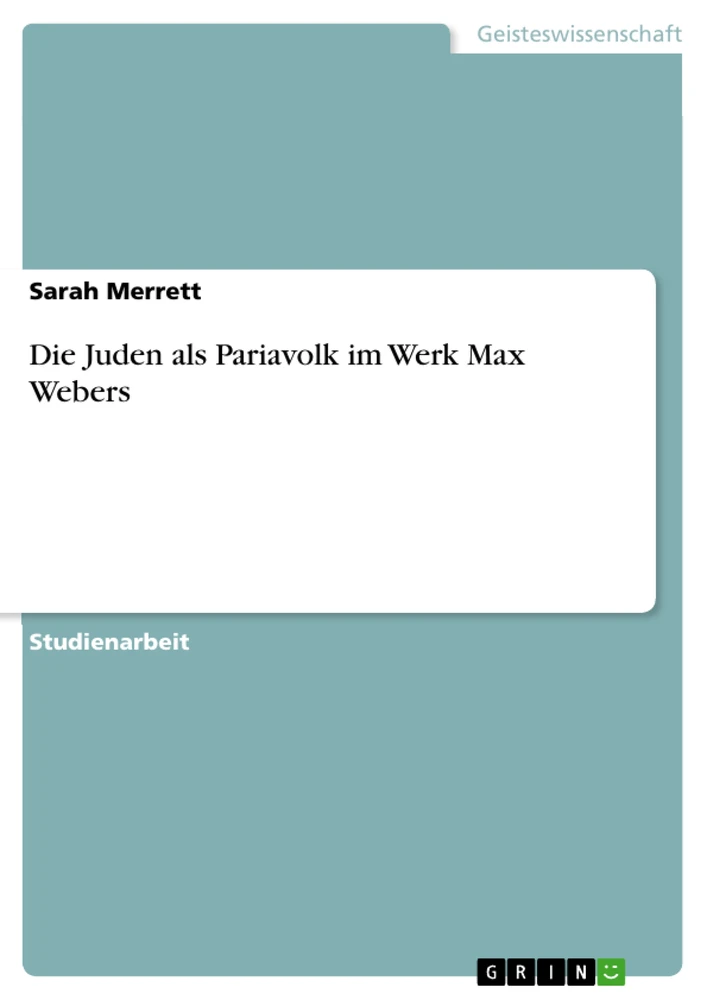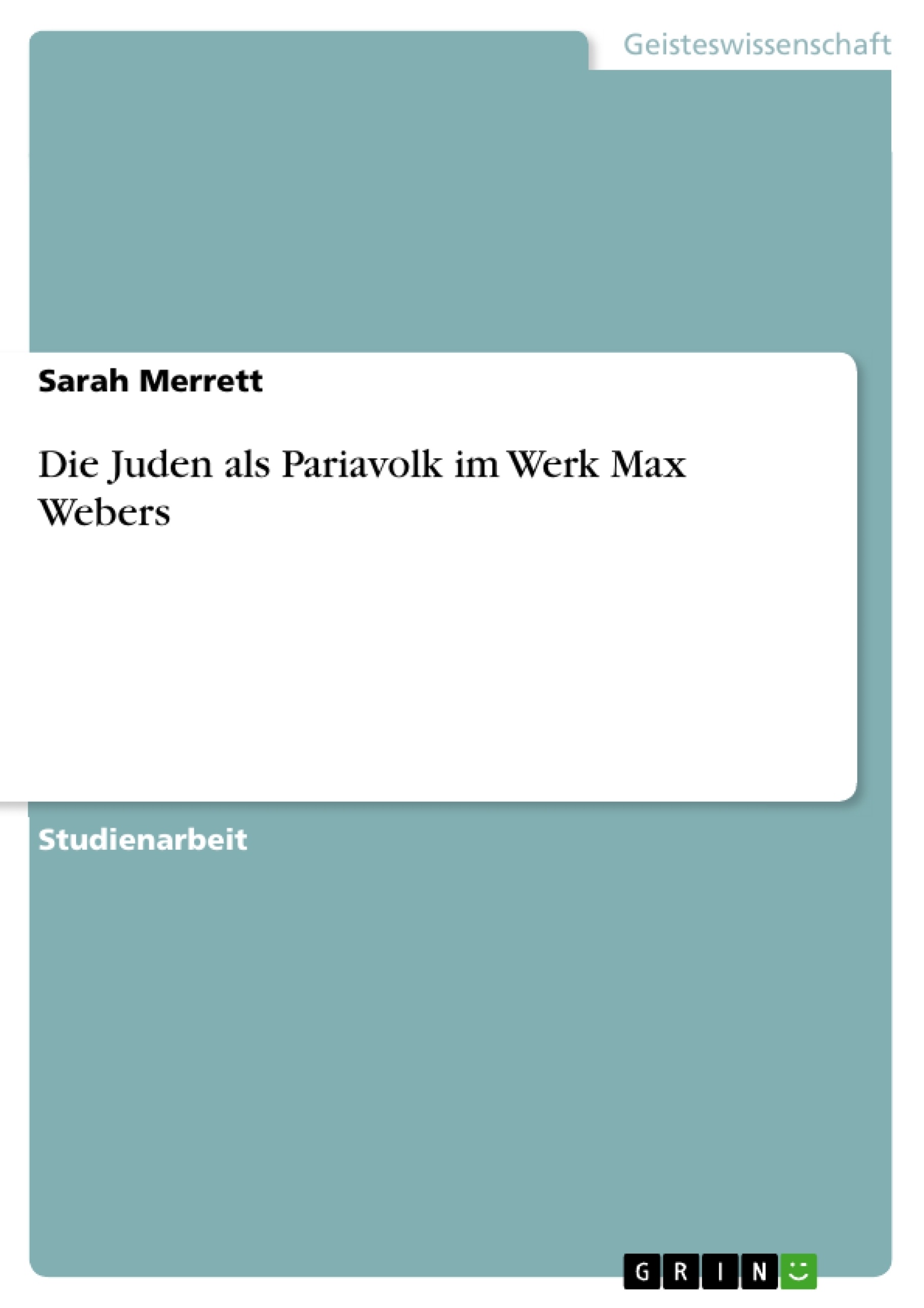Max Weber bezeichnet die Juden als ein „von der sozialen Umwelt geschiedenes Gastvolk“. Hierin sieht er das spezifische Charakteristikum des sogenannten „Pariavolks“. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Wo liegt sein Ursprung und inwiefern ist er auf das jüdische Volk übertragbar? Diese Themen behandelt Weber in einigen seiner Schriften. In dieser Arbeit möchte ich eine knappe Zusammenfassung seiner Hauptthesen wiedergeben, um dann anschließend auch die Frage beantworten zu können, warum letztendlich das antike Judentum zu einem Pariastatus von höchst spezifischer Art gelangt ist.
Hierfür sollen zunächst einmal als Primärliteratur Max Webers religionssoziologische Skizzen über „Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ dienen, an denen er in den Jahren 1911 bis 1914 arbeitete. Genauer werde ich mich überwiegend mit den darin enthaltenen Studien zum „antiken Judentum“ befassen, welche er zusätzlich zu den übrigen „fünf Weltreligionen“ veröffentlichte, weil er darin einige entscheidende geschichtliche Voraussetzungen für das Christentum und den Islam sah und ferner das Judentum eine gewisse Eigenbedeutung für die Entfaltung der modernen europäischen Wirtschaftsethik habe. Zusätzlich möchte ich auch noch einige Sprünge in seine Schriften über den „Hinduismus und Buddhismus“ machen, da Weber bereits in diesen Aufsätzen den Begriff „Pariavolk“ verwendet und definiert, wenn er über das Kastenwesen im Hinduismus schreibt. Zudem werde ich auf einige Stellen in Max Webers „Wirtschaft und Gesellschaft“ verweisen, wo er ebenfalls viele Bezüge zu den Juden als Pariavolk herstellt. Im letzten Kapitel über die Wirtschaftsethik der Juden werde ich überwiegend Webers „Wirtschaftsgeschichte“, sowie die „Protestantische Ethik“ als Literatur verwenden, da hieraus am Deutlichsten die Strukturen der jüdischen Wirtschaftsethik zu erkennen sind, die sehr stark von der Pariavolkslage der Juden abhängen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Max Weber - Kurzbiographie
- Das Pariavolk
- Begriffserklärung
- Die Entwicklung der Absonderung
- Die rituelle Absonderung
- Die „freiwillige Ghettoexistenz“
- Die Verheißungen der Propheten
- „Paria-Kapitalismus“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Max Webers Analyse der Juden als Pariavolk. Sie zielt darauf ab, Webers Kernaussagen zu diesem Thema zusammenzufassen und die Frage zu beantworten, wie das antike Judentum zu einem Pariastatus gelangte.
- Webers Definition des Begriffs "Pariavolk" im Kontext des antiken Judentums
- Die Rolle der rituellen Absonderung in der Entwicklung des Pariastatus
- Die Bedeutung der „freiwilligen Ghettoexistenz“ für die jüdische Identität
- Der Einfluss der prophetischen Verheißungen auf die Pariavolkslage
- Die Verbindung zwischen Pariavolksstatus und jüdischer Wirtschaftskultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit dar: Wie gelangte das antike Judentum zu einem Pariastatus? Sie gibt außerdem einen Überblick über die verwendeten Quellen, vor allem Webers religionssoziologische Skizzen über „Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“.
- Max Weber – Kurzbiographie: Dieser Abschnitt skizziert Max Webers Leben und Wirken, mit besonderem Augenmerk auf seine wissenschaftlichen und politischen Aktivitäten.
- Das Pariavolk - Begriffserklärung: Weber definiert den Begriff „Pariavolk“ im Kontext des antiken Judentums und stellt ihn in Beziehung zum indischen Kastenwesen. Er hebt die Unterschiede zwischen einem Gastvolk und einem Pariavolk hervor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Pariavolk, antikes Judentum, rituelle Absonderung, Ghettoexistenz, Wirtschaftsethik, Max Weber und Religionssoziologie. Die zentrale Frage ist, wie die jüdische Gesellschaft im antiken Kontext zu einer "von der sozialen Umwelt geschiedenen Gastvolk" wurde, wie Weber es formulierte.
- Quote paper
- Sarah Merrett (Author), 2007, Die Juden als Pariavolk im Werk Max Webers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202457