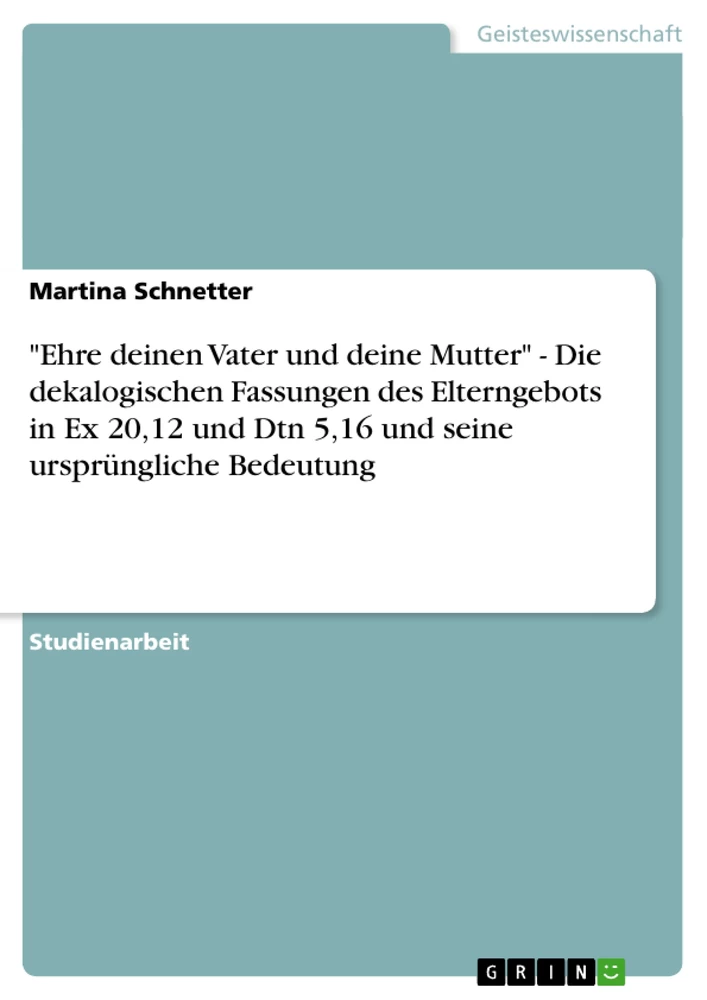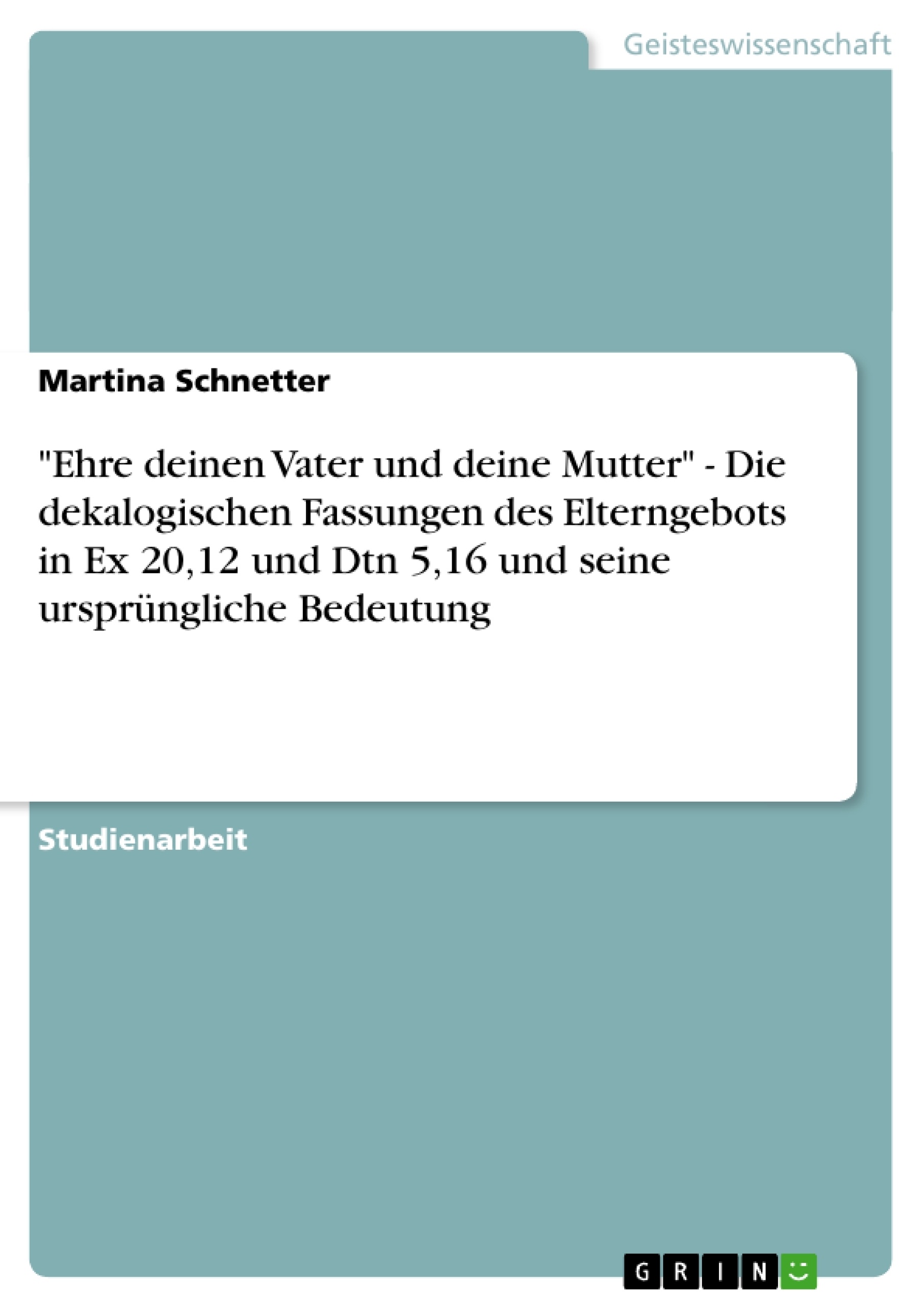Nimmt man das – nach der rezipierten Zählweise – vierte Gebot des Dekalogs als
Ausgangspunkt dieser Hausarbeit, muss man zunächst feststellen, dass es einem
im Alten Testament in zweifacher Gestalt – bedingt durch die beiden
Dekalogfassungen in Ex 20 und Dtn 5 – begegnet. Das Elterngebot stellt das
zweite der beiden positiv formulierten Gebote im Dekalog dar und das letzte, das
eine eigene Begründung bzw. Motivierung besitzt. Die etwas erweiterte Form des
Deuteronomiums bietet zusätzlich einen Rückverweis bzw. eine Zitatformel und
eine Ausweitung der Motivierung.
Unter den anderen Gesetzestexten des Alten Testaments finden sich sowohl
positive als auch negative Versionen des Elterngebots. So heißt es in Dtn 27,16:
„Verflucht, wer Vater oder Mutter schmäht.“ Im Bundesbuch finden sich darüber
hinaus zwei Einschübe im kasuistischen Stil, welche die Todesstrafe für
Handlungen gegen die Eltern (Schläge, Verfluchung) fordern. Die Todesstrafe für
jemanden, der seine Eltern schlägt, findet sich ebenfalls in Lev 20,9 und Spr
20,20. Dagegen ist mit Lev 19,3 auch eine positive Forderung außerhalb des
Dekalogs gegeben. „Fürchten“ bedeutet hier im Gesamtzusammenhang von Lev
19 „Ehrfurcht haben“. An dieser Stelle erscheinen die Eltern schon beinahe als
Repräsentanten Gottes, denen gegenüber die heranwachsenden Kinder die
gleiche Haltung, die das Volk gegenüber Jahwe einnehmen soll, entgegenbringen
sollen.
Lange wurde das Elterngebot auch in der abendländischen Kultur als
Disziplinierungsmittel für Kinder eingesetzt. Gehorsamkeit gegenüber der
elterlichen Autorität wurde in den Katechismen gefordert und so wirkte dieses
Gebot schon von früh an auf die Kinder – nicht selten als erdrückende Last. Selbst
im Katechismus von 1993 ist zu lesen: „Die Kindesliebe zeigt sich in Folgsamkeit
und wahrem Gehorsam. [...] Solange das Kind bei den Eltern wohnt, muß es jeder
Aufforderung der Eltern gehorchen, die seinem eigenen Wohl oder dem der
Familie dient.“ Darüber hinaus wurde das Gebot dahin ausgedehnt, dass es auch
Autoritäten wie Vorgesetzte, Staat und Kirche umfasst.
Decken sich diese Interpretationen aber auch mit dem Ursprungsimpuls des
Elterngebots im Dekalog oder hatte dieses Gebot im Alten Testament zunächst
eine gänzlich andere inhaltliche Belegung?
In der vorliegenden Hausarbeit soll nun einerseits auf die Frage nach dem
ursprünglichen Inhalt des Elterngebots eingegangen werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung zum Dekalog
- Synoptischer Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots in Ex 20,12 und Dtn 5,16
- Vergleich von Ex 20,12 und Dtn 5,16
- Der erste synoptische Unterschied: Das Fehlen des Rückverweises in Ex 20,12
- Der zweite synoptische Unterschied: Die Differenz im Segenshinweis
- Die Motivierung in Ex 20,12 und ihre Parallelen in Dtn 5,16
- Der erweiterte Segenshinweis in Dtn 5,16
- Ergebnis des synoptischen Vergleichs
- Vergleich von Ex 20,12 und Dtn 5,16
- Der ursprüngliche Inhalt des Elterngebots
- Die Stellung des Elterngebots innerhalb des Dekalogs
- Die Adressaten des Elterngebots
- Die Bedeutung des Elterngebots
- Das Elterngebot als Begründung elterlicher Autorität und kindlichem Gehorsam
- Das Elterngebot als Grundlage der religiösen Erziehung bei den Israeliten
- Das Elterngebot als Gewährleistung der sozialen Sicherung der Eltern im Alter
- Fazit zur Bedeutung des Elterngebots
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Elterngebot im Dekalog, insbesondere seine ursprüngliche Bedeutung und den Vergleich der beiden Fassungen in Exodus 20,12 und Deuteronomium 5,16. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Gebots im Laufe der Zeit zu beleuchten und den ursprünglichen Kontext im Alten Testament zu rekonstruieren.
- Synoptischer Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots in Ex 20,12 und Dtn 5,16
- Die ursprüngliche Bedeutung des Elterngebots im Alten Testament
- Die Stellung des Elterngebots innerhalb des Dekalogs
- Die Adressaten des Elterngebots
- Der Einfluss des Elterngebots auf die religiöse und soziale Ordnung im Alten Israel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht das vierte Gebot des Dekalogs, das Elterngebot, in seinen beiden alttestamentlichen Fassungen (Ex 20,12 und Dtn 5,16). Sie beleuchtet die unterschiedlichen Formulierungen und deren Bedeutung im Kontext des Alten Testaments, um den ursprünglichen Sinn des Gebots zu ergründen und dessen Rezeption im Laufe der Geschichte zu betrachten.
Einführung zum Dekalog: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Dekalog, seine Doppelüberlieferung, seine Besonderheiten und seine Stellung innerhalb des alttestamentlichen Rechts. Es werden die verschiedenen Zählungen und die unterschiedlichen Formulierungen der Gebote diskutiert. Der Fokus liegt auf der herausgehobenen Stellung des Dekalogs und seiner Struktur.
Synoptischer Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots in Ex 20,12 und Dtn 5,16: Dieser Abschnitt vergleicht die beiden Fassungen des Elterngebots detailliert. Er analysiert die Unterschiede in der Formulierung, insbesondere das Fehlen des Rückverweises in Exodus und die unterschiedlichen Segenssprüche. Der Vergleich dient dazu, die Entwicklung und die Nuancen in der Bedeutung des Gebots im Alten Testament aufzuzeigen.
Der ursprüngliche Inhalt des Elterngebots: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Klärung der ursprünglichen Bedeutung des Elterngebots. Es untersucht die Stellung des Gebots innerhalb des Dekalogs, den Adressatenkreis und seine Funktion innerhalb der altisraelitischen Gesellschaft. Es werden verschiedene Aspekte der Bedeutung des Gebots, wie z.B. die elterliche Autorität, die religiöse Erziehung und die soziale Absicherung der Eltern im Alter, ausführlich behandelt. Die Analyse zielt darauf ab, den ursprünglichen Impuls des Gebots im Kontext des Alten Testaments zu verstehen.
Schlüsselwörter
Dekalog, Elterngebot, Exodus 20,12, Deuteronomium 5,16, Altes Testament, synoptischer Vergleich, ursprüngliche Bedeutung, elterliche Autorität, kindlicher Gehorsam, religiöse Erziehung, soziale Sicherung, altisraelitische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: "Das Elterngebot im Dekalog"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das vierte Gebot des Dekalogs, das Elterngebot, in seinen beiden alttestamentlichen Fassungen (Exodus 20,12 und Deuteronomium 5,16). Sie analysiert die unterschiedlichen Formulierungen, beleuchtet deren Bedeutung im Kontext des Alten Testaments und ergründet den ursprünglichen Sinn des Gebots sowie dessen Rezeption im Laufe der Geschichte.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen synoptischen Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots in Exodus 20,12 und Deuteronomium 5,16, die Bestimmung der ursprünglichen Bedeutung des Gebots im Alten Testament, die Stellung des Elterngebots innerhalb des Dekalogs, die Bestimmung der Adressaten des Gebots und den Einfluss des Elterngebots auf die religiöse und soziale Ordnung im Alten Israel.
Wie wird der synoptische Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots durchgeführt?
Der synoptische Vergleich analysiert detailliert die Unterschiede in der Formulierung der beiden Fassungen (Exodus 20,12 und Deuteronomium 5,16). Besonderes Augenmerk liegt auf dem Fehlen des Rückverweises in Exodus und den unterschiedlichen Segenssprüchen. Ziel ist es, die Entwicklung und die Nuancen in der Bedeutung des Gebots im Alten Testament aufzuzeigen.
Welche Aspekte der ursprünglichen Bedeutung des Elterngebots werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Stellung des Gebots innerhalb des Dekalogs, den Adressatenkreis und seine Funktion innerhalb der altisraelitischen Gesellschaft. Ausführlich behandelt werden verschiedene Aspekte der Bedeutung des Gebots, wie die elterliche Autorität, die religiöse Erziehung und die soziale Absicherung der Eltern im Alter. Die Analyse zielt darauf ab, den ursprünglichen Impuls des Gebots im Kontext des Alten Testaments zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Dekalog, Elterngebot, Exodus 20,12, Deuteronomium 5,16, Altes Testament, synoptischer Vergleich, ursprüngliche Bedeutung, elterliche Autorität, kindlicher Gehorsam, religiöse Erziehung, soziale Sicherung, altisraelitische Gesellschaft.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Einführung zum Dekalog, einen synoptischen Vergleich der beiden Fassungen des Elterngebots, eine Untersuchung des ursprünglichen Inhalts des Elterngebots und eine Schlussbemerkung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Elterngebots im Laufe der Zeit zu beleuchten und den ursprünglichen Kontext im Alten Testament zu rekonstruieren.
- Quote paper
- Martina Schnetter (Author), 2003, "Ehre deinen Vater und deine Mutter" - Die dekalogischen Fassungen des Elterngebots in Ex 20,12 und Dtn 5,16 und seine ursprüngliche Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20243