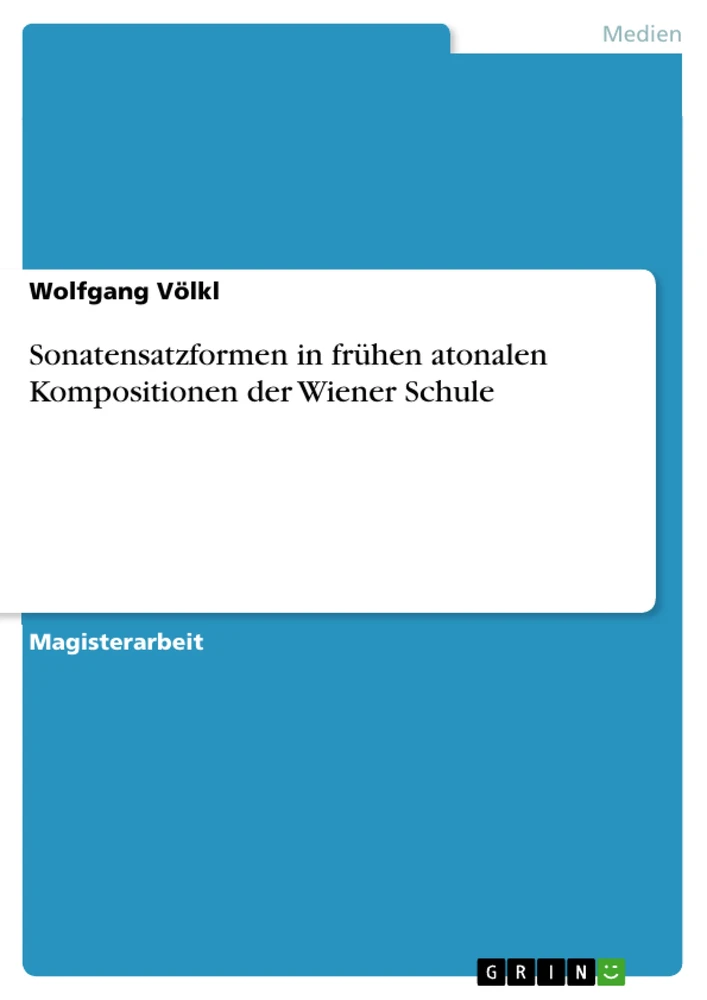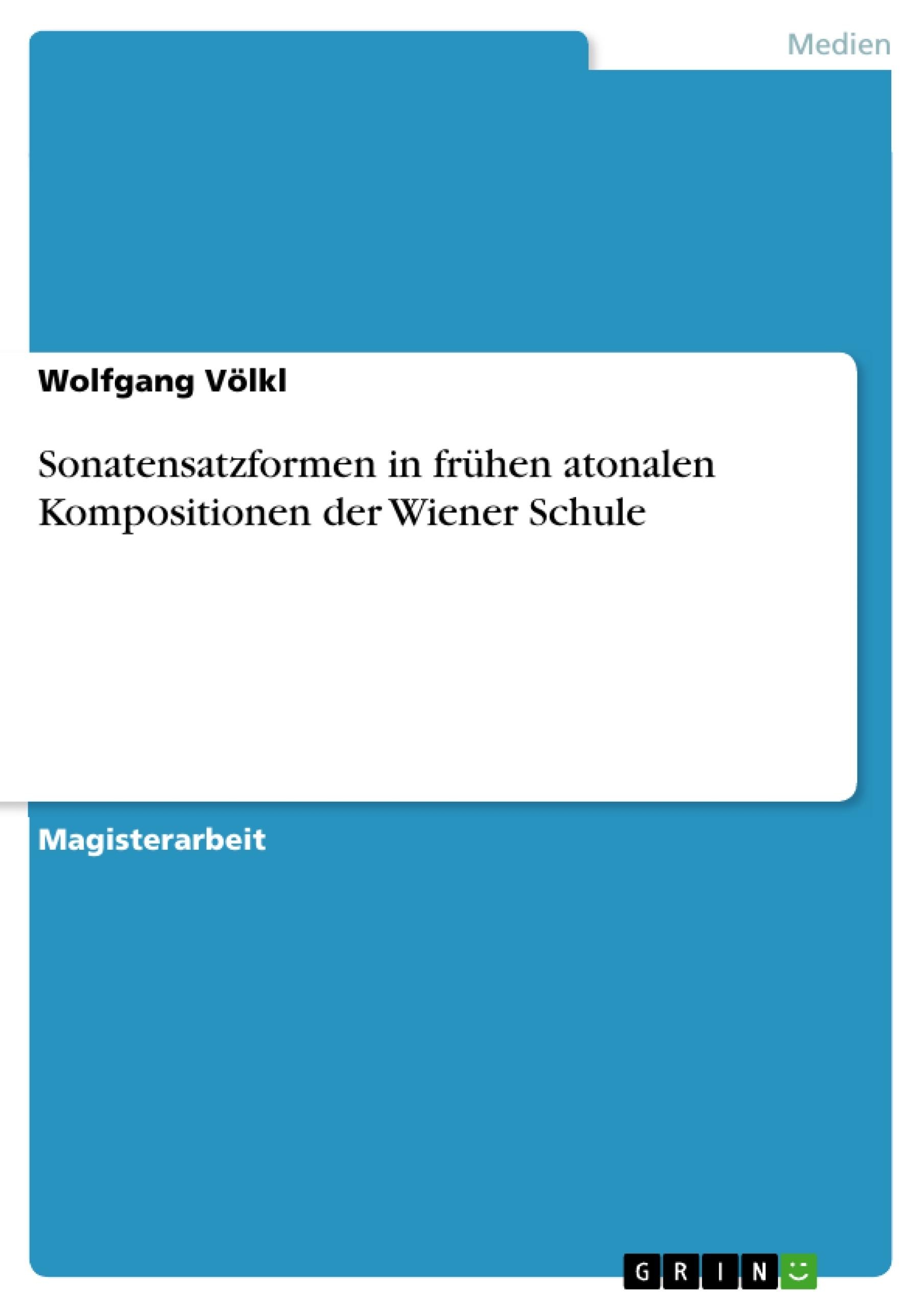An diversen Beispielen soll unter anderem untersucht werden, wie die Sonatensatzform unter den Vorzeichen atonalen Komponierens jeweils umgesetzt wird. Es soll dargestellt werden, wie mit den zuvor untersuchten Widersprüchen zwischen traditioneller Formgestaltung und atonaler Musik umgegange wird und unter welchen Voraussetzungen und Einschränkungen überhaupt von Sonatensatzformen im herkömmlichen Sinne im Kontext atonaler Kompositionen gesprochen werden kann.
Wie sind diese Formen innerhalb des von Markus Böggemann so benannten „Projekts Traditionsbruch“ und seiner Suche nach neuen kompositorischen Verfahren zu bewerten?
Das radikal neue Konzept atonalen Komponierens, wie es in den Werken der Wiener Schule ab etwa 1908 umgesetzt wurde, bedingte rasch ein Formproblem. In der späteren Darstellung durch Arnold Schönberg und seine Schüler wird dieses Formproblem beschrieben als eine Schwierigkeit, welche in erster Linie die Dimensionen der musikalischen Form betraf. Dem Konzept musikalischer Kürze steht also in den Jahren nach 1908 durchaus auch das Konzept musikalischer Länge gegenüber.
Es fällt auf, dass sich unter den frühen atonalen Kompositionen einige Stücke befinden, deren Form sich als Sonatensatzform beschreiben lässt. Das Vorkommen einer so traditionsgebundenen und mit zahlreichen Assoziationen aufgeladenen Form wie der Sonatensatzform muss zunächst irritieren. Anhand ausgewählter Beispiele werden in der vorliegenden Arbeit die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen freier Atonalität und Sonatensatzform näher beleuchtet.
Zunächst gilt es dabei zu verstehen, welcher Art die angenommenen Widersprüche zwischen der Verwendung von Sonatensatzformen und atonaler Musik genau sind, und wodurch sie entstehen. Zu diesem Zweck werden die wesentlichen Charakteristika des Begriffes Sonatensatzform herausgearbeitet, sowie die ästhetischen und kompositionstechnischen Hintergründe atonalen Komponierens untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Themenstellung
- 2. Sonatensatzform als dialektischer Prozess im Kontext atonaler Musik
- 2.1. Kurze Bestimmung einer möglichen Perspektive auf den Begriff der Sonatensatzform
- 2.2. Ästhetische Konventionen atonaler Musik und ihre Widersprüche zur Sonatensatzform
- 2.3. Traditionsbruch und traditionelle Formen
- 2.4. Atonalität und harmonisch konstruierte Form
- 2.5. Wiederholungsverbot und Reprisenform
- 2.6. Expressionistische Kürze und groß angelegte Form
- 3. Schönbergs II. Streichquartett op. 10, 4. Satz, „Entrückung“ (1907/1908)
- 3.1. Form-Analyse - Überblick
- 3.2. Atonale Sonatensatzform als Erzählung zweier Themen
- 3.3. Schönbergs Quartettsatz - Sonatensatzform ohne Reprise
- 4. Alban Bergs Streichquartett op. 3, 1. Satz (1910) - Form-Analyse
- 4.1. Überblick
- 4.2. Motivbausteine
- 4.3. Strukturprinzipien
- 4.4. Formbildung durch Kombination von Motivbausteinen und Strukturprinzipien
- 4.5. Sonstiges musikalisches Material in Bergs Streichquartett
- 4.6. Die tonale Disposition der Motivbausteine und Strukturprinzipien
- 4.7. Sonatensatzform ohne Reprise und Sonatensatzform ohne Durchführung - Unterschiedliche Verfahrensweisen bei Berg und Schönberg
- 4.8. Die Sonatensatzform in Bergs Streichquartett op. 3 vor dem Hintergrund der Durchdringung von Form und Inhalt in der Musik
- 5. Weitere Beispiele früher atonaler Sonatensatzformen
- 5.1. Anton Webern, op. 5 Nr. 1
- 5.2. Arnold Schönberg, op. 11 Nr. 1
- 5.3. Arnold Schönberg, op. 11 Nr. 3
- 6. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen der Verwendung von Sonatensatzformen und dem Prinzip der Atonalität in frühen Kompositionen der Wiener Schule. Ziel ist es, die Strategien der Komponisten im Umgang mit diesem Widerspruch zu beleuchten und die vielschichtigen Ausprägungen der Sonatensatzform in diesem Kontext zu analysieren.
- Der Widerspruch zwischen traditioneller Sonatensatzform und atonaler Musiksprache
- Kompositorische Strategien im Umgang mit diesem Widerspruch
- Vielfalt der Ausprägungen der Sonatensatzform in frühen atonalen Werken
- Analyse ausgewählter Kompositionen von Schönberg und Berg
- Einordnung der Sonatensatzform im Kontext des "Projekts Traditionsbruch"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Themenstellung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Auftreten von Sonatensatzformen in frühen atonalen Kompositionen der Wiener Schule. Sie verweist auf den vermeintlichen Widerspruch zwischen der traditionellen Form und dem Bruch mit traditionellen kompositorischen Verfahren, wie er von Schönberg und seinen Schülern beschrieben wurde. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse ausgewählter Beispiele, um die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen freier Atonalität und Sonatensatzform zu untersuchen. Es geht nicht um eine Rehabilitierung der Sonatensatzform, sondern um die Untersuchung ihrer konkreten Anwendung in einem neuen musikalischen Kontext.
2. Sonatensatzform als dialektischer Prozess im Kontext atonaler Musik: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen. Es untersucht den Begriff der Sonatensatzform und die ästhetischen und kompositionstechnischen Hintergründe atonaler Musik, um die vermeintlichen Widersprüche zu verstehen. Es analysiert die unterschiedlichen Aspekte der Sonatensatzform und die Herausforderungen ihrer Anwendung im Kontext atonalen Komponierens.
3. Schönbergs II. Streichquartett op. 10, 4. Satz, „Entrückung“ (1907/1908): Die Analyse des vierten Satzes von Schönbergs zweitem Streichquartett untersucht, wie Schönberg die Sonatensatzform in einem atonalen Kontext umsetzt. Es wird auf die Struktur des Satzes eingegangen, die Verwendung von Motiven, und den Umgang mit traditionellen Elementen der Sonatensatzform. Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation der formalen Gestaltung im Hinblick auf den atonalen Charakter des Werkes.
4. Alban Bergs Streichquartett op. 3, 1. Satz (1910) - Form-Analyse: Ähnlich dem vorherigen Kapitel wird hier der erste Satz von Bergs erstem Streichquartett analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Motivbausteine, Strukturprinzipien und deren Interaktion. Der Vergleich mit Schönbergs Ansatz im vorherigen Kapitel hilft, die individuellen Strategien der beiden Komponisten im Umgang mit der Sonatensatzform im Kontext der Atonalität hervorzuheben. Es werden die Unterschiede im Umgang mit der Durchführung und Reprise beleuchtet.
5. Weitere Beispiele früher atonaler Sonatensatzformen: Dieses Kapitel liefert eine kursorische Betrachtung weiterer Beispiele früher atonaler Kompositionen, die Sonatensatzformen verwenden. Diese dienen der Verallgemeinerung der in den vorherigen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse und illustrieren die Vielfalt der kompositorischen Ansätze im Umgang mit der Sonatensatzform unter den Vorzeichen der Atonalität.
Schlüsselwörter
Sonatensatzform, Atonalität, Wiener Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Traditionsbruch, Form-Analyse, musikalische Form, frühe Atonalität, kompositorische Strategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sonatensatzform in der frühen Atonalen Musik der Wiener Schule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen der Verwendung von Sonatensatzformen und dem Prinzip der Atonalität in frühen Kompositionen der Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern). Sie analysiert die Strategien der Komponisten im Umgang mit diesem Widerspruch und die vielschichtigen Ausprägungen der Sonatensatzform in diesem Kontext.
Welche Kompositionen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail den 4. Satz (Entrückung) aus Schönbergs II. Streichquartett op. 10 und den 1. Satz aus Bergs Streichquartett op. 3. Zusätzlich werden weitere Beispiele früher atonaler Kompositionen von Schönberg und Webern kurz betrachtet, um die Vielfalt der kompositorischen Ansätze zu illustrieren.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie gehen Komponisten der frühen Wiener Schule mit dem vermeintlichen Widerspruch zwischen traditioneller Sonatensatzform und atonaler Musiksprache um? Die Arbeit sucht nach den kompositorischen Strategien und den verschiedenen Ausprägungen der Sonatensatzform in diesem neuen musikalischen Kontext. Es geht nicht um eine Rehabilitierung der Sonatensatzform, sondern um die Untersuchung ihrer konkreten Anwendung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Themenstellung; 2. Sonatensatzform als dialektischer Prozess im Kontext atonaler Musik (theoretische Grundlagen); 3. Form-Analyse von Schönbergs II. Streichquartett op. 10, 4. Satz; 4. Form-Analyse von Bergs Streichquartett op. 3, 1. Satz; 5. Weitere Beispiele früher atonaler Sonatensatzformen; 6. Abschließende Betrachtung.
Wie wird die Sonatensatzform in den analysierten Werken umgesetzt?
Die Analyse zeigt, wie Schönberg und Berg die Sonatensatzform in einem atonalen Kontext adaptieren. Es wird untersucht, wie sie mit traditionellen Elementen der Sonatensatzform (z.B. Exposition, Durchführung, Reprise) umgehen und welche Strategien sie entwickeln, um die Form trotz der Atonalität zu gestalten. Die Arbeit hebt Unterschiede in den Herangehensweisen von Schönberg und Berg hervor, besonders im Umgang mit Durchführung und Reprise.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sonatensatzform, Atonalität, Wiener Schule, Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Traditionsbruch, Form-Analyse, musikalische Form, frühe Atonalität, kompositorische Strategien.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die kompositorischen Strategien der frühen Wiener Schule im Umgang mit der Sonatensatzform in der atonalen Musik zu beleuchten. Sie will die Vielfalt der Ausprägungen der Sonatensatzform in diesem Kontext analysieren und die Zusammenhänge und Widersprüche zwischen freier Atonalität und Sonatensatzform untersuchen.
Wie wird der vermeintliche Widerspruch zwischen Sonatensatzform und Atonalität behandelt?
Die Arbeit untersucht diesen Widerspruch, indem sie die theoretischen Grundlagen der Sonatensatzform und der atonalen Musik beleuchtet. Sie analysiert, wie die Komponisten mit den Herausforderungen der Anwendung der Sonatensatzform im Kontext atonalen Komponierens umgegangen sind, und zeigt die unterschiedlichen Strategien auf, die zur Gestaltung kohärenter musikalischer Formen führten.
- Quote paper
- Wolfgang Völkl (Author), 2012, Sonatensatzformen in frühen atonalen Kompositionen der Wiener Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202439