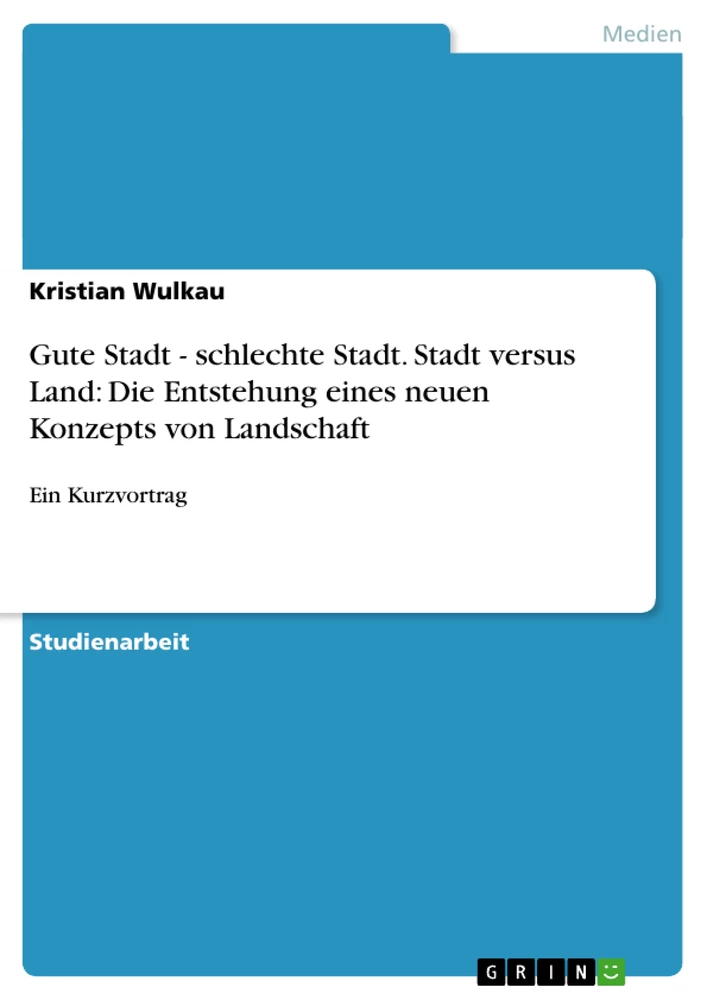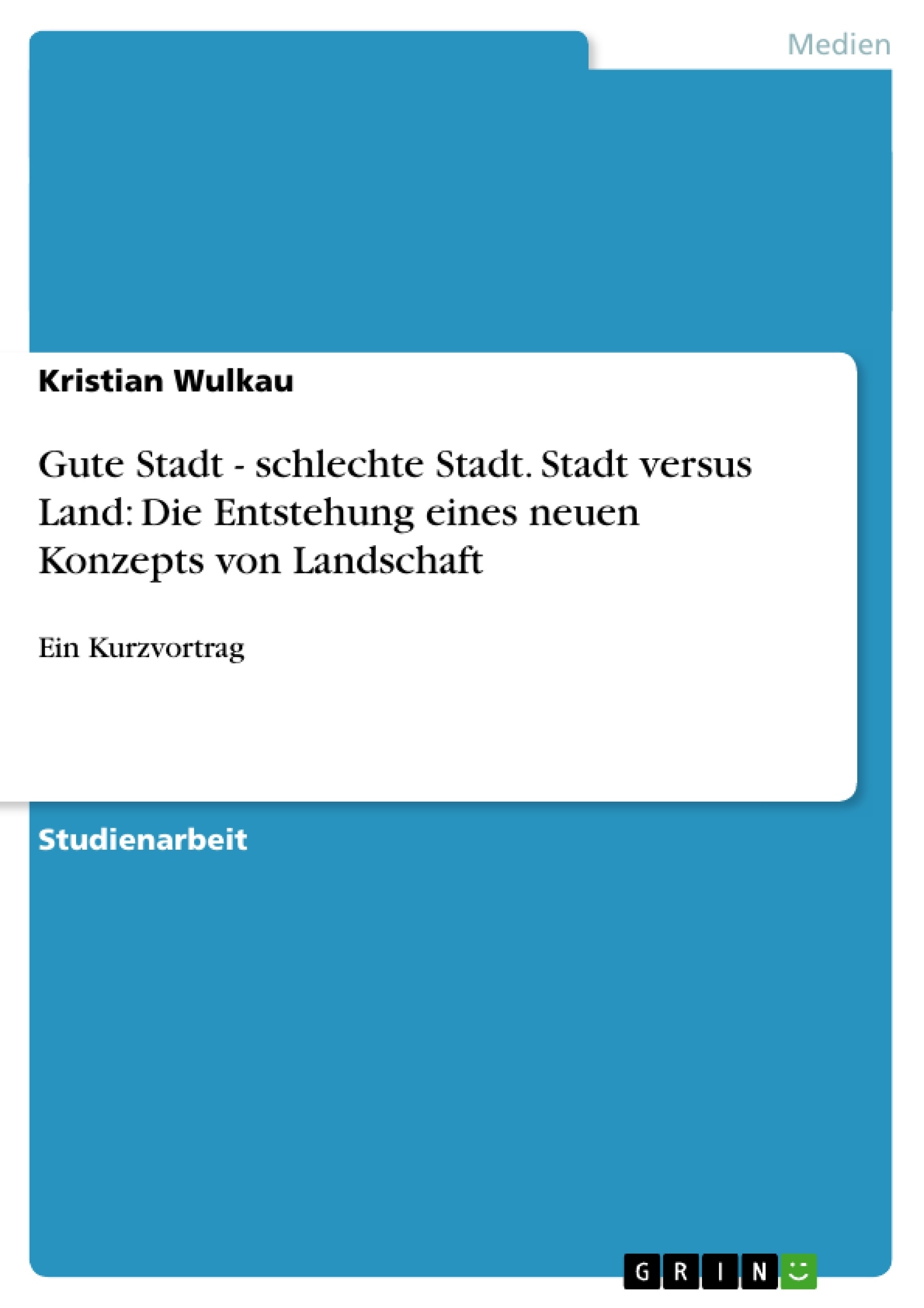Das Thema, mit dem ich mich im folgenden beschäftigen möchte, handelt von dem grundlegenden Wandel der Wahrnehmung von Landschaft und ihrer Definition als solchen, zu Beginn des 18Jhr. innerhalb Europas. Der Wandel vollzog sich von der Vorstellung das die Natur feindlich und zu bezwingen sei zu der Idealvorstellung von einer naturbelassener Landschaft, das sogar eine Einheit von Natur und Seele zu erreichen sei. Diesen Wandel zu verstehen wird dadurch erschwert, dass das Landschaftsbild der heutigen Zeit aus dieser Entwicklung hervor gegangen ist, und somit der nötige Abstand fehlt. Ein Vergleich unseres gängigen Landschaftskonzeptes mit denen vergangener Zeiten kann daher nur auf der Grundlage statt finden wie wir die Welt zum jetzigen Zeitpunkt wahrnehmen. Es stellt sich des weiteren die Frage inwieweit man die Wahrnehmung verschiedener Menschen zu verschiedenen Zeiten verallgemeinern kann.
Das Handeln der Menschen im Mittelalter und auch noch zu späteren Zeiten, war aufgrund religiöser Dogmen auf das "Jenseitige" ausgerichtet und es galt die irdischen Qualen(wie z.B. Hunger, Kälte und Krankheiten) zu überstehen. Das Weltbild dieser Menschen kennzeichnete sich durch die Vorstellung von der irdischen diesseitigen Natur, die nur als Übergangsstadium zu dem jenseitigen zu erreichenden Paradies diente. Dies änderte sich jedoch allmählich indem die "Seele" durch den "Verstand" als Ort der Erkenntnis ersetzt wurde. Antonia Dünnbier fasst das in dem Satz zusammen:
"So trat an die Stelle der weltabgewandten Seele als Organ und Ort, das Absolute zu erkennen, im Rationalismus des 17. Jahrhunderts der Verstand, der durch die Erfassung der objektiven Natur die Erkenntnis Gottes in seinem Werk ermöglichen sollte". (Dünnbier, S.199)
Vielleicht kann man auf die Benutzung der Begriffe von "Seele" und "Verstand" verzichten, indem man die empfundenen, also gefühlsmäßig abhängigen, Erfahrungen der "Außenwelt " und deren rationelle Verarbeitung bzw. Interpretation als eine in letzter Konsequenz unteilbare Einheit auffasst, da sich beides gegenseitig bedingt. Diese Einheit wird durch den Menschen als Ganzem dargestellt.
....
Inhaltsverzeichnis
- Die gefühlte Natur
- Entdeckung der Freilandschaft durch den Landschaftsgarten
- Das Landschaftsbild in der Literatur des 18Jhr. am Bsp. von Rousseaus „Julie ou la nouvelle Héloise“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Wandel der Wahrnehmung von Landschaft zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa. Er untersucht, wie die Vorstellung von der Natur als feindlich und zu bezwingend zu einer Idealvorstellung von naturbelassener Landschaft und einer Einheit von Natur und Seele entwickelte. Der Text beleuchtet auch, wie sich diese Entwicklung in der Landschaftsmalerei und der Entstehung der Landschaftsgärten widerspiegelte.
- Die Entwicklung des Landschaftsbegriffs im 18. Jahrhundert
- Die Rolle der empirischen Beobachtung und des Subjekts in der Landschaftswahrnehmung
- Die Bedeutung der Landschaftsmalerei und -gartenkunst
- Die Verbindung von Natur und Seele im Landschaftsbild
- Das Arkadienmotiv in der Landschaftsmalerei und -gartenkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die gefühlte Natur
Dieser Abschnitt beleuchtet die Veränderung der Naturwahrnehmung im 18. Jahrhundert. Er argumentiert, dass die Vorstellung von einer feindlichen Natur zu einer idealisierten, harmonischen Naturlandschaft umschwenkte, die als Einheit von Natur und Seele betrachtet wurde. Der Text diskutiert, wie die „Seele“ durch den „Verstand“ als Ort der Erkenntnis ersetzt wurde und wie diese Entwicklung zur empirischen Beobachtung der Natur führte. Der Autor betont, dass die „Landschaft“ nur sichtbar werden kann, wenn die objektive, empirische Natur und die subjektive Zuwendung zur Innerlichkeit des Subjekts zusammenkommen.
Entdeckung der Freilandschaft durch den Landschaftsgarten
Dieser Teil widmet sich der Entstehung und Bedeutung der Landschaftsgärten. Er erläutert, wie diese Gärten aus der Landschaftsmalerei entstanden sind und als eine Art „gebaute Natur“ verstanden werden können. Der Autor bezieht sich auf Christian Cay Lorenz Hirschfelds „Theorie der Gartenkunst“ und beleuchtet, wie die Landschaftsgärten nicht die natürliche Landschaft nachahmen, sondern die „schönen Natur“ hervorheben und konzentrieren. Die Komposition von Landschaftsgärten folgt laut Hirschfeld präzisen Vorgaben, die die „schönen Natur“ in ihrer Harmonie und Einheit zur Geltung bringen sollen.
Schlüsselwörter
Der Text dreht sich um die Schlüsselbegriffe Landschaft, Naturwahrnehmung, Empirismus, Subjektivität, Landschaftsgartenkunst, Landschaftsmalerei, Hirschfeld, Arkadien. Er behandelt die Entwicklung des Landschaftsbegriffs im 18. Jahrhundert und die ästhetischen und philosophischen Konzepte, die mit dieser Entwicklung verbunden sind.
- Quote paper
- Kristian Wulkau (Author), 2003, Gute Stadt - schlechte Stadt. Stadt versus Land: Die Entstehung eines neuen Konzepts von Landschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20219