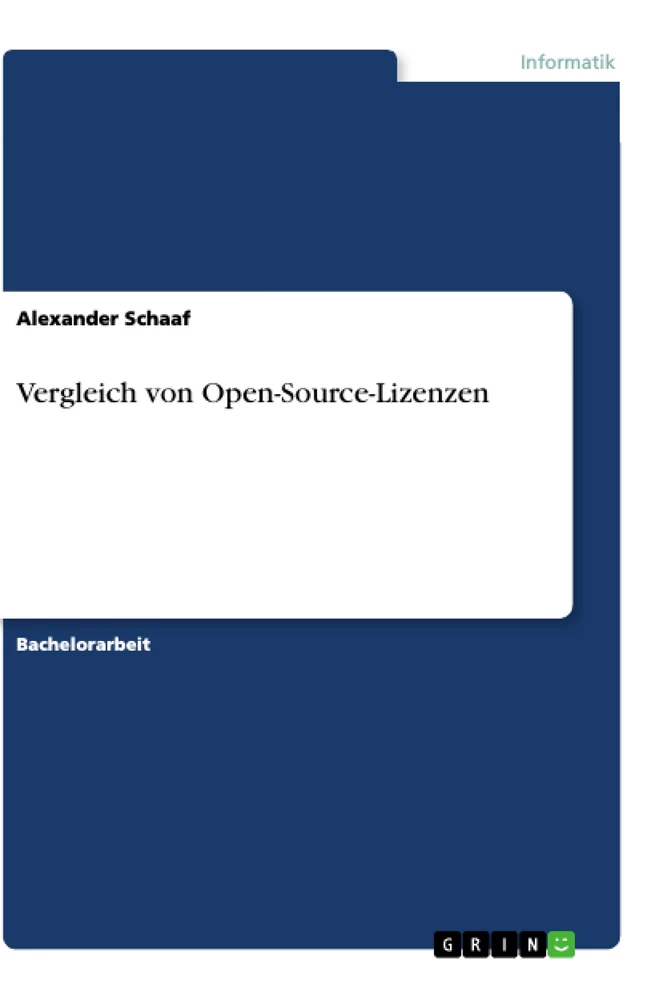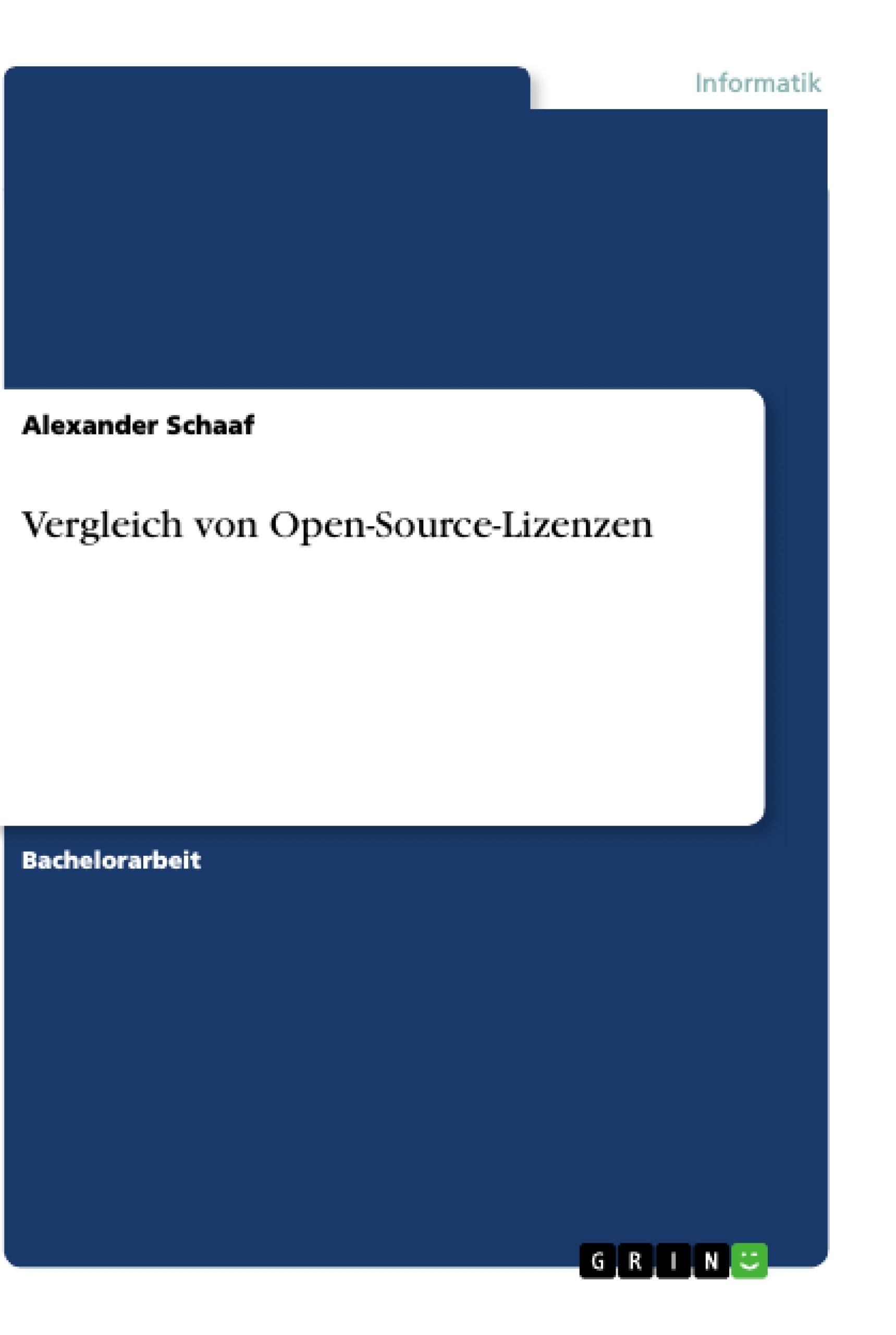In der Literatur gibt es keinen detaillierten Vergleich von Open-Source-Lizenzen. Es finden sich nur im Kontext zu anderen Themen einige kürzere Vergleiche von Lizenzen. Die Thesis soll einen Einstieg in diese Thematik ermöglichen und eine Entscheidungshilfe für Unternehmen sein, die mit Open Source in Berührung kommen.
Bei der Veröffentlichung einer Software als Open Source kann die richtige Wahl einer Open-Source-Lizenz ein Hindernis sein. Es existieren über 200 verschiedene Typen von Open-Source-Lizenzen. Schon die Recherche nach einer „optimalen“ Lizenz für die eigene Software kann erheblichen zeitlichen Aufwand und damit Kosten verursachen. Daher ist es vorstellbar, dass Unternehmen ihre Software nicht als Open Source veröffentlichen, da die anfallenden Kosten für die Recherche zu hoch und der positive Aspekt schwer abschätzbar sind.
Die Entscheidungshilfe ist zum einen für Unternehmen, die Software entwickeln und beabsichtigen, diese als Open Source zu veröffentlichen. Zum anderen für Unternehmen, die Open-Source-Software einsetzen oder in Zukunft einsetzen wollen. Hierzu werden die Open-Source-Lizenzen grob in vier Kategorien unterteilt. Exemplarisch wird für jede Kategorie eine verbreitete Lizenz näher betrachtet.
Der Aufbau der Thesis gliedert sich in 6 Kapitel. Nach der Einleitung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 einige relevante Begriffe definiert. Kapitel 3 legt die Grundlagen und bildet den Einstieg in die Thematik. In Kapitel 4 erfolgt der Vergleich anhand exemplarisch ausgewählter Open-Source-Lizenzen. Dabei werden erst die Gemeinsamkeiten dargestellt, bevor die Lizenzen anhand ihrer Rechte und Pflichten verglichen werden. Kapitel 4 schließt mit der Kompatibilität der Open-Source-Lizenzen untereinander ab. Anschließend folgt in Kapitel 5 ein Leitfaden, an dem sich Unternehmen einen kurzen Überblick zu Open-Source-Software und Open-Source-Lizenzen verschaffen können. Die Thesis schließt mit einem Resümee in Kapitel 6 ab.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Definitionen
2.1 Copyleft
2.2 Copyright
2.3 Lizenzmanagement
2.4 Nutzungsrecht
2.5 Software
2.5.1 Proprietäre Software
2.5.2 Kommerzielle Software
2.5.3 Shareware
2.5.4 Public Domain
2.5.5 Freeware
2.5.6 Free Software
2.5.7 Open Source
2.5.8 Weitere Formen von Software
3 Grundlagen
3.1 Grundidee von Lizenzierung
3.1.1 Lizenzvertrag
3.1.2 End User License Agreements
3.1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen
3.1.4 Duale Lizenzierung
3.1.5 Unterlizenzierung
3.2 Verbreitete Open-Source-Lizenzen
3.2.1 Open-Source-Lizenzen mit strengem Copyleft
3.2.2 Open-Source-Lizenzen mit beschränktem Copyleft
3.2.3 Open-Source-Lizenzen ohne Copyleft
3.2.4 Open-Source-Lizenzen mit Wahlrecht bei Copyleft
3.3 Kurze Historie
3.4 Rechtliche Aspekte
3.4.1 Gewährleistung
3.4.2 Haftung
3.4.3 Urheberrecht
3.4.4 Vertragspartner bei Open-Source-Lizenzen
3.4.5 Folgen beim Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen
3.4.6 Nationale Gültigkeit von Open-Source-Lizenzen
3.4.7 Internationale Gültigkeit von Open-Source-Lizenzen
4 Vergleich der Open-Source-Lizenzen
4.1 Gemeinsamkeiten der Open-Source-Lizenzen
4.2 Unterschiede der Open-Source-Lizenzen
4.2.1 Unterschiede bei den Rechten des Lizenznehmers
4.2.1.1 GPL
4.2.1.2 LGPL
4.2.1.3 BSD License
4.2.1.4 Artistic License
4.2.2 Unterschiede bei den Pflichten des Lizenznehmers
4.2.2.1 GPL
4.2.2.2 LGPL
4.2.2.3 BSD License
4.2.2.4 Artistic License
4.3 Kompatibilität der Open-Source-Lizenzen untereinander
5 Handlungsempfehlung für Unternehmen
5.1 Lizenzmanagement
5.2 Nähere Betrachtung von Open-Source-Software
5.2.1 Vorteile von Open-Source-Software
5.2.1.1 Anpassbarkeit
5.2.1.2 Kosten
5.2.1.3 Unabhängigkeit
5.2.1.4 Standardkonformität
5.2.1.5 Sicherheit
5.2.1.6 Qualität und Stabilität
5.2.1.7 Wiederverwendbarkeit und Wartungsfreundlichkeit
5.2.1.8 Support und Kommunikation
5.2.2 Nachteile von Open-Source-Software
5.2.2.1 Gewährleistungsrechte
5.2.2.2 Entwicklersupport
5.2.2.3 Entwicklerzentrierung
5.2.2.4 Schulungsaufwand
5.2.2.5 Weiterentwicklung
5.2.2.6 Anwendungssoftware
5.2.2.7 Interoperabilität mit kommerzieller Software
5.2.2.8 Rechtliche Risiken
5.3 Rechtliche Aspekte von Open-Source-Lizenzen
5.4 Vorhandene oder individuelle Open-Source-Lizenz
5.5 Auswahl einer Open-Source-Lizenz
6 Resümee
Anhang
Anhang A: Lizenztext Artistic License V1.0
Anhang B: Lizenztext Artistic License V2.0
Anhang C: Lizenztext BSD3 License
Anhang D: Lizenztext BSD4 License
Anhang E: Lizenztext GNU General Public License V2
Anhang F: Lizenztext GNU General Public License V3
Anhang G: Lizenztext GNU Lesser General Public License V2.1
Anhang H: Lizenztext GNU Lesser General Public License V3
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Übersicht über Nutzungsrechte
Abbildung 2: Verteilung von Open-Source-Lizenzen
Abbildung 3: Chronologische Entwicklung der Open-Source-Lizenzen
Abbildung 4: Chronologie von Gerichtsurteilen zu Open Source
Abbildung 5: Lizenzkompatibilität
Abbildung 6: Entscheidungsbaum zur Auswahl einer Open-Source-Lizenz
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht der Eigenschaften von Nutzungsrechten
Tabelle 2: Implementierung von Copyleft
Tabelle 3: Ziffernvergleich der LGPL
Tabelle 4: Lizenzkompatibilität der GPL und LGPL untereinander
Tabelle 5: Vor- und Nachteile von Open-Source-Software
1 Einleitung
„Am Anfang war alle Software frei“.[1] Dieser Satz von Georg Greve, Präsident der Free Software Foundation Europe, beschreibt wohl am besten, welcher Antrieb hinter Free Software und Open Source steht. Die beiden Begriffe gehören eng zusammen und haben doch eine unterschiedliche Bedeutung.
In der Literatur gibt es keinen detaillierten Vergleich von Open-Source-Lizenzen. Es finden sich nur im Kontext zu anderen Themen einige kürzere Vergleiche von Lizenzen. Die Thesis soll einen Einstieg in diese Thematik ermöglichen und eine Entscheidungshilfe für Unternehmen sein, die mit Open Source in Berührung kommen.
Bei der Veröffentlichung einer Software als Open Source kann die richtige Wahl einer Open-Source-Lizenz ein Hindernis sein. Es existieren über 200 verschiedene Typen von Open-Source-Lizenzen. Schon die Recherche nach einer „optimalen“ Lizenz für die eigene Software kann erheblichen zeitlichen Aufwand und damit Kosten verursachen. Daher ist es vorstellbar, dass Unternehmen ihre Software nicht als Open Source veröffentlichen, da die anfallenden Kosten für die Recherche zu hoch und der positive Aspekt schwer abschätzbar sind.[2]
Die Entscheidungshilfe ist zum einen für Unternehmen, die Software entwickeln und beabsichtigen, diese als Open Source zu veröffentlichen. Zum anderen für Unternehmen, die Open-Source-Software einsetzen oder in Zukunft einsetzen wollen. Hierzu werden die Open-Source-Lizenzen grob in vier Kategorien untereilt. Exemplarisch wird für jede Kategorie eine verbreitete Lizenz näher betrachtet.
Der Aufbau der Thesis gliedert sich in 6 Kapitel. Nach der Einleitung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 einige relevante Begriffe definiert. Kapitel 3 legt die Grundlagen und bildet den Einstieg in die Thematik. In Kapitel 4 erfolgt der Vergleich anhand exemplarisch ausgewählter Open-Source-Lizenzen. Dabei werden erst die Gemeinsamkeiten dargestellt, bevor die Lizenzen anhand ihrer Rechte und Pflichten verglichen werden. Kapitel 4 schließt mit der Kompatibilität der Open-Source-Lizenzen untereinander ab. Anschließend folgt in Kapitel 5 ein Leitfaden, an dem sich Unternehmen einen kurzen Überblick zu Open-Source-Software und Open-Source-Lizenzen verschaffen können. Der Einstieg erfolgt mit einer Empfehlung, wie im Lizenzmanagement eines Unternehmens Know-how über Software-Lizenzen geschaffen werden kann. Anschließend werden die Vor- und Nachteile von Open-Source-Software aufgezeigt. Im Anschluss wird eine Empfehlung gegeben, ob ein Unternehmen eine individuelle Open-Source-Lizenz entwickeln oder sich für eine schon existierende entscheiden sollte. Darauf folgt eine Hilfestellung für die Auswahl einer Open-Source-Lizenz. Dazu wurde ein Entscheidungsbaum entwickelt. An diesem können Unternehmen erkennen, zu welcher Kategorie eine Open-Source-Lizenz gehört. Die Thesis schließt mit einem Resümee in Kapitel 6 ab.
Der Vergleich der Open-Source-Lizenzen konzentriert sich auf die Rechte und Pflichten der Lizenznehmer. Eine genauere rechtliche Analyse von einzelnen Lizenzen ist nicht Teil dieser Thesis. Dazu finden sich im Literaturverzeichnis einige Werke, die diese Thematik behandeln. Allerdings werden einige rechtliche Details erwähnt, wenn diese in den Kontext passen.
Das Patentrecht wird nicht näher betrachtet. Hier existiert ein nicht einheitlicher Umgang mit der Patentierbarkeit von Software. Nach deutschem Patentrecht ist Software nicht patentierbar. Das Europäische Patentamt hingegen hat seit den 1990er Jahren die Patenterteilung nicht limitiert. In den USA hingegen ist Software patentierbar. Diese Diskrepanz besteht auch zwischen anderen europäischen Staaten und dem Europäischen Patentamt. Bis heute ist die Zukunft von Softwarepatenten in der Europäischen Union ungewiss.[3]
Die Thesis behandelt ebenfalls keine Analyse möglicher Lizenzkosten, da diese im Zusammenhang von Open-Source-Software nicht entstehen. Lizenzarten, wie Einzel- oder Mehrplatzlizenzen, sind nur bei kommerzieller Software relevant. Eine nähere Betrachtung anderer Lizenzmodelle als Free Software bzw. Open Source würde daher den Rahmen dieser Thesis übersteigen.
Die rechtliche Einteilung von Open-Source-Lizenzen in einen Vertragstyp nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch wird ebenfalls nicht behandelt. Die Literatur ist noch zu keiner endgültigen Festlegung gelangt, ob Open-Source-Lizenzen einen eigenen Vertragstypen bilden oder unter das Schenkungsrecht fallen.[4]
2 Definitionen
2.1 Copyleft
Copyleft ist eine Vertragsklausel in einer Lizenz. Diese stellt sicher, dass eine Software über den kompletten Lebenszyklus von jedem vervielfältigt, verändert, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Ebenso sichert Copyleft den Zugang zum Quelltext. Copyleft wird von Open-Source-Lizenzen unterschiedlich stark interpretiert.[5]
Bei Lizenzen mit streng ausgelegtem Copyleft besteht die Pflicht, dass eine modifizierte und weitergegebene Software unter der gleichen Lizenz, wie die ursprüngliche Software, veröffentlicht werden muss. Dadurch wird sichergestellt, dass der Quelltext von der abgeleiteten Software frei und unter der gleichen Lizenz zugänglich ist. Insbesondere wird damit eine Einbindung in eine proprietäre Software verhindert. Bei Derivaten einer Software ist damit eine Änderung der Lizenz ausgeschlossen.[6]
Einige Lizenzen legen Copyleft schwächer aus. Modifikationen an einer Software, die in einer eigenen Datei gespeichert werden, können unter einer anderen Lizenz stehen als die gesamte restliche Software. Dies gilt auch für selbst hinzugefügte Dateien. Teile eines Derivates einer Open-Source-Software können damit unter anderen Lizenzbedingungen stehen. Lizenzen mit beschränkter Copyleft-Klausel erleichtern die Kombination von Software unter verschiedenen Lizenzen.[7]
Enthält eine Open-Source-Lizenz (OSL) keine Copyleft-Klausel, muss die modifizierte Software nicht unter die gleiche Lizenz gestellt werden wie die ursprüngliche Software. Die OSL lässt dem Lizenznehmer alle Freiheiten in seinen Nutzungsrechten. Sie enthalten keine Bedingungen betreffend des Lizenztyps bei der Weitergabe. Es ist daher möglich, bei der Weitergabe der Software die Open-Source-Lizenz zu nutzen oder auf eine proprietäre Lizenz zu wechseln. Das Derivat einer Ursprungssoftware kann damit bei der Weitergabe unfrei werden.[8]
2.2 Copyright
Das Copyright bildet das amerikanische Gegenstück zum deutschen bzw. kontinentaleuropäischen Urheberrecht. Sie unterscheiden sich in einigen Punkten. Ein Autor musste früher in den USA sein Werk erst registrieren lassen, damit ihm die entsprechenden Schutzrechte zustanden. Dies ist heutzutage nicht mehr notwendig. Nach deutschem Verständnis muss das Urheberrecht nicht explizit beantragt werden, es entsteht automatisch ohne Formalität bei der Schöpfung eines Werkes. Das Urheberrecht endet derzeit 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Danach werden seine Werke Gemeingut der Öffentlichkeit. Festgelegt und geregelt wird das Urheberrecht im Urheberrechtsgesetz (UrhG). Nach US-amerikanischem Verständnis kann ein Autor seine geistigen Eigentumsrechte pauschal abtreten. Natürliche oder juristische Personen können somit als Urheber auftreten, obwohl sie ein Werk nicht selbst entwickelt haben. Nach deutschem Verständnis kann das Urheberrecht nach § 29 UrhG an sich vom Autor nicht selbst abgetreten werden. Als Urheber können somit nur natürliche Personen auftreten. Dessen ungeachtet sind jedoch die Nutzungsrechte nach § 31 UrhG übertragbar. Bei der Verwertung der Nutzungsrechte bilden Lizenzen die zentrale Rolle.[9]
Das Urheberrecht schützt eine individuelle geistige Schöpfung. Darunter fällt neben Musik und Literatur auch Software. Es wird nur die Ausdrucksform, zum Beispiel der Quelltext, der geistigen Schöpfung geschützt und nicht die Funktionalität, das Konzept oder die Idee. Dadurch ist es jedem erlaubt, eine Software zu schreiben, die eine eigene Ausdrucksform aber die gleichen Funktionalitäten hat. Bei Open-Source-Software (OSS) ist durch die teilweise große Anzahl an Entwicklern schwer festzustellen, wer die Urheber sind. Sind einzelne Teile der Software unabhängig voneinander geschrieben, können sie im Rahmen des Urheberrechts getrennt voneinander verwertet werden, da jeder Entwickler Urheber seines entwickelten Teiles der Software ist. Bei Open Source tritt vielmehr das Entwicklungsmodell auf, bei dem mehrere Entwickler die Software gemeinsam schreiben. Alle Entwickler gelten als Miturheber einer Gesamtgemeinschaft. Sie können nur zusammen über die Verwertung der Software entscheiden.[10]
2.3 Lizenzmanagement
Lizenzmanagement ist das Verwalten von Lizenzen. Es ist mehr im kaufmännischen als im technischen Bereich zu sehen, da es Prozesse für den Umgang mit Software und den dazugehörigen Lizenzbestimmungen beschreibt. Ziel ist eine effektive Organisationsstruktur und die Verwaltung der Softwarelandschaft. Dazu ist Spezialwissen über die Softwarelieferanten und deren Lizenzmodelle erforderlich. Das schafft die Grundlage zur Definition von Rollen und Zuständigkeiten, um die damit verbundenen Prozesse in einem Unternehmen abteilungsübergreifend zu determinieren.[11]
Lizenzmanagement hat bei genauerer Betrachtung vier Ziele. Die Schaffung von Transparenz soll sicherstellen, dass ein Unternehmen weiß, welche Software eingesetzt wird. Die notwendigen Wartungsverträge und eventuelle Folgekosten sind ebenfalls zu beachten. Durch genaue Identifizierung möglicher Kosten können diese in der Regel erheblich reduziert werden. Die Dokumentation der vorhandenen Software im Unternehmen sowie die Analyse und Bewertung der entsprechenden Lizenzen ist ebenfalls ein Ziel. Dazu gehört ebenfalls die Rechtmäßigkeit. Dabei geht es um den Nachweis gegenüber dem Software-hersteller, dass die Nutzungsbedingungen, die im Lizenzvertrag stehen, eingehalten werden.[12]
2.4 Nutzungsrecht
An einer geistigen Schöpfung kann ein Nutzungsrecht eingeräumt werden. Im deutschen Urheberrechtsgesetz wird nicht der Begriff Lizenz, sondern der Begriff Nutzungsrecht verwendet. In der Praxis wird im Zusammenhang mit Software aber fast ausschließlich der Begriff Lizenz benutzt. Durch Lizenzen werden gewisse Rechte von Urhebern geschützt. Welche Nutzungsrechte ein Urheber dem Nutzer einer Software gewährt, legt er bei der Lizenzierung fest. Die Bedingungen sind im Lizenzvertrag der jeweiligen Software dokumentiert. Dort stehen die Gegen-leistungen, zu welchen sich der Lizenznehmer verpflichtet und eventuelle Vertragsstrafen, die bei Nichteinhaltung der Bedingungen wirksam werden können. Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen beide Vertragsparteien die Bedingungen akzeptieren. Der Nutzer bestätigt dies in der Regel bei der Installation der Software. Dort wird er am Anfang aufgefordert, den Lizenzvertrag zu akzeptieren.[13]
Beim Einräumen von Nutzungsrechten wird zwischen einfachem und ausschließlichem Nutzungsrecht unterschieden. Das einfache Nutzungsrecht erlaubt es, die Software so zu nutzen, dass dabei eine Nutzung durch andere nicht ausgeschlossen ist. Beim ausschließlichen Nutzungsrecht an einer Software kann die Software unter Ausschluss aller anderen Personen, inklusive des Urhebers, genutzt werden. Der Umfang und die Art der Nutzung einer Software leiten sich aus den gewährten Nutzungsrechten ab. Der Inhaber kann Dritten die Benutzung der Software unter-sagen oder Nutzungsrechte einräumen.[14]
Es gibt immer wieder Missverständnisse in Bezug auf das Urheberrecht. Der Lizenznehmer einer Software erlangt niemals das Eigentum an diesem Urheber-recht. Das deutsche Recht erlaubt nur das Abtreten von Lizenzrechten und nicht das Abtreten von Urheberrechten. Es wird lediglich das Recht erworben, die Software im Rahmen des Lizenzvertrages zu nutzen. Eine Ausnahme ist denkbar, wenn eine Software im Kundenauftrag speziell entwickelt wird.[15]
2.5 Software
Software ist ein immaterielles Produkt, welches durch kreatives Arbeiten entsteht. Sie ist deshalb durch das Urheberrecht geschützt. Software wird von einem oder mehreren Programmierern geschrieben. Der entstehende Text wird als Quelltext oder Quellcode bezeichnet. Mittels Kompilierung wird daraus ein Programm, das ein Computer ausführen kann. Die Software liegt dann im Binärcode vor. Software wird in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, wobei manche Software die Bedingungen in mehreren Kategorien erfüllt und sich damit nicht eindeutig zuordnen lässt. Der Vertrieb von Software kann kreative Ausmaße annehmen, wie einige Beispiele im Kapitel 2.5.8 zeigen. Die Aufzählung der hier erwähnten Kategorien erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.[16]
2.5.1 Proprietäre Software
Der Begriff proprietäre Software wird in der Praxis als Bezeichnung für Software verwendet, um auf die gewährten Ausschließlichkeitsrechte des geistigen Eigentums hinzuweisen. Danach liegt die Entscheidung alleine beim Urheber, ob und auf welche Weise er sein Werk verwertet und wen oder was er bei der Verwertung ausschließen will. Dabei ist diese Bezeichnung nicht präzise genug, da auch Free Software und Open-Source-Software geistiges Eigentum sind. Bei proprietärer Software ist der Quelltext nicht frei und auch nicht in Teilen frei erhältlich. Die Weiterverbreitung oder Veränderung sind verboten oder benötigen eine Erlaubnis des Rechteinhabers, da für ihn der Quelltext ein schützenswertes Gut ist. Der Nutzer soll deswegen keine umfassenden Nutzungsrechte erhalten. Dies dient der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, die diese Software beinhaltet, wie zum Beispiel Implementierungen von Schnittstellen oder Algorithmen. Der Rechteinhaber ist in der Regel auch der Hersteller der Software. Der Benutzer der Software erwirbt typischerweise ein Nutzungsrecht vom Rechteinhaber und wird nicht Eigentümer der Software. Die Auslieferung der Software erfolgt daher als kompiliertes Programmpaket, welches direkt ausgeführt oder installiert werden kann. Proprietäre Software kann sowohl kommerziell als auch kostenlos vertrieben werden.[17]
2.5.2 Kommerzielle Software
Kommerzielle Software wird von einer Firma entwickelt, die damit das Ziel verfolgt, durch den Verkauf dieser Software Profit zu erwirtschaften. In der Regel wird der Quelltext der Software geheim gehalten, da dieser das Kapital der Firma darstellt. Den Nutzern wird ein beschränktes Nutzungsrecht erteilt. Dieses wird durch die veröffentlichten Lizenzbestimmungen, oft als End User License Agreements (EULA) bezeichnet, bestimmt. Weitergehende Rechte, wie eine Weiterverbreitung oder Veränderung der Software, hat der Anwender nicht. Kommerzielle Software ist nicht gleich proprietärer Software. Zwar ist der überwiegende Teil kommerzieller Software proprietär, aber es gibt auch kommerzielle Software deren Quelltext frei verfügbar ist.[18]
2.5.3 Shareware
Shareware ist keine Softwareart, sondern ein besonderes Vermarktungsmodell für kommerzielle Software. Die Software darf frei kopiert und verbreitet werden. Meist unterliegt die Software einer gewissen Beschränkung und der volle Funktions-umfang ist nur für eine begrenzte Zeit nutzbar. Soll die Software darüber hinaus verwendet werden, sind Lizenzgebühren an den Rechteinhaber zu entrichten. Die restlichen Lizenzbedingungen sind größtenteils identisch mit denen von proprietärer Software. Auch hier dient oft die EULA als Lizenzvertrag. Verwendung findet diese Lizenzform häufig bei Unternehmen oder Privatpersonen, die auf ihre Software aufmerksam machen wollen. Der Anwender kann vor dem Entrichten der Lizenzgebühr die Software ausgiebig testen. In der Praxis ist dieses Vertriebs-modell allerdings weitgehend gescheitert, da Anwender im Nachhinein oft nicht bereit sind, Lizenzgebühren zu zahlen.[19]
2.5.4 Public Domain
Software unter Public Domain besitzt keinen oder teilweise keinen Urheberrechtsschutz, da der Autor auf sein Urheberrecht ganz oder teilweise verzichtet hat. Nach europäischem bzw. deutschem Recht ist „das Urheberrecht .. nicht übertragbar“[20] und ein vollständiger Verzicht des Autors nicht möglich. Eine Lizenz für eine Public-Domain-Software ist als einfaches Nutzungsrecht ausgelegt. Dem Nutzer wird erlaubt, die Software uneingeschränkt und vorbehaltlos zu verwenden und zu kopieren. Bei Public-Domain-Software muss der Quelltext nicht öffentlich sein. Somit ist Public-Domain-Software nicht gleich Free Software oder Open Source. Ebenfalls kann Free Software oder Open-Source-Software nicht unter Public Domain stehen, da dem Lizenznehmer Veränderungs- und Verwertungsrechte ein-geräumt werden. Dadurch wird Gebrauch vom Urheberrecht gemacht, auf welches Public Domain verzichtet.[21]
2.5.5 Freeware
Der Begriff Freeware ist nicht eindeutig definiert. Freeware wird gemeinhin für proprietäre Software benutzt, die kostenlos weiterverbreitet und kopiert werden darf, aber keine Veränderungen erlaubt. Darüber hinaus ist der Quelltext nicht einsehbar. Der Inhalt des Lizenzvertrags wird vom Rechteinhaber festgelegt und in der Regel als EULA beschrieben. Der Nutzer erhält ein einfaches Nutzungsrecht, aber keine weitergehenden Rechte. Freeware wird von Softwareherstellern zur Verbreitung gewählt, wenn sie sich davon einen Marktvorteil versprechen. Oft ist die Nutzung von Freeware im privaten Gebrauch kostenlos zulässig, im kommerziellen Gebrauch aber nicht. Hier fallen folglich Lizenzgebühren für Unternehmen an.[22]
2.5.6 Free Software
Bei Free Software (FS) ist der Quelltext frei zugänglich und darf verbreitet und modifiziert werden. Die gemeinnützige Organisation Free Software Foundation (FSF) legt die Definition von FS fest. Bei FS besteht die Möglichkeit diese, im Gegensatz zu proprietärer Software, für einen beliebigen Zweck auszuführen, sie an eigene Anforderungen anzupassen oder zu verbessern. Beim entstandenen Derivat gelten die gleichen Nutzungsrechte wie bei der originalen Software. Modifikationen müssen bei der Weitergabe den gleichen Lizenzbedingungen unterliegen wie die originale Software.[23]
Die Begriffe Open Source und Free Software werden oft synonym verwendet, obwohl dies nicht ganz richtig ist. FS ist eine Ideologie, die gesellschaftliche Ziele verfolgt. Im Fokus steht die Informationsfreiheit. Dem Nutzer soll möglichst viel Freiheit im Umgang mit Software gewährt werden. In diesem Zusammenhang soll die Abhängigkeit von Softwareherstellern verringert werden. FS stellt vier Elemente der Freiheit in den Mittelpunkt, welche der Nutzer beim Verwenden haben soll:[24]
1. Eine Software sollte für jeden Zweck verwendet werden können.
2. Die Arbeitsweise einer Software sollte analysiert wund an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können.
3. Eine Software darf kopiert und weiterverteilt werden.
4. Die Software sollte verbessert und diese Veränderungen sollten auch publiziert werden dürfen.
Die Begriffe Free Software und Freeware sind nicht synonym und dürfen nicht verwechselt werden, da sie unterschiedliche Bedeutungen haben. Auch wenn Freeware kostenlos erhältlich sowie das Kopieren und Verteilen erlaubt ist, darf die Software nicht verändert oder für andere Zwecke angepasst werden. Dies ist in der Regel nicht ohne weiteres möglich, da der Quelltext nicht frei erhältlich ist. Abbildung 1 zeigt grafisch die Einteilung der Software in die genannten Kategorien.[25]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Bundesverwaltungsamt (2011a), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 7.
Abbildung 1: Übersicht über Nutzungsrechte
In Abbildung 1 werden zwei Unterteilungen nochmals sichtbar. Zum einen zeigt die Abbildung, dass Free Software eine kleine Teilmenge von Open Source ist. Zum anderen wird deutlich, dass proprietäre Software nicht zwangsweise kommerzielle Software ist. Ebenso sind Shareware und Freeware proprietär, obwohl sie kostenlos verbreitet werden dürfen.
2.5.7 Open Source
Open Source (OS) ist ein Modell, welches die kommerzielle Nutzung von quelloffener Software erleichtern soll. Der Grundgedanke von OS entspricht dem von FS. Quelltexte sollen frei zugänglich gemacht, modifiziert und kostenlos verbreitet werden können. Damit werden dem Lizenznehmer umfassende Nutzungsrechte an der Software gewährt. Synonyme für OS sind „offene Software“ oder „quelloffene Software“. Allerdings besteht eine Abgrenzung zur freien Software. OS ist mehr ein Entwicklungsmodell als ein ideologisches Modell. Im Fokus steht die Entwicklung von technisch guter Software. Dazu muss der Quelltext frei verfügbar sein. Allgemein ist Free Software auch immer Open Source bzw. Open-Source-Software. Allerdings muss OS nicht unbedingt FS sein. Sie ist somit eine kleinere Teilmenge von Open Source.[26]
Wann eine Lizenz als Open-Source-Lizenz (OSL) eingestuft wird, legt die Open Source Initiative (OSI) fest. Die OSI ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss verschiedener Firmen und Organisationen. Ihr Ziel ist eine einheitliche, neutrale und nicht ideologische Definition von Open Source. Darüber hinaus betreibt sie Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein für OS zu stärken. Die Definition stellt keine eigene OSL dar, sondern nur eine Liste mit Kriterien, die weit über die reine Verfügbarkeit des Quelltextes hinausgeht. Während der Entstehung dieser Thesis war Version (V) 1.9 der Open-Source-Definition (OSD) der OSI aktuell. Damit eine Lizenz als OSL gilt, muss sie alle zehn Forderungen der OSD erfüllen:[27]
1. Freie Weiterverbreitung
Die Lizenz darf niemanden an der Weitergabe hindern und in seinen Rechten einschränken. Es dürfen keine Lizenzgebühren erhoben werden.
2. Quelltext
Der Quelltext einer Software muss in einer verständlichen Programmiersprache vorliegen. Eine absichtlich unverständliche Form ist nicht zulässig. Der Quelltext sollte immer zusammen mit der Software weitergegeben werden. Wenn dies nicht zutrifft, muss es eine allgemein bekannte Möglichkeit geben, an den Quelltext zu kommen.
3. Abgeleitete Versionen
Eine Lizenz muss Derivate zulassen und deren Weitergabe unter denselben Lizenzbedingungen erlauben, unter der die originale Software steht.
4. Unversehrtheit des Originals
Bei der Verbreitung von verändertem Quelltext muss genau gekennzeichnet werden, welche Teile des Codes aus dem Original stammen und welche neu sind. Diese Änderungen müssen in einem externen Dokument festgehalten und zusammen mit der Software zur Verfügung gestellt werden.
5. Keine Diskriminierung von Personen oder Gruppen
Es darf keine Einschränkung bei der Anzahl der Benutzer, dem Einsatzbereich oder den Installationen geben. Zudem dürfen keine Personen oder Gruppen vom Gebrauch der Software ausgeschlossen werden.
6. Keine Einschränkungen der Anwendungsbereiche
Die Lizenz darf kein bestimmtes Einsatzgebiet ein- oder ausschränken.
7. Verbreitung der Lizenz
Einer OSL dürfen keine weiteren Klauseln hinzugefügt werden. Ebenso gehen alle Rechte an einer Software auf alle Personen über, die diese Software verwenden, ohne dass dafür eine zusätzliche Lizenz erworben werden muss.
8. Die Lizenz darf nicht für ein bestimmtes Produkt gelten
Wenn in Softwarepaketen enthaltene Programme einzeln weiterverbreitet werden, gilt dieselbe Lizenz für das dann separat stehende Programm wie für das komplette Ausgangspaket.
9. Keine Beeinträchtigung anderer Software durch die Lizenz
Die Lizenz einer Software darf keine andere Software, die beispielsweise in demselben Softwarepaket enthalten ist, einschränken.
10. Die Lizenz muss technikneutral sein
Eine Lizenz darf nicht nur für eine bestimmte Technologie oder Schnittstelle gelten oder diese ausschließen.
Nicht jede Lizenz wird von den Institutionen OSI und FSF anerkannt. Beide haben ihre eigenen erwähnten Forderungen, welche Bedingungen die Lizenzen erfüllen müssen, um von den Institutionen zertifiziert zu werden. Da aber trotz aller Unter-schiede beide Begriffe die gleichen Softwareentwicklungs- und Vertriebsmodelle beschreiben, wird in dieser Arbeit der Begriff Open Source verwendet.
2.5.8 Weitere Formen von Software
Tabelle 1 stellt die einzeln erwähnten Nutzungsrechte kurz zusammengefasst dar. Es gibt noch viele weitere Formen des Nutzungsrechts. Die Grenzen sind teilweise fließend. Einige außergewöhnliche werden im Folgenden erwähnt und kurz erläutert:[28]
-Cardware: Als Cardware wird Software bezeichnet, bei welcher der Urheber den Benutzer um die Zusendung einer Postkarte bittet.
-Donationware: Der Nutzer kann bei Donationware selbstständig entscheiden, ob er dem Urheber eine Lizenzgebühr entrichten möchte oder nicht.
-Mindware: Auch bei Mindware entscheidet der Benutzer selbstständig über die Zahlung einer Lizenzgebühr. Im Gegensatz zu Donationware wird die Höhe der Gebühr allerdings nicht vom Urheber festgelegt, sondern vom Nutzer selbst bestimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Groll, T. (2012), S. 24; Saleck, T. (2005), S. 10.
Tabelle 1: Übersicht der Eigenschaften von Nutzungsrechten
3 Grundlagen
3.1 Grundidee von Lizenzierung
Lizenzierung soll einerseits flexible Vermarktungsmodelle sicherstellen, andererseits ist es ein Sammelbegriff für Maßnahmen, die Software gegen illegale Nutzung schützen soll. Dabei ist Lizenzierung nicht gleichbedeutend mit Kopierschutz. Jedoch beinhalten die Lizenzierungsmaßnahmen für kommerzielle Software oft einen Kopierschutz. Die Bedingungen der Lizenzierung werden im Lizenzvertrag festgehalten.[29]
3.1.1 Lizenzvertrag
Ein Lizenzvertrag beschreibt das Nutzungsrecht, welches der Nutzer bzw. Lizenznehmer vom Rechteinhaber der Software, dem Lizenzgeber, eingeräumt bekommt. Den rechtlichen und vertraglichen Rahmen des Vertrages gibt der Rechteinhaber vor. Inhaltlich steht im Lizenzvertrag, welche Rechte dem Lizenznehmer eingeräumt werden und zu welchen Gegenleistungen er sich verpflichtet. Eventuelle Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung des Vertrages sind ebenfalls Bestandteil des Lizenzvertrages. Dem Lizenzgeber steht es grundsätzlich frei, unter welchen Bedingungen er die Nutzungsrechte lizenziert. Mit unterschiedlichen Personen können jeweils unterschiedliche Verträge ausgehandelt werden. Ein Vertrag wird nach deutschem Recht erst dann wirksam, wenn zwei Willenserklärungen, Angebot und Annahme, übereinstimmen. Allein der Erwerb der Software reicht noch nicht zur Annahme des Lizenzvertrages. Das Angebot des Rechteinhabers liegt in der Regel in Form des Lizenztextes vor. Der Nutzer kann aber eine Software verwenden, ohne den Lizenzvertrag angenommen zu haben. Grundsätzlich gilt, dass eine Annahme erst erfolgen kann, wenn dem Nutzer der komplette Vertragstext bekannt ist.[30]
Open-Source-Lizenzen bilden eine Vertragsvorlage. Diese kann ein Urheberrechts-inhaber als Grundlage nehmen, um zukünftigen Anwendern ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu machen.[31]
3.1.2 End User License Agreements
Hersteller von proprietärer Software versuchen über eine EULA Bedingungen für die Nutzung ihrer Software mit dem Anwender zu vereinbaren. Sie regeln meist, was dieser bei der Benutzung der Software beachten muss und was verboten ist. Nach dem Willen der Hersteller soll der Anwender nicht nur einen Vertrag mit seinem Händler abschließen, von dem er die Software bezogen hat, sondern auch einen weiteren Vertrag mit dem Hersteller. Die Zustimmung zu diesem Vertrag soll er durch das Öffnen der Softwareverpackung bzw. mit einem Mausklick beim ersten Start der Software geben. Akzeptiert der Nutzer die EULA am Anfang der Installation nicht, bricht die Installation ab. Für den Anwender besteht somit nicht die Möglichkeit, ohne die Zustimmung zur EULA die Software überhaupt zu nutzen. Im § 69 d) Abs. 1 UrhG ist dem Endanwender die „bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms“[32] ohne Vertrag mit dem Hersteller gestattet. Unter Juristen ist es umstritten, ob solche Verträge wie die EULA überhaupt eine rechtliche Bedeutung haben.[33]
Eine EULA ist bei OSS nicht vorhanden, da sie hier nicht wirksam wäre. Die Bedingungen einer OSL greifen in der Regel erst, wenn der Lizenznehmer die Software über die reine bestimmungsgemäße Benutzung hinaus verwenden möchte. Dies gilt insbesondere beim Verbreiten und Vertreiben der Software.[34]
3.1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Im deutschen Zivilrecht gilt Vertragsfreiheit. Jeder kann einen Vertrag abschließen, über dessen Inhalt sich beide Vertragspartner einig sind. Zu beachten ist, dass nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder Verbote sowie gegen die guten Sitten verstoßen wird. Eingeschränkt wird die Vertragsfreiheit durch Ausnahmen, wie etwa dem Kündigungsschutz im Arbeitsrecht. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind dabei vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei einem Vertragsabschluss stellt. Durch die AGB wird der Vertragsabschluss beschleunigt, standardisiert und vereinfacht. Dabei ist es nicht relevant, ob die AGB in der Vertragsurkunde stehen oder in einer gesonderten Anlage. Umfang, Schriftart und Form spielen keine Rolle für die Gültigkeit. Die AGB werden aber nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn auf sie deutlich hingewiesen wird und sie keine eklatanten Abweichungen von den zu erwartenden Vertragsinhalten haben. Dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) unbekannte Vertragstypen, wie zum Beispiel Softwareverträge, können mit den AGB geregelt werden.[35]
3.1.4 Duale Lizenzierung
Wird Software unter zwei unterschiedlichen Lizenzen vertrieben, wird dies als duale Lizenzierung bezeichnet. Dabei kann ein und dieselbe Software unter einer proprietären Lizenz und einer OSL vertrieben werden. Ebenfalls ist der Vertrieb unter zwei oder mehr OSL möglich. Auf diese Weise kann ein Unternehmen mehreren Kunden die Möglichkeit anbieten, Software, die unter einer strengen Copyleft-Klausel steht, alternativ mit einer proprietären Lizenz zu erwerben. Der Lizenznehmer muss dann bei Weiterentwicklungen die erstellten Derivate nicht unter der Ursprungslizenz veröffentlichen. Duale Lizenzierung ist nicht möglich, wenn eine fremde OSS weiterentwickelt wird und diese unter einer Lizenz mit strengem Copyleft steht. Die Überführung von Teilen des Quelltextes, die von Dritten geändert wurden, in den proprietären Vertrieb ist nicht möglich, da das Derivat unter der Lizenz mit Copyleft-Effekt veröffentlicht werden muss. Bei OSL ohne Copyleft ist die duale Lizenzierung immer möglich, unabhängig davon ob die Software selbst entwickelt wurde oder nicht. Der Lizenznehmer erwirbt bei solchen OSL alle Freiheiten, so dass er die Programme unter abweichenden Bedingungen weiterverbreiten kann.[36]
Ein wirtschaftlich erfolgreiches Beispiel ist die Datenbank MySQL. Sie wird zum einen unter der General Public License (GPL) V2 und gleichzeitig unter einer proprietären Lizenz vertrieben. Beide Versionen sind identisch. Die Weiter-entwicklungen des Unternehmens kommen uneingeschränkt der Community zugute und die Firma kann Lizenzen des Produktes verkaufen. Für ihre Kunden hat die proprietäre Version den Vorteil des Supportes durch den Hersteller direkt sowie die Entbindung von der Pflicht zum Veröffentlichen von Änderungen.[37]
3.1.5 Unterlizenzierung
Der Begriff Unterlizenzierung wird sowohl im Zusammenhang mit Lizenz-management als auch im Zusammenhang mit Lizenzen verwendet. Er beschreibt im Lizenzmanagement ein Ergebnis des Compliance Reports. Dieser Report zeigt, wie gesetzliche Bestimmungen und unternehmensinterne Richtlinien eingehalten werden. Eine Unterlizenzierung liegt vor, wenn die Anzahl der Lizenzen für eine Software geringer ist als die Anzahl der Installationen. Dazu zählen alle Installationen, auch diese von nicht genutzten Computern. Im Kontext von Lizenzen beschreibt Unterlizenzierung den Vorgang, wenn bei einer Weitergabe von Software keine direkte Lizenzierung durch den Rechteinhaber erfolgt, sondern der Lizenznehmer selbst Lizenzen an Dritte vergibt. Damit ist er alleiniger Lizenzgeber gegenüber dem Dritten und muss für alle eingeräumten Rechte einstehen. Der Nachteil gegenüber einer direkten Lizenzierung beim Rechteinhaber ist, dass durch mehrere Unterlizenzierungen so genannte Rechteketten entstehen können. Ist nun eine Unterlizenzierung in dieser Kette unwirksam, zum Beispiel durch einen Vertragsmangel, sind alle folgenden Unterlizenzierungen ebenfalls unwirksam. Durch den vertraglichen Mangel existiert keine gültige Lizenzvereinbarung mehr. Damit fehlt die rechtliche Grundlage zur Unterlizenzierung. Bei der direkten Lizenzierung kann dies nicht passieren, da die Rechte immer vom Rechteinhaber erworben werden. Ein unwirksamer Vertrag hat daher nur Auswirkungen auf das Verhältnis vom Lizenzgeber zu einem seiner Lizenznehmer.[38]
3.2 Verbreitete Open-Source-Lizenzen
Es gibt ca. 200 Open-Source-Lizenzen. Diese fast unüberschaubare Anzahl an OSL existiert, da Softwareunternehmen oft neue Lizenzen zu neuen Software-produkten entwickeln, anstatt vorhandene Lizenzen zu verwenden. OSL zeichnen sich dadurch aus, dass die Urheber der Software Dritten mehr Rechte einräumen als Lizenzmodelle für proprietäre Software. Es gibt seitens des Urhebers keinen vollständigen Verzicht auf das Urheberrecht an der Software. Je nach Lizenz gibt es bestimmte Rechte und Pflichten, damit eine Software vervielfältigt, verbreitet und verändert werden darf. OSL werden nicht zur Erzielung von Lizenzgebühren gewährt, sondern sollen die gewährten Nutzungsmöglichkeiten sichern und realisieren.[39]
Abbildung 2 zeigt die, laut dem Open Source Resource Center von Black Duck Software, populärsten OSL mit Stand 12. Juli 2012. Es handelt sich um eine reine Häufigkeitsangabe der OSL.[40]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Black Duck Software (2012), o. S.
Abbildung 2: Verteilung von Open-Source-Lizenzen
Die Vielzahl an Open-Source-Lizenzen treffen unterschiedliche Aussagen zu Haftung und Gewährleistung, der Weitergabe und den Nutzungsrechten. Die eine OSL gibt es nicht. Eine Unterteilung der OSL nach ihrer Implementierung von Copyleft hat sich in der Literatur durchgesetzt. Je nach Grad der Implementierung steht stellvertretend eine OSL für alle anderen. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Implementierungen gleich ausfallen. Trotz gleichem Grad der Implementierung können diese sehr unterschiedlich ausfallen. Lizenzen mit strengem Copyleft werden auch als GPL-artige Lizenzen bezeichnet. MPL-artige Lizenzen implementieren das Copyleft beschränkter. Lizenzen ohne Copyleft werden als BSD-artige Lizenzen bezeichnet. Eine weitere Kategorie sind Lizenzen, die im Hinblick auf das Copyleft dem Lizenzgeber eine Wahl bei den Derivaten lassen.
Tabelle 2 veranschaulicht die Implementierung von Copyleft für alle in dieser Thesis genannten Lizenzen. Es werden aber nicht alle Lizenzen näher behandelt. Stellvertretend für die Lizenzen mit einer strengen Interpretation wird die GNU General Public License (GPL) betrachtet. GNU ist keine Abkürzung, sondern ein rekursives Akronym von „GNU’s Not Unix!“. Für die Lizenzen, die Copyleft nur beschränkt interpretieren, steht die GNU Lesser General Public License (LGPL). Repräsentativ für alle Lizenzen ohne Copyleft wird die Lizenz der Berkeley Software Distribution mit drei Klauseln (BSD3) aufgezeigt. Die Artistic License (AL) wird stellvertretend für Lizenzen mit einem Wahlrecht in Bezug auf Copyleft behandelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Implementierung von Copyleft
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lizenzen ohne Copyleft und Lizenzen mit Wahlrecht besteht darin, dass Lizenzen ohne Copyleft dem Lizenznehmer alle Freiheiten des Nutzungsrechts einräumen. Es gibt keine Bedingungen bei Veränderungen der Software hinsichtlich der zu verwendenden Lizenz bei Derivaten. Sie können sowohl unter einer beliebigen OSL als auch unter einer proprietären Lizenz weitervertrieben werden. Lizenzen mit Wahlrecht sehen je nach Umfang der Softwaremodifikation verschiedene rechtliche Folgen vor. Zudem hat der Lizenznehmer bei der Lizenzierung von Derivaten verschiedene Wahl-möglichkeiten.
3.2.1 Open-Source-Lizenzen mit strengem Copyleft
Die GPL gilt als eine der wichtigsten und bekanntesten OSL, da ein wesentlicher Bestandteil des Betriebssystems GNU / Linux unter ihr lizenziert ist. Version 1.0 der GPL ist heutzutage nicht mehr relevant. Version 2 der GPL aus dem Jahr 1991 ist immer noch die am weitesten verbreitete OSL (siehe Abbildung 2). Sie bildet den Grundtypus eines Großteils der existierenden OSL. Die GPL wurde im Wesentlichen von Richard Stallmann, Gründer des GNU-Projektes, verfasst. Sie hat als erste Lizenz eine Klausel für Copyleft verwendet. Durch diese Klausel räumt die GPL dem Lizenznehmer weitreichende Rechte und Pflichten bei der Nutzung einer Software ein. Die Pflichten gelten aber nur für Nutzer, welche die Software über ihre schlichte Benutzung hinaus verwenden wollen. Darunter fallen beispielsweise die Einräumung von Entwicklungs- und Vertriebsrechten.[41]
Die FSF hat das alleinige Recht, eine neue Version der GPL zu veröffentlichen. Sie bildet die organisatorische und politische Basis des Modells freier Software. Die FSF behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit neue Versionen der GPL zu veröffentlichen. Im Jahr 2007 wurde Version 3 der GPL veröffentlicht. Sie wurde an technische und rechtliche Neuerungen angepasst. Ebenso wurde auf eine internationale bessere Verwendbarkeit geachtet. Die GPL V3 erlangte schnell einen relevanten Marktanteil. Allerdings hat sie immer noch eine geringere Verbreitung als die Version 2.[42]
Die GPL räumt jedem ein einfaches Nutzungsrecht ein. Sie schließt die Haftung der Entwickler im Rahmen der Gesetze aus. Durch die strenge Copyleft-Klausel müssen Derivate ebenfalls unter der GPL stehen. Dies stellt sicher, dass jede weiterentwickelte Version einer Software den ursprünglichen Entwicklern und jedem anderen zur Verfügung steht. Lizenzkosten für die Gewährung von Nutzungsrechten dürfen nicht erhoben werden. Trotzdem können Kosten für eine Software, die unter der GPL steht, anfallen. Es ist sehr wohl legitim, Gebühren für den Vertrieb der Software zu erheben.[43]
In der GPL V2 werden die Rechte der Lizenznehmer in den Ziffern 1 und 2 behandelt. Ziffer 1 gewährt dem Lizenznehmer das Recht, unveränderte Kopien des Quelltextes anzufertigen und zu verbreiten. Die Befugnis zur Veränderung des Quelltextes findet sich in Ziffer 2.[44]
[...]
[1] Greve, G. (2001) zitiert nach: Krumbein, T. (2004), S. 9.
[2] Vgl. Heinrich, H. u. a. (2006), S. 72.
[3] Vgl. BITKOM (2005), S. 7, 11-12; Gläßer, L. (2004), S. 46; Heinrich, H. u. a. (2006), S. 82-83.
[4] Vgl. Heinrich, H. u. a. (2006), S. 74-75; Hoeren, T. (2004), S. 229; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 180; Spindler, G. (2004), S.153-154.
[5] Vgl. Jaeger, T. u. a. (2005), S. XI, 1.
[6] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 10; Gläßer, L. (2004), S. 26; Heinrich, H. u. a. (2006), S. 71; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 1, 63.
[7] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 11-12; Bundesverwaltungsamt (2011c), S. 55; Gläßer, L. (2004), S. 26.
[8] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 27; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 3.
[9] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 26, 43-44; Hennig, S. (2009), S. 17; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 162; Krumbein, T. (2004), S. 41; UrhG (2011), § 29, 31.
[10] Vgl. BITKOM (2005), S. 6-7; BITKOM (2008), S. 29; Gläßer, L. (2004), S. 44; Krumbein, T. (2004), S. 40.
[11] Vgl. Groll, T. (2012), S. 3, 5.
[12] Vgl. Groll, T. (2012), S. 7-10, 12.
[13] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 6; Gläßer, L. (2004), S. 25; Hennig, S. (2009), S. 17.
[14] Vgl. Jaeger, T. u. a. (2005), S. 9; UrhG (2011), § 31 Abs. 2, 3.
[15] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 25; Oettinger, R. (2010a), o. S.
[16] Vgl. Hennig, S. (2009), S. 7; Oettinger, R. (2010a), o. S.; Spiegel, A. (2006), S. 19.
[17] Vgl. Ellmer, B. (2008), S. 3; Groll, T. (2012), S. 21; Hennig, S. (2009), S. 7; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 3; Maaß, C. (2008), S. 48.
[18] Vgl. Free Software Foundation (2011b), o. S.; Gläßer, L. (2004), S. 19; Renner, T. u. a. (2005), S. 15.
[19] Vgl. Groll, T. (2012), S. 22; Hennig, S. (2009), S. 8; Renner, T. u. a. (2005), S. 14-15; Saleck, T. (2005), S. 8-9.
[20] UrhG (2011), § 29 Abs. 1.
[21] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 6; Free Software Foundation (2011b), o. S.; Gläßer, L. (2004), S. 13; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 6; Spindler, G. (2004), S. 18; UrhG (2011), § 29 Abs. 2.
[22] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 13; Groll, T. (2012), S. 21; Renner, T. u. a. (2005), S. 14; Saleck, T. (2005), S. 8.
[23] Vgl. Balka, K. (2011), S. 17; Ellmer, B. (2008), S. 3; Groll, T. (2012), S. 23; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 1.
[24] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 17; Groll, T. (2012), S. 23; Stallman, R. (2012), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 5.
[25] Vgl. Groll, T. (2012), S. 23; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 6.
[26] Vgl. Ellmer, B. (2008), S. 3; Hennig, S. (2009), S. 8; Maaß, C. (2008), S. 48; Spindler, G. (2004), S. 18; Stallman, R. (2012), o. S.
[27] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 7; Ellmer, B. (2008), S. 3; Gläßer, L. (2004), S. 22-25; Hennig, S. (2009), S. 8, 96; Laurent, A. M. St. (2004), S. 8-11; Open Source Initiative (o. J.), o. S.; Wichmann, T. (2005), S. 10.
[28] Vgl. Groll, T. (2012), S. 21.
[29] Vgl. Bürkner, R. M. (2003), S. 3, 29-30.
[30] Vgl. Gläßer, L. (2004), S. 25; Groll, T. (2012), S. 20, 35; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 95; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 6-7.
[31] Vgl. Mantz, R. (2007), S. 415.
[32] UrhG (2011), § 69 d) Abs. 1.
[33] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 9; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 7-8; Oettinger, R. (2010c), o. S.; UrhG (2011), § 69 d) Abs. 1.
[34] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 9.
[35] Vgl. BGB (2012), § 305; Schulze, S. (2008), S. 4.
[36] Vgl. Bundesverwaltungsamt (2011c), S. 42; Gläßer, L. (2004), S. 27; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 95-96; Spindler, G. (2004), S. 16-17.
[37] Vgl. Hampel, T., Steinbring, M. (2008), S. 78-79.
[38] Vgl. Groll, T. (2012), S. 27, 246; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 66-67; Regierungskommission DCGK (2012), S. 6.
[39] Vgl. Hennig, S. (2009), S. 19, 21; IfrOSS (o. J.), o. S.; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 15; Renner, T. u. a. (2005), S. 22.
[40] Vgl. Black Duck Software (2012), o. S.
[41] Vgl. Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 24; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 1, 20.
[42] Vgl. BITKOM (o. J.), S. 7; Free Software Foundation (2012b), o. S.; Gläßer, L. (2004), S. 45; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 24, 50; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 1, 2, 10; Koglin, O. (2007), S. 12.
[43] Vgl. Hennig, S. (2009), S. 20; Jaeger, T. u. a. (2005), S. 15; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 25-27.
[44] Vgl. Free Software Foundation (1991), o. S.; Jaeger, T., Metzger, A. (2011), S. 25-27.
- Citar trabajo
- Alexander Schaaf (Autor), 2012, Vergleich von Open-Source-Lizenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202187