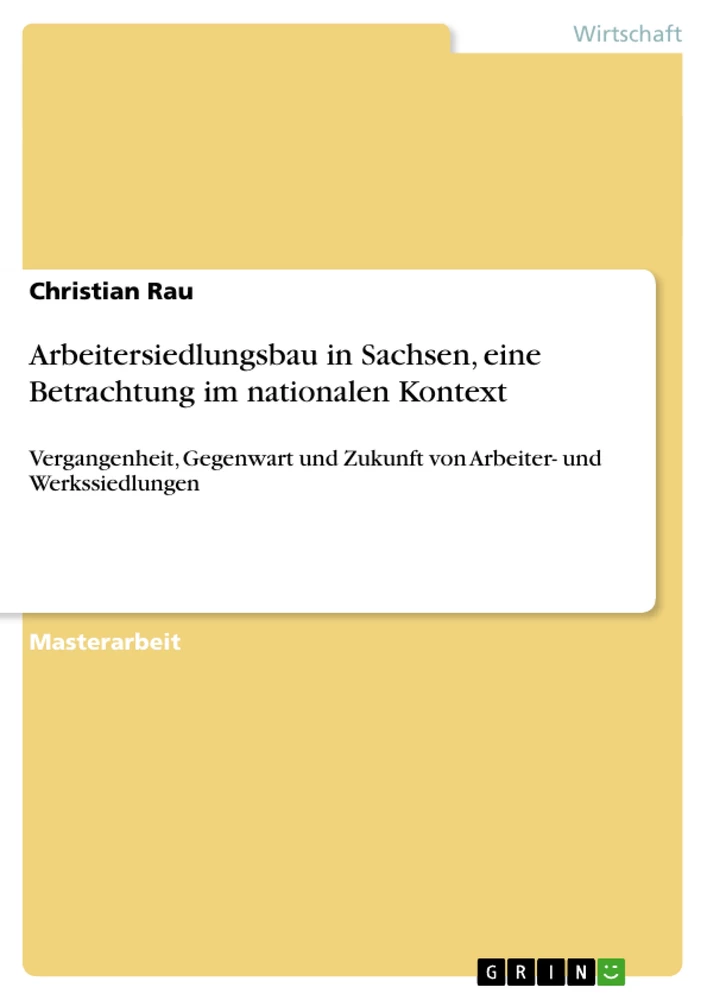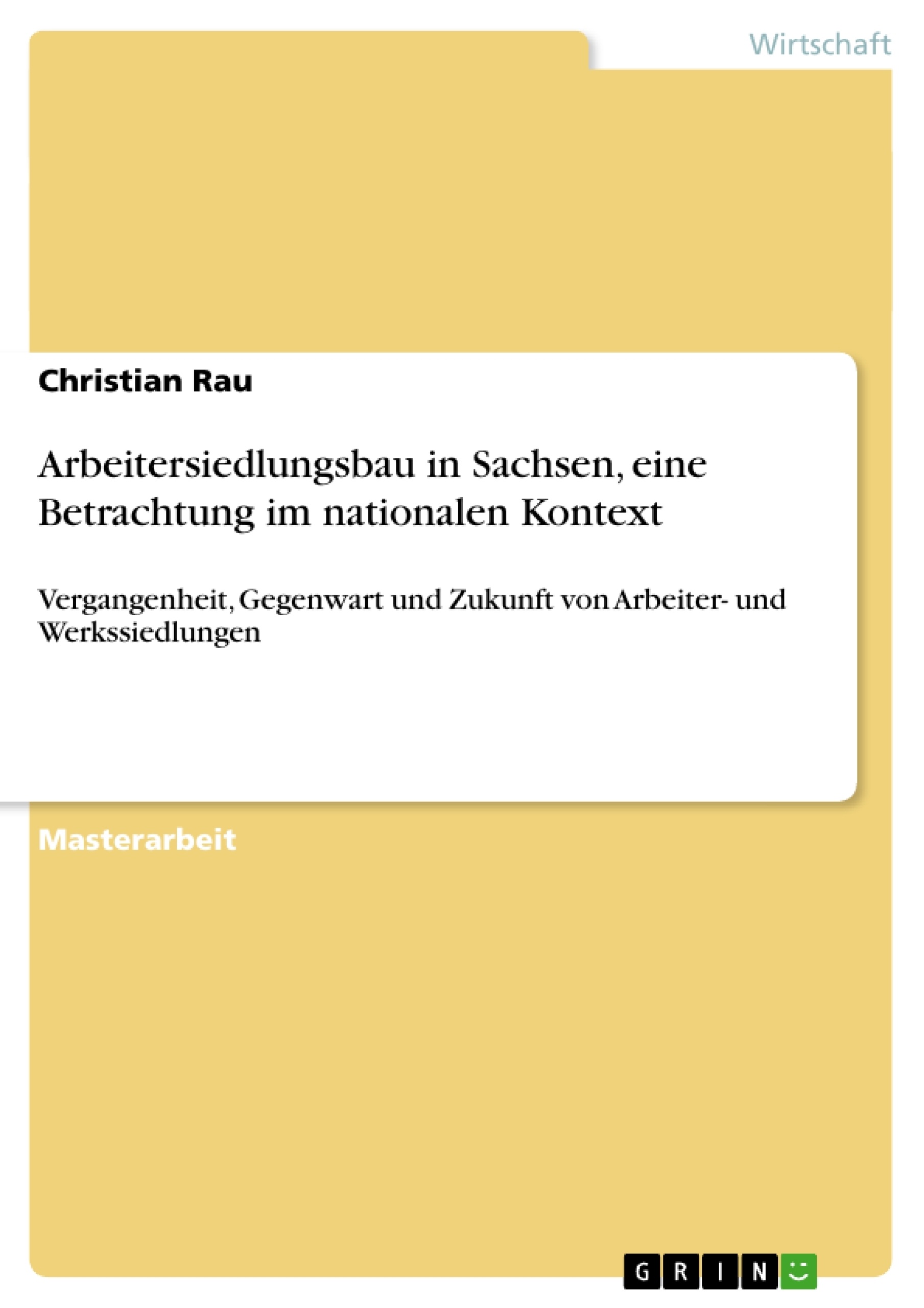In Deutschland finden sich unzählige mittlerweile denkmalgeschützte Wohnsiedlungen, die seit etwa 1830 von Unternehmern oder Unternehmen errichtet wurden. Diese haben teilweise im Laufe der Zeit unterschiedliche Besitzer erlebt, wurden der jeweiligen Erfordernissen angepasst und stehen zum jetzigen Zeitpunkt als kulturhistorische Denkmale sehr gut da. Andererseits gibt es aber auch Werkssiedlung, die zum heutigen Tag von hohen Leerständen geprägt sind. So finden sich auch in Sachsen einige sehr differenzierte Beispiele für solche Bauten. Von beson-derem Interesse ist bei deren Analyse auch der Kopplung von Wohn- und Arbeitssituation, also die Bindung des Angestellten an seinen Arbeitgeber über die Bereitstellung von Wohnraum. Letztlich lassen sich aus der Gesamtanalyse der derzeitigen Situation Schlüsse auf die Entwick-lung von Arbeiter- und Werkswohnsiedlungen ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einordnung deutscher Arbeitersiedlungen in den europäischen Kontext
- 1.1 Ursprünge
- 1.1.1 Entstehung von Arbeitersiedlungen im Zuge der Industriellen Revolution, Exzerpt: Großbritannien
- 1.1.2 Anfänge des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland
- 1.2 Höhepunkte der Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland anhand realisierter Beispiele
- 1.2.1 Kuchen (Baden-Württemberg)
- 1.2.2 Kammgarnquartier Augsburg (Bayern)
- 1.2.3 Hannover-Körtingsdorf (Niedersachsen)
- 1.2.4 Siemensstadt Berlin (Berlin)
- 1.2.5 Hafenviertel Emden (Niedersachsen)
- 1.2.6 Kruppstadt/ Margarethenhöhe Essen (Nordrhein-Westfalen)
- 1.2.7 Kolonie Frankfurt am Main (Hessen)
- 1.2.8 Limburgerhof (Rheinland-Pfalz)
- 1.2.9 Werkssiedlung Piesteritz (Sachsen-Anhalt)
- 1.2.10 Daimler-Werkssiedlung Ludwigsfelde (Brandenburg)
- 1.2.11 Zechenkolonien (deutschlandweit)
- 1.2.12 Eisenbahnersiedlungen (deutschlandweit)
- 1.2.13 Postsiedlungen (deutschlandweit)
- 1.2.14 Genossenschaftlicher Siedlungsbau (deutschlandweit)
- 1.2.15 Arbeiterstädte wie Wolfsburg, Neue Stadt Wulfen und Eisenhüttenstadt (deutschlandweit)
- 1.3 Abklang des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland und dessen Folgen
- 2 Prinzip der Kopplung von der Wohnsituation an die Erwerbstätigkeit
- 2.1 Wohnraum im Eigentum des Unternehmers
- 2.1.1 Werksdienstwohnung
- 2.1.2 Werksmietwohnung
- 2.2 Wohnraum im Eigentum des Arbeitnehmers
- 2.3 Erbbaurechtsmodelle
- 2.1 Wohnraum im Eigentum des Unternehmers
- 3 Werks- und Arbeitersiedlungsbau in Sachsen
- 3.1 Charakteristik sächsischer Arbeiter- und Werkssiedlungen von der Industriellen Revolution bis 1949
- 3.2 Charakteristik sächsischer Arbeiter- und Werkssiedlungen in der Deutschen Demokratischen Republik
- 3.3 Charakteristik sächsischer Arbeiter- und Werkssiedlungen nach 1990
- 3.4 Realisierte Beispiele für Arbeiter- und Werkssiedlungen
- 3.4.1 Krochsiedlung (Leipzig-Gohlis)
- 3.4.2 Gartenstadt Marienbrunn/ Nibelungenring (Leipzig-Marienbrunn)
- 3.4.3 Erla-Siedlung (Leipzig-Thekla)
- 3.4.4 Siedlung der Landessiedlungsgesellschaft Sachsen/ Siedlung der Vereinigten Strohstoff-Fabriken (Coswig)
- 3.4.5 Siedlung „Eisoldsche Häuser“ (Radebeul)
- 3.4.6 Gartenstadt Hellerau (Dresden-Hellerau)
- 3.4.7 Gartenstadt Lauta-Nord (Lauta)
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
- 4.1 Typologische Muster: Festgestellte Bautypen und Siedlungstypen
- 4.2 Bedeutung der Arbeitersiedlungen in Sachsen /Vergleich mit der Situation in Gesamtdeutschland
- 4.3 Zukunft der Arbeiter- und Werkssiedlungen in Deutschland
- Anhang
- Quellenverzeichnis
- Kurzfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Arbeitersiedlungsbau in Sachsen im nationalen Kontext. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung, die gegenwärtige Situation und zukünftige Perspektiven von Arbeiter- und Werkssiedlungen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem sächsischen Raum, insbesondere den Metropolregionen Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie dem Erzgebirge.
- Historische Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland und Sachsen
- Rechtliche Modelle der Kopplung von Wohnsituation und Erwerbstätigkeit
- Charakteristika sächsischer Arbeitersiedlungen in verschiedenen Epochen
- Ausgewählte Beispiele für Arbeiter- und Werkssiedlungen in Sachsen
- Zukünftige Perspektiven des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einordnung deutscher Arbeitersiedlungen in den europäischen Kontext: Dieses Kapitel ordnet den deutschen Arbeitersiedlungsbau in den europäischen Kontext ein, mit einem Schwerpunkt auf Großbritannien und Deutschland als Musterländern der industriellen Revolution. Es untersucht die Ursprünge des Arbeitersiedlungsbaus, die Herausforderungen der frühen Industrialisierung (wie Landflucht und Slumbildung) und die unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Arbeiterwohnungsbaus in beiden Ländern, von den frühen, ungeplanten Siedlungen bis hin zur Gartenstadt-Idee. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Bautypen und die Motive der Arbeitgeber, Arbeiter durch Wohnraum an die Unternehmen zu binden. Beispiele aus verschiedenen Regionen Deutschlands veranschaulichen die Vielfalt der Entwicklungen.
2 Prinzip der Kopplung von der Wohnsituation an die Erwerbstätigkeit: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen und Modelle der Kopplung von Wohnsituation und Erwerbstätigkeit. Es unterscheidet zwischen Werksdienstwohnungen (ohne expliziten Mietvertrag) und Werksmietwohnungen (mit separatem Mietvertrag), wobei die jeweiligen Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie die Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses für das Wohnverhältnis im Detail erläutert werden. Zusätzlich wird der Wohnungsbau durch Arbeitergenossenschaften sowie das Erbbaurecht als alternative Modelle zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum untersucht.
3 Werks- und Arbeitersiedlungsbau in Sachsen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifische Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus in Sachsen. Es betrachtet die wirtschaftliche Geschichte Sachsens von der industriellen Revolution bis zur Gegenwart und deren Einfluss auf den Wohnungsbau. Die Kapitel unterteilen die sächsischen Arbeitersiedlungen in verschiedene Epochen (bis 1949, DDR-Zeit, nach 1990) und analysieren ihre jeweiligen Charakteristika in Bezug auf Bauweise, soziale Infrastruktur und Eigentumsverhältnisse. Der Wandel der Siedlungen durch die deutsche Wiedervereinigung und die Herausforderungen des Stadtumbaus werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arbeitersiedlungsbau, Werkssiedlungen, Sachsen, Deutschland, Industrielle Revolution, Gartenstadt, Wohnungspolitik, Sozialer Wohnungsbau, Baugenossenschaften, Erbbaurecht, Stadtumbau, Denkmalschutz, Industriestandorte, Wirtschaftsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Arbeitersiedlungsbau in Sachsen
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Arbeitersiedlungsbau in Sachsen im nationalen Kontext. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, die gegenwärtige Situation und zukünftige Perspektiven von Arbeiter- und Werkssiedlungen, mit besonderem Fokus auf die Metropolregionen Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie das Erzgebirge.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland und Sachsen, die rechtlichen Modelle der Kopplung von Wohnsituation und Erwerbstätigkeit, die Charakteristika sächsischer Arbeitersiedlungen in verschiedenen Epochen, ausgewählte Beispiele für Arbeiter- und Werkssiedlungen in Sachsen und die zukünftigen Perspektiven des Arbeitersiedlungsbaus in Deutschland.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel: Kapitel 1 ordnet den deutschen Arbeitersiedlungsbau in den europäischen Kontext ein und beleuchtet dessen Ursprünge und Entwicklungsphasen anhand von Beispielen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Kapitel 2 analysiert die rechtlichen Grundlagen und Modelle der Kopplung von Wohnsituation und Erwerbstätigkeit. Kapitel 3 konzentriert sich auf die spezifische Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus in Sachsen, unterteilt in verschiedene Epochen (bis 1949, DDR-Zeit, nach 1990), und analysiert deren Charakteristika. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Arbeiter- und Werkssiedlungen in Deutschland.
Welche Beispiele für Arbeitersiedlungen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht zahlreiche Beispiele für Arbeitersiedlungen in Deutschland, inklusive Kuchen (Baden-Württemberg), Kammgarnquartier Augsburg (Bayern), Hannover-Körtingsdorf (Niedersachsen), Siemensstadt Berlin (Berlin), Hafenviertel Emden (Niedersachsen), Kruppstadt/ Margarethenhöhe Essen (Nordrhein-Westfalen), Kolonie Frankfurt am Main (Hessen), Limburgerhof (Rheinland-Pfalz), Werkssiedlung Piesteritz (Sachsen-Anhalt), Daimler-Werkssiedlung Ludwigsfelde (Brandenburg), Zechenkolonien, Eisenbahnersiedlungen, Postsiedlungen, Genossenschaftlicher Siedlungsbau, Arbeiterstädte wie Wolfsburg, Neue Stadt Wulfen und Eisenhüttenstadt. In Sachsen werden die Krochsiedlung (Leipzig-Gohlis), Gartenstadt Marienbrunn/ Nibelungenring (Leipzig-Marienbrunn), Erla-Siedlung (Leipzig-Thekla), Siedlung der Landessiedlungsgesellschaft Sachsen/ Siedlung der Vereinigten Strohstoff-Fabriken (Coswig), Siedlung „Eisoldsche Häuser“ (Radebeul), Gartenstadt Hellerau (Dresden-Hellerau) und Gartenstadt Lauta-Nord (Lauta) genauer betrachtet.
Welche rechtlichen Modelle der Kopplung von Wohnsituation und Erwerbstätigkeit werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Werksdienstwohnungen (ohne expliziten Mietvertrag), Werksmietwohnungen (mit separatem Mietvertrag), Wohnungsbau durch Arbeitergenossenschaften und Erbbaurecht als alternative Modelle zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.
Welche Epochen werden im Kontext des sächsischen Arbeitersiedlungsbaus betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den sächsischen Arbeitersiedlungsbau in drei Epochen: bis 1949, die DDR-Zeit und die Zeit nach 1990, analysiert die jeweiligen Charakteristika in Bezug auf Bauweise, soziale Infrastruktur und Eigentumsverhältnisse und beleuchtet den Wandel der Siedlungen durch die deutsche Wiedervereinigung und die Herausforderungen des Stadtumbaus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitersiedlungsbau, Werkssiedlungen, Sachsen, Deutschland, Industrielle Revolution, Gartenstadt, Wohnungspolitik, Sozialer Wohnungsbau, Baugenossenschaften, Erbbaurecht, Stadtumbau, Denkmalschutz, Industriestandorte, Wirtschaftsgeschichte.
- Quote paper
- Christian Rau (Author), 2012, Arbeitersiedlungsbau in Sachsen, eine Betrachtung im nationalen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202139