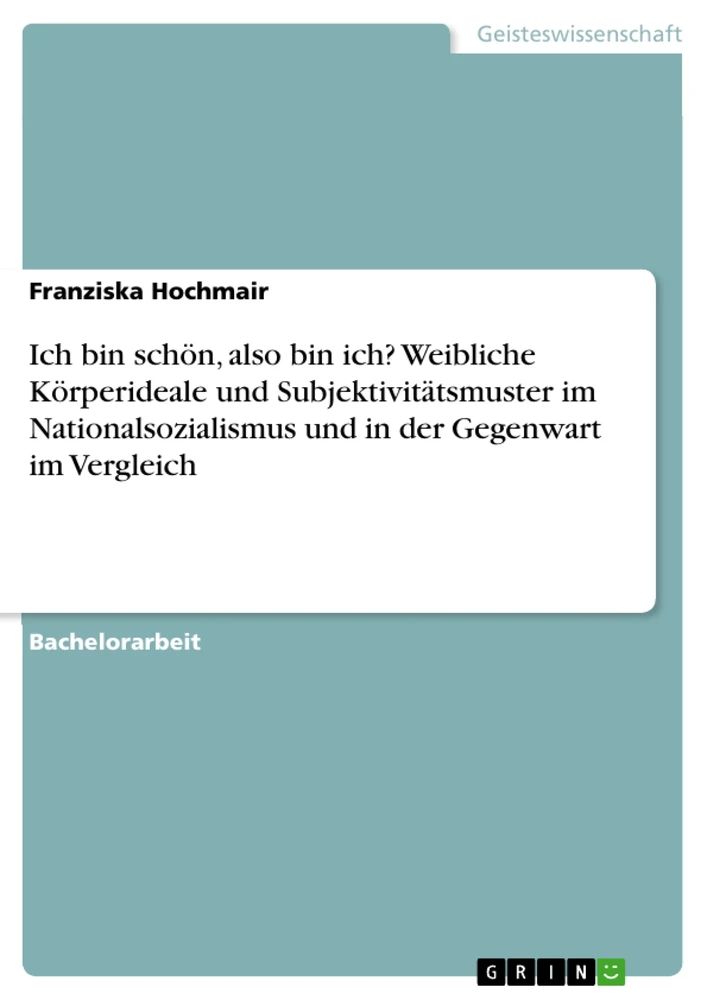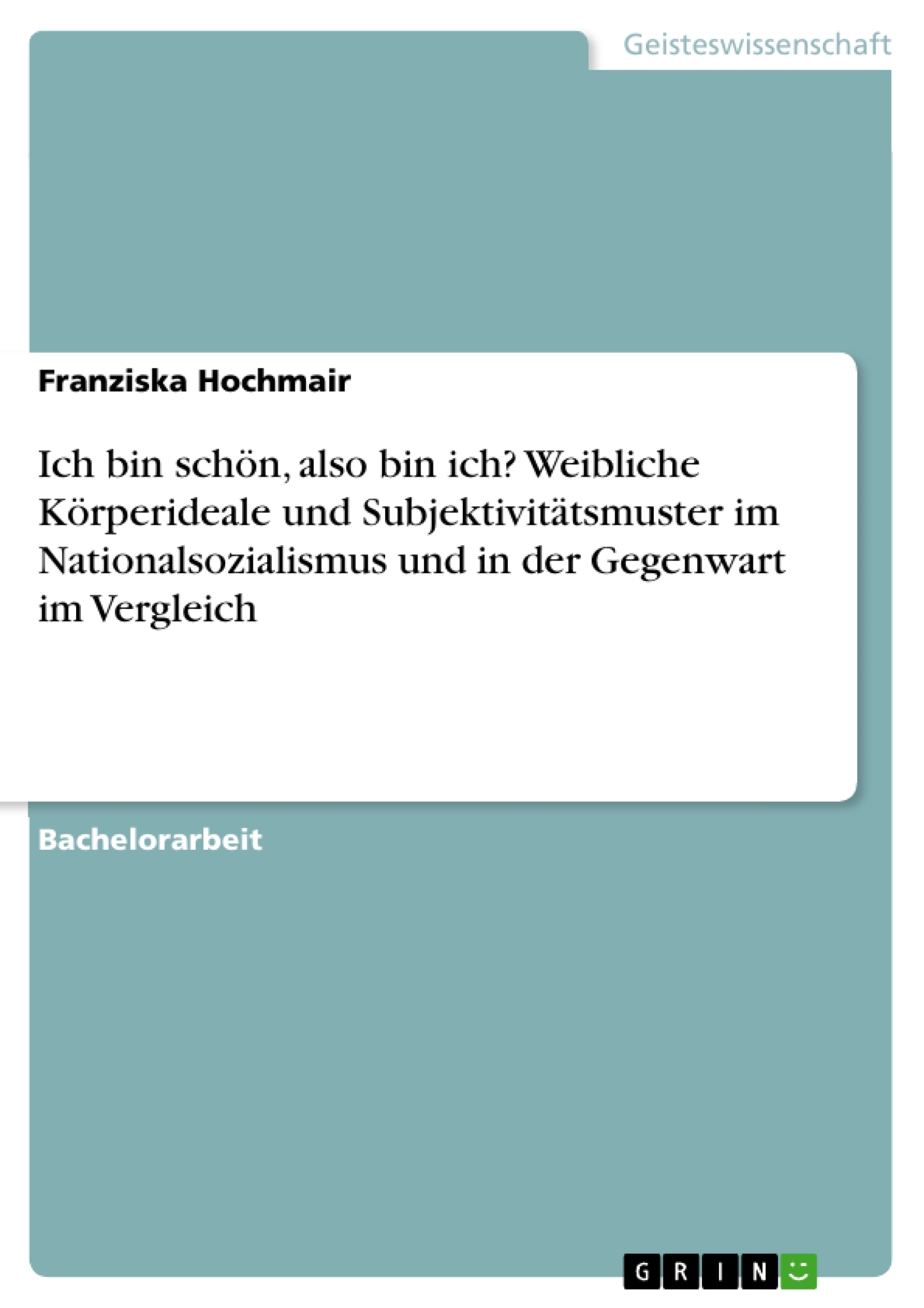„Schönheit ist ein gar willkommener Gast.“ – so sinnierte vor ungefähr 300 Jahren schon Johann Wolfgang von Goethe. Seit jeher widmet sich der Mensch seinem Körper, seinem Aussehen, seiner Schönheit.
Selbstbewusstsein, beruflicher sowie privater Erfolg, ja sogar die Lebensqualität – das alles hängt für viele vom äußeren Erscheinungsbild eines Menschen ab. Dabei sind die meisten Personen der Ansicht, dass Attraktivität und Erfolg unmittelbar miteinander verbunden sind. Ich möchte daher herausfinden, welche Anforderungen die Gesellschaft an das Aussehen von Individuen stellt.
Der Fokus dieser Bachelorarbeit mit dem Thema „Ich bin schön, also bin ich? Weibliche Körperideale und Subjektivitätsmuster im Nationalsozialismus und der Gegenwart im Vergleich“ wird sich auf das Aussehen der Frau legen, da das weibliche Geschlecht zwar im Allgemeinen als das starke Geschlecht gilt, es trotzdem aber immer mit Vorurteilen zu kämpfen hat und sich gerade wegen und auch mit seiner Körperlichkeit gegen die Männerwelt behaupten muss. Dieses weibliche Bild möchte ich in zwei unterschiedlichen Zeiträumen untersuchen: Zum einen blicke ich näher auf den Nationalsozialismus als eine sehr außergewöhnliche Etappe in der deutschen Geschichte. In dieser Zeit konnte der Staat eine enorme Wirkung auf das weibliche Individuum und sein körperliches Aussehen ausüben, so dass immer ein bestimmtes Bild der Frau vermittelt wurde. Zum anderen blicke ich mich in der heutigen Zeit um. Das Aussehen von Frauen wird immer mehr von der Werbung und den darin abgebildeten Idealkörper von Supermodels beeinflusst und durch Mode, Diäten und Schönheitsoperationen verändert. Mit meiner Descartes-Abwandlung „Ich bin schön, also bin ich?“ ziele ich genau darauf ab, dass Aussehen immer wichtiger dafür wird, um sich im privaten sowie im beruflichen Leben zu entfalten. Das Fragezeichen dahinter verdeutlicht aber, dass Schönheit nicht gleichzeitig ein vollkommenes Leben bedeuten muss, sondern dass dazu noch mehr Faktoren berücksichtigt werden müssen. Das Original „Ich denke, also bin ich“ impliziert einen denkenden Menschen, der nur auf Grund seiner Fähigkeit zum Denken und Überlegen als Mensch konzipiert wird. Doch ist ein Mensch auch ein Mensch, nur weil er schön ist?
Zusammenfassend will ich also auf den folgenden Seiten darstellen, anhand welcher Merkmale sich heute und im Nationalsozialismus weibliche Körperideale festmachen lassen und welche Erwartungen damit verbunden werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Relevanz der Schönheit in den Sozialwissenschaften
- Die Evolution der Schönheit
- Die Subjektivitätstheorie nach Michel Foucault
- Schönheit im Nationalsozialismus
- Das arische Ideal
- Körperfreude
- Nackte Natürlichkeit
- Zwischenfazit
- Schönheit in der Gegenwart
- Magere Zeiten
- Jugendlichkeit
- Fitness und Schönheits-OPS
- Individualität und Authentizität
- Zwischenfazit
- Ich bin schön, also bin ich (gut)?
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht, wie weibliche Körperideale im Nationalsozialismus und in der Gegenwart definiert wurden und welche Erwartungen damit verbunden sind. Die Autorin analysiert die Bedeutung des Aussehens für die Selbstfindung und das gesellschaftliche Ansehen von Frauen in beiden Epochen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Schönheit im 21. Jahrhundert eine vergleichbare Bedeutung wie im Nationalsozialismus hat.
- Weibliche Körperideale im Nationalsozialismus und in der Gegenwart
- Der Einfluss von gesellschaftlichen Normen auf die Konstruktion von Schönheit
- Die Rolle von Medien und Werbung in der Formung von Körperbildern
- Die Bedeutung von Schönheit für die Selbstfindung und das gesellschaftliche Ansehen von Frauen
- Der Vergleich der beiden Epochen hinsichtlich ihrer jeweiligen Körperideale und Subjektivitätsmuster
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas für die Sozialwissenschaften. Im zweiten Kapitel wird die Schönheit als sozialwissenschaftliches Forschungsgebiet eingeführt und ihre Bedeutung im historischen Wandel beleuchtet. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Subjektivitätstheorie von Michel Foucault, die als theoretische Grundlage für die Analyse der Körperlichkeit im Nationalsozialismus und in der Gegenwart dient. Die folgenden Kapitel befassen sich mit den jeweiligen Epochen: Kapitel 4 mit dem Nationalsozialismus, Kapitel 5 mit der Gegenwart. Die Autorin analysiert die spezifischen Merkmale der Körperideale und die damit verbundenen Erwartungen in beiden Epochen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von weiblichen Körperidealen und Subjektivitätsmustern im Nationalsozialismus und in der Gegenwart. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Schönheitsideale, gesellschaftliche Normen, Medien und Werbung, Selbstfindung, Körperlichkeit, Selbstbild, Feminismus und der Vergleich der beiden Epochen.
- Quote paper
- Franziska Hochmair (Author), 2012, Ich bin schön, also bin ich? Weibliche Körperideale und Subjektivitätsmuster im Nationalsozialismus und in der Gegenwart im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202081