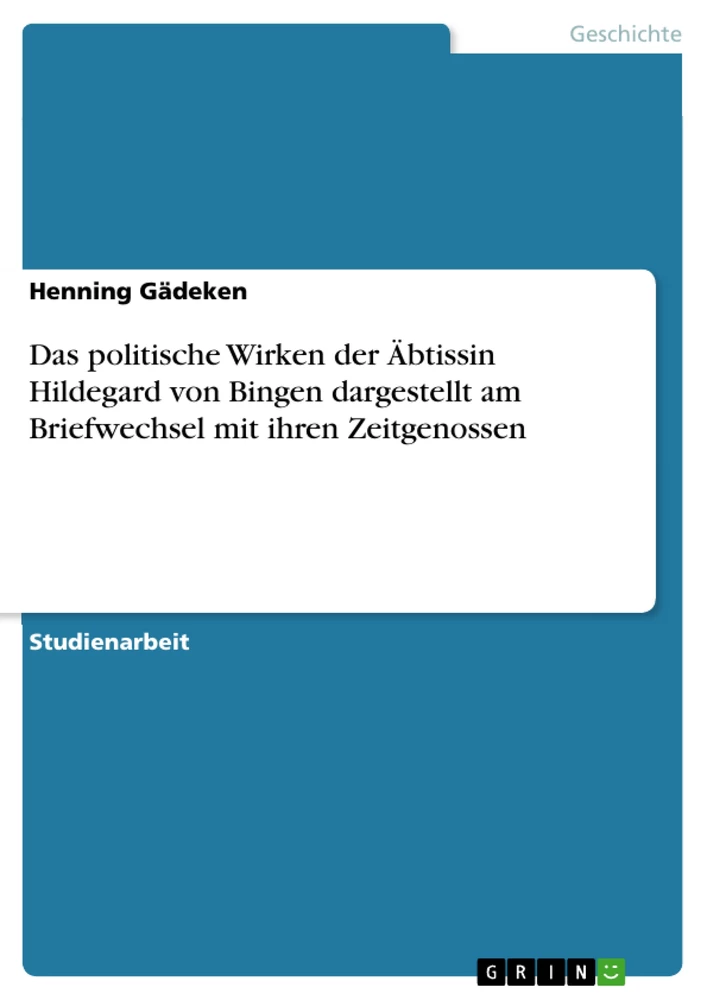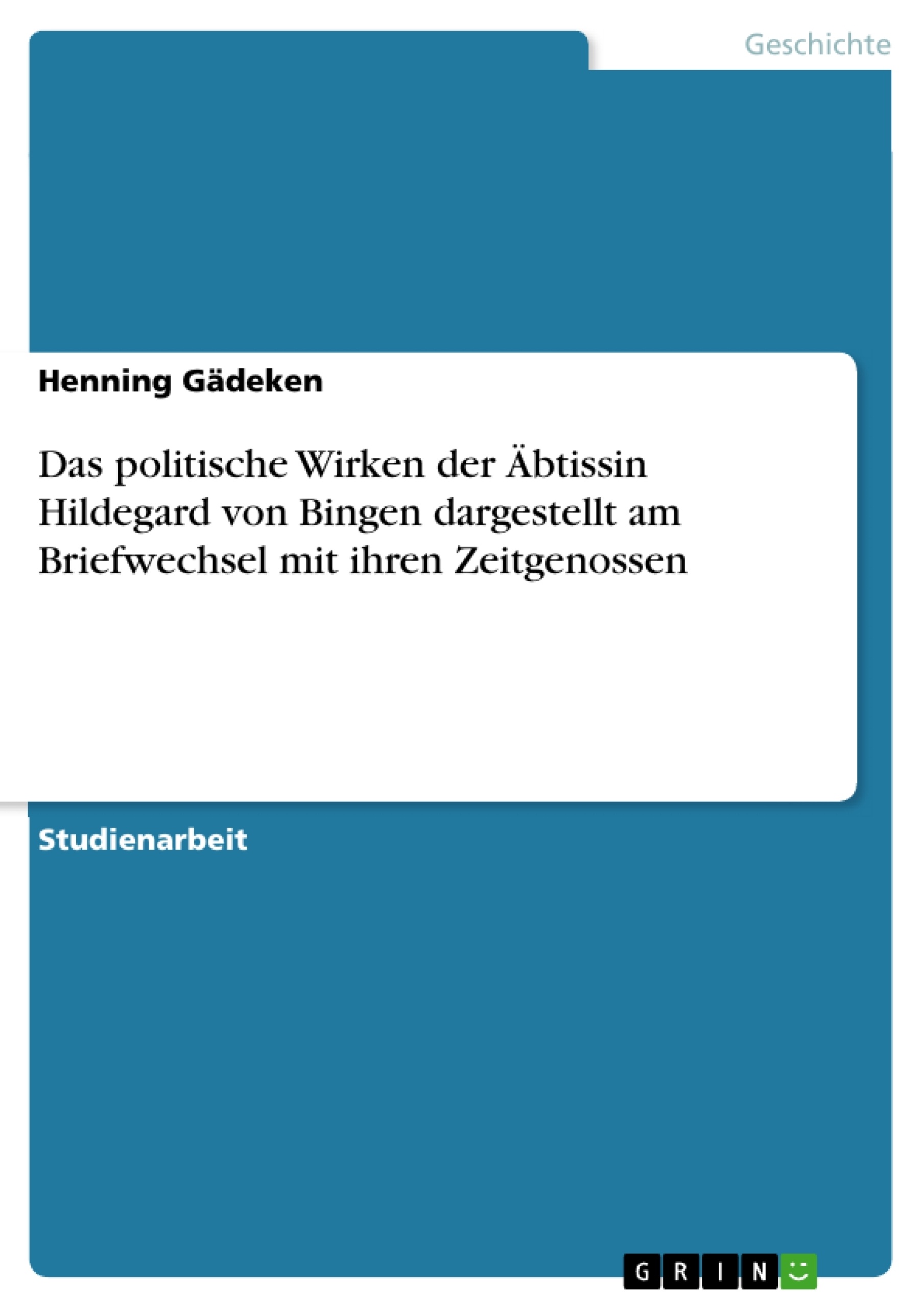Die Äbtissin Hildegard von Bingen (1098–1179) war in der mittelalterlichen Zeit, in der ausschließlich Männer die höchsten kirchlichen und weltlichen Ämter bekleideten, eine äußerst bedeutende Frau, die von ihren Zeitgenossen hoch geschätzt und verehrt wurde. Kaum eine Persönlichkeit des Mittelalters hat es erreicht, einen derart großen Fundus aussagekräftiger theologischer, naturwissenschaftlicher, medizinischer und poetischer Texte zu hinterlassen.
Als spätere benediktinische Reichsäbtissin übte Hildegard von Bingen großen politischen Einfluss aus. In ihren überlieferten Briefen an die hohe Geistlichkeit sowie an weltliche Herrscher bezog sie deutlich Stellung zu politischen Missständen, erteilte Ratschläge und scheute auch vor öffentlichem Tadel nicht zurück. Dabei bezeichnete sich Hildegard selbst als „armselige, erbärmliche und mehr als erbärmliche Frau […]“ und betonte immer wieder ihre Ungebildetheit. Ihre Worte basierten einzig und allein auf persönlicher Gotteserfahrung, die sie in Form von Visionen erhielt. Mahnend führte sie ihren tiefreligiösen Zeitgenossen nicht ihre eigenen Worte, sondern den Willen Gottes vor Augen und viele von ihnen hörten auf ihren Rat und verehrten die Meisterin vom Rupertsberg als Prophetin.
Trotz ihrer bedeutsamen Einflussnahme auf politische und gesellschaftskritische Themen des Mittelalters blieb sie stets eine bescheidene, demütige und gottesfürchtige Benediktinerin und litt während ihres langen Lebens immer wieder unter körperlicher Schwäche und diversen Krankheiten, die sie niederstreckten, wenn sie den Menschen nicht Gottes Worte offenbaren konnte.
Die herangezogenen Textquellen, anhand derer die politische Einflussnahme Hildegard von Bingens untersucht werden soll, sind in erster Linie die von Adelgundis Führkötter übersetzten und erläuterten Hildegardbriefe. Die Übersetzung des Briefwechsels Hildegard von Bingens folgt den ältesten Handschriften, die zum Großteil der Schreibstube der Rupertsberger Magistra entstammten und 1956 als echtes Hildegardisches Schrifttum nachgewiesen wurden. Adelgundis Führkötter bemühte sich trotz des „ungeglätteten Lateins“ Hildegard von Bingens die Originaltexte so wortgetreu wie möglich zu übersetzen. Zu der teilweise schwierigen Übersetzung und Deutung der Briefe kam eine lückenhafte Quellenlage, die es erforderlich machte nicht nur die Briefe Hildegards sondern auch die ihrer Briefpartner im Kontext zu sehen, um ihr politisches Wirken ganzheitlich nachzeichnen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beispiele politischer Wirksamkeit Hildegard von Bingens aufgezeigt am Briefwechsel mit ihren Zeitgenossen
- Briefwechsel mit Papst Eugen III
- Päpstliche Erlaubnis zur Verschriftlichung der Visionen
- Briefwechsel mit Erzbischof Heinrich von Mainz
- Genehmigung der Gründung des Klosters Rupertsberg
- Briefwechsel mit Kaiser Friedrich Barbarossa
- Erhebung des Rupertsberger Klosters zum Reichskloster
- Kritik am Schisma
- Briefwechsel mit der Meisterin Tenxwind
- Neue Bräuche im Kloster Rupertsberg
- Gründung des Klosters Eibingen mit ständegemischter Belegschaft
- Briefwechsel mit dem Klerus
- Mahnende Worte an den Klerus
- Briefwechsel mit den Mainzer Prälaten
- Interdikt über Kloster Rupertsberg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das politische Wirken der Äbtissin Hildegard von Bingen anhand ihrer Korrespondenz mit Zeitgenossen. Der Fokus liegt darauf, ihre Einflussnahme auf politische und gesellschaftliche Themen des Mittelalters zu beleuchten und ihre Rolle als prophetische Stimme und bedeutende Frau in einer von Männern dominierten Welt aufzuzeigen.
- Hildegards politischer Einfluss durch ihren Briefwechsel
- Analyse der Inhalte und Botschaften in ihren Briefen
- Die Rolle von Hildegard als Prophetin und Beraterin
- Hildegards Engagement für die Reform von Kirche und Gesellschaft
- Die Bedeutung von Hildegards Werk für die Geschichte des Mittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung bietet eine allgemeine Einführung in die Persönlichkeit und das Wirken Hildegard von Bingens. Sie hebt ihre herausragende Rolle als Frau in einer von Männern dominierten Zeit hervor und stellt die Bedeutung ihrer Briefe für die Erforschung ihres politischen Engagements dar.
Kapitel 2: Beispiele politischer Wirksamkeit Hildegard von Bingens aufgezeigt am Briefwechsel mit ihren Zeitgenossen: Dieses Kapitel untersucht den Briefwechsel Hildegards mit verschiedenen Zeitgenossen, darunter Papst Eugen III, Erzbischof Heinrich von Mainz, Kaiser Friedrich Barbarossa, die Meisterin Tenxwind sowie Kleriker und Mainzer Prälaten. Es werden verschiedene Beispiele für ihre politische Einflussnahme dargestellt, darunter die päpstliche Erlaubnis zur Verschriftlichung ihrer Visionen, die Gründung des Klosters Rupertsberg, die Kritik am Schisma und die Mahnung an den Klerus.
Schlüsselwörter
Hildegard von Bingen, Briefwechsel, Politik, Mittelalter, Visionen, Prophetin, Kloster Rupertsberg, Kloster Eibingen, Papst Eugen III, Erzbischof Heinrich von Mainz, Kaiser Friedrich Barbarossa, Klerus, Mainzer Prälaten.
- Quote paper
- Henning Gädeken (Author), 2012, Das politische Wirken der Äbtissin Hildegard von Bingen dargestellt am Briefwechsel mit ihren Zeitgenossen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201570