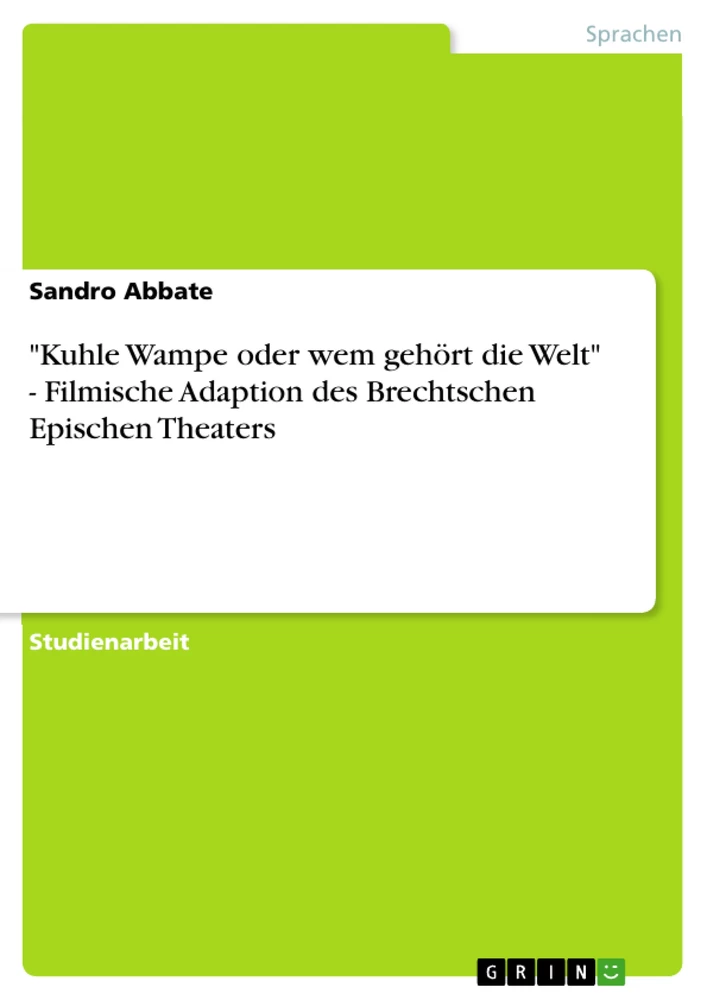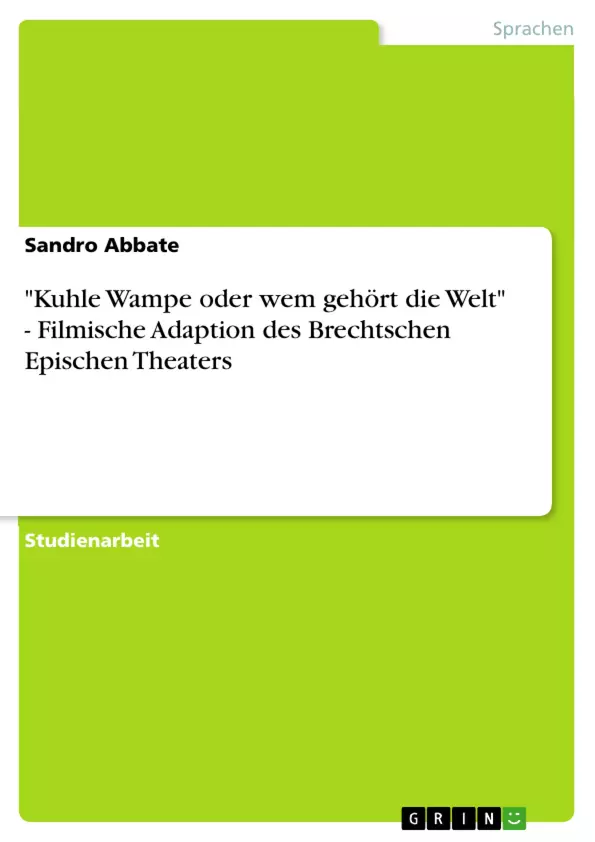Der Film „Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt“ ist 1932 in Deutschland erschienen. Er stellt Brechts letzte öffentliche Aufführung in der Weimarer Republik dar. „Kuhle Wampe“ kann als eine Art Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm angesehen werden und enthält darüber hinaus Elemente eines Musikfilms. Das Drehbuch des von Slaton Dudow gedrehten Films schrieb Bertolt Brecht, der Schöpfer des Begriffes des epischen Theaters. Brecht grenzte das epische vom aristotelischen Theater ab.
Diese Abgrenzung ist Inhalt des ersten Teils dieser Arbeit. Hier soll auf die einzelnen Aspekte und Effekte des epischen Theaters im Vergleich zum aristotelischen Theater eingegangen werden, wobei Punkte wie der Verfremdungseffekt, der Einsatz von Musik und Besonderheiten im Bühnenaufbau und der Beleuchtung etc. angesprochen werden sollen.
Im zweiten Teil wird im Rahmen der Filmanalyse von „Kuhle Wampe auf folgende Punkte eingegangen: Zunächst erfolgt die Inhaltsanalyse, in der neben der Beschreibung des Inhalts auch die zentrale Frage- und Problemstellung des Filmes herausgearbeitet wird. Anschließend werden in der Figurenanalyse die einzelnen Charaktere beschrieben. Auch deren Sprache und das Erscheinungsbild der Figuren werden ein Thema sein. In der Normen- und Werteanalyse wird beabsichtigt, die Normen und Werte, die der Film zu vermitteln versucht, aufzuzeigen und die Intention Brechts und des Regisseurs darzustellen. Anschließend folgt eine kurze Darstellung filmästhetischer Aspekte, wie Kameraeinstellungen, Ton und Montage.
Im letzten Teil soll aufgezeigt werden, welche Aspekte des epischen Theaters Dudow und Brecht im Film „Kuhle Wampe“ einsetzen und inwiefern sich diese filmisch adaptieren lassen. So experimentiert der Film beispielsweise mit der Genre-Zersetzung, indem er zunächst nach Art eines Reportagefilms gedreht ist und einer desillusionierend-enthüllenden Tendenz folgt, dann aber diese Konventionen durchbricht, indem er beginnt, den Regeln des Spielfilms zu gehorchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dramatisches versus Episches Theater
- Eine Gegenüberstellung
- Der Verfremdungseffekt
- Der Schauspieler und das Publikum
- Die Verwendung von Musik im Epischen Theater
- Bühnenbau und Beleuchtung im Epischen Theater
- Der Film „Kuhle Wampe“ – Eine Analyse
- Daten zum Film
- Inhaltsanalyse
- Normen- und Werteanalyse
- Elemente des Epischen Theaters im Film „Kuhle Wampe“
- Die Anwendung des Verfremdungseffektes
- Die Verwendung von Musik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Film „Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt?“, welcher 1932 in Deutschland erschien und Brechts letzte öffentliche Aufführung in der Weimarer Republik darstellt. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen dem epischen und dem aristotelischen Theater, insbesondere im Hinblick auf den Verfremdungseffekt, die Rolle des Schauspielers und des Publikums sowie die Verwendung von Musik und Bühnenbild. Sie analysiert dann den Film „Kuhle Wampe“ selbst, indem sie die Inhalts-, Figuren- und Normen- und Werteanalyse betrachtet, sowie filmästhetische Aspekte beleuchtet. Abschließend wird analysiert, wie Elemente des epischen Theaters von Brecht und Dudow im Film umgesetzt werden und welche filmischen Adaptionen angewandt wurden.
- Abgrenzung zwischen epischem und aristotelischem Theater
- Der Verfremdungseffekt als zentrale Technik des epischen Theaters
- Die Rolle von Musik und Bühnenbild im epischen Theater
- Filmische Adaptionen des epischen Theaters in „Kuhle Wampe“
- Analyse von Inhalt, Figuren und Normen und Werten in „Kuhle Wampe“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des epischen Theaters und die Besonderheiten des Films „Kuhle Wampe“ ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen dem epischen und dem aristotelischen Theater, indem es den Verfremdungseffekt, die Rolle des Schauspielers und des Publikums, den Einsatz von Musik sowie Besonderheiten im Bühnenaufbau und der Beleuchtung erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Filmanalyse von „Kuhle Wampe“, wobei die Inhaltsanalyse, die Figurenanalyse und die Normen- und Werteanalyse im Vordergrund stehen.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die filmische Umsetzung des epischen Theaters in „Kuhle Wampe“, wobei die Anwendung des Verfremdungseffekts und die Verwendung von Musik im Zentrum stehen. Das fünfte Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Episches Theater, aristotelisches Theater, Verfremdungseffekt, Musik im Theater, Bühnenbild, Film „Kuhle Wampe“, Inhaltsanalyse, Figurenanalyse, Normen- und Werteanalyse, filmische Adaption.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet das epische vom aristotelischen Theater?
Das epische Theater zielt auf Distanz und Reflexion statt auf Einfühlung (Katharsis), wobei der Zuschauer als kritischer Beobachter fungiert.
Was ist der Verfremdungseffekt (V-Effekt)?
Eine Technik, die Vertrautes als fremdartig darstellt, um den Zuschauer zum Nachdenken über gesellschaftliche Zustände anzuregen.
Welche Bedeutung hat der Film „Kuhle Wampe“ für Bertolt Brecht?
Der Film von 1932 war Brechts letzte öffentliche Aufführung in der Weimarer Republik und adaptiert seine Theatertheorien für das Medium Film.
Wie wird Musik in „Kuhle Wampe“ eingesetzt?
Die Musik dient nicht der Untermalung von Emotionen, sondern kommentiert das Geschehen und verstärkt den Verfremdungseffekt.
Welche filmästhetischen Aspekte werden analysiert?
Die Analyse betrachtet Kameraeinstellungen, Ton, Montage und die Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilmelementen.
- Quote paper
- Sandro Abbate (Author), 2012, "Kuhle Wampe oder wem gehört die Welt" - Filmische Adaption des Brechtschen Epischen Theaters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201522