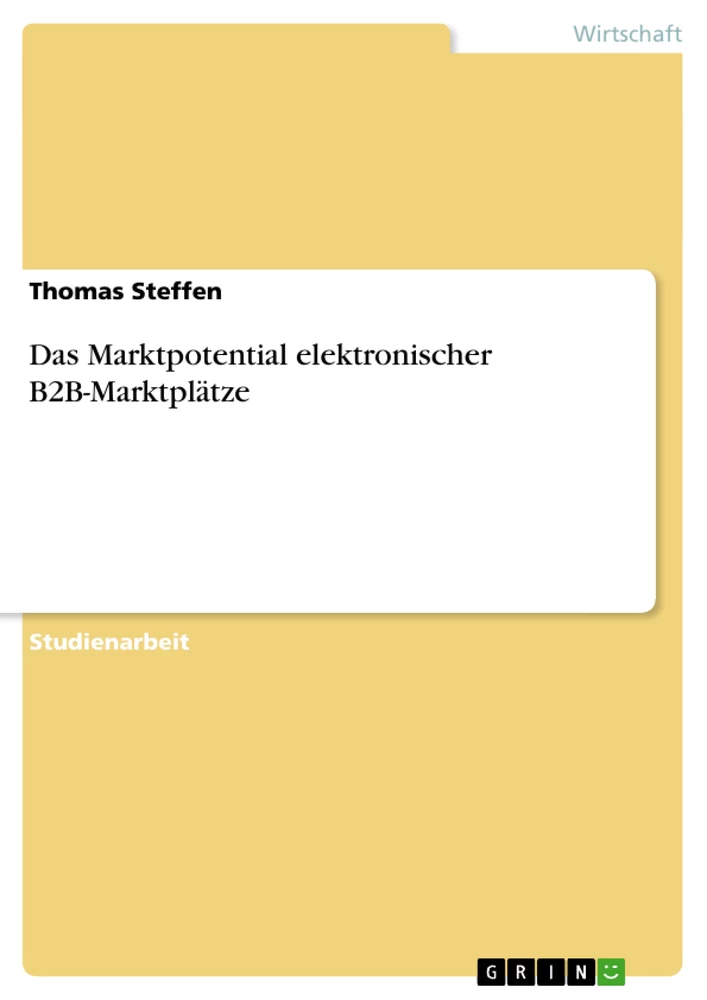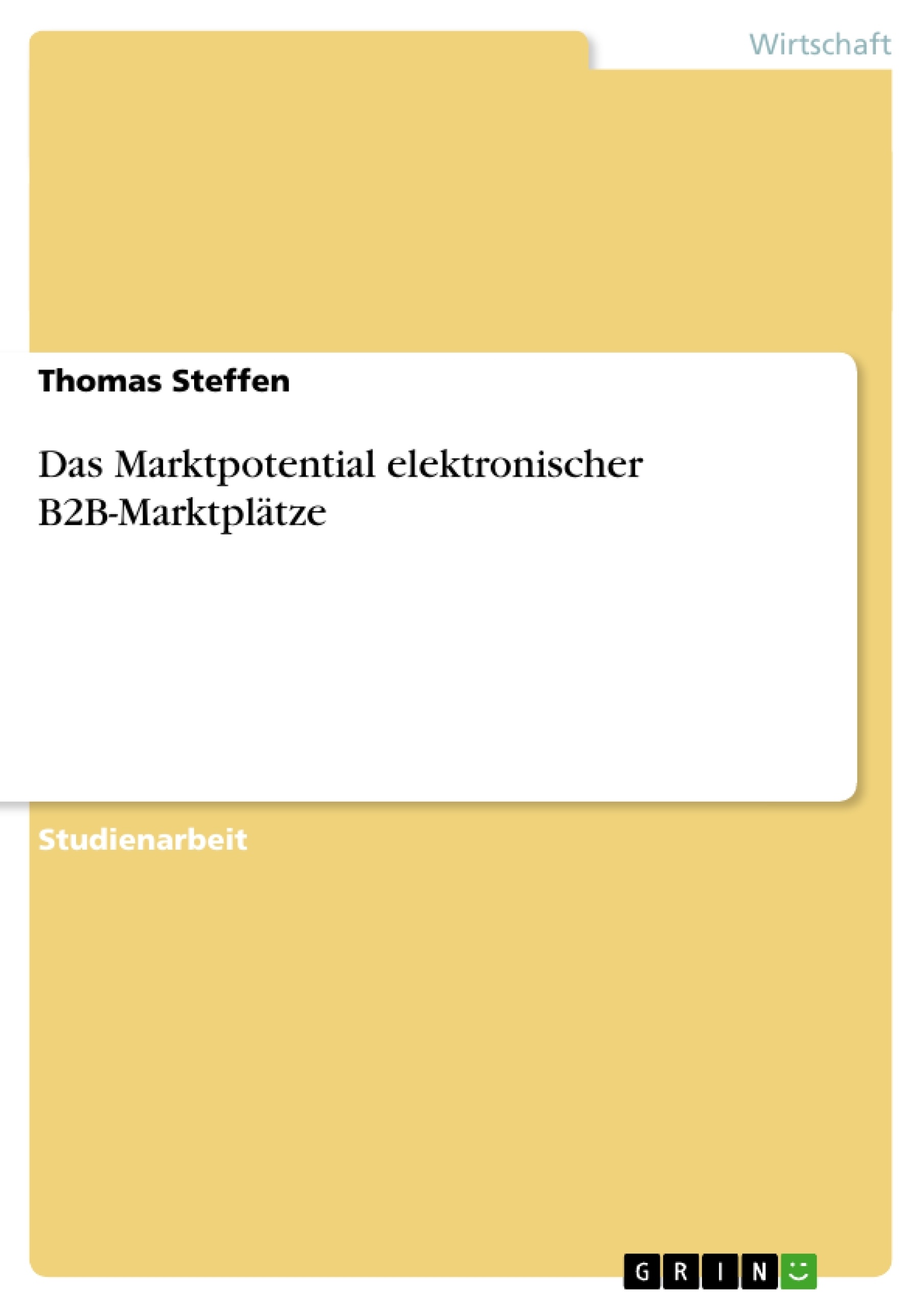Nicht nur Unternehmen und private Endverbraucher, sondern auch Unternehmen untereinander bilden einen Käufer- und Anbietermarkt: Unternehmen erwerben zum Beispiel Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, technische Anlagen oder gewerbliche Dienstleistungen von anderen Unternehmen, um die eigenen Endprodukte herzustellen und auf den Markt zu bringen. Dieser Beschaffungsvorgang ist im traditionellen, per Geschäftsbrief, Telefon, Fax oder „face-to-face“ vollzogenen Handel mit einem hohen Aufwand an Personal, Zeit und den entsprechenden Transaktionskosten verbunden: Da muss zunächst die Bedarfsmeldung vom Umfang, der Art und der Kostenhöhe her erfasst und anschließend in der Einkaufsabteilung geprüft und genehmigt werden. Handelt es sich nicht um einen Wiederholungskauf, sondern um einen Erstkauf, folgt eine sorgfältige Lieferantensuche und –auswahl. Nach der Bestellung und Lieferung der Ware, ihrer Lagerung, Verbuchung und Distribution, überprüfen die jeweiligen Empfänger im Unternehmen die beschafften Produkte und leiten die Rechnung zur Kontrolle und Verbuchung an die Rechnungsabteilung weiter. Anschließend folgt die Zahlungsabwicklung.
Dieser langwierige Prozess kann mit Hilfe moderner unternehmensübergreifender Informations- und Kommunikationstechnologie zeit- und kostensparender gestaltet werden. Vor allem mit der Teilnahme an elektronischen Business-to-Business-Marktplätzen verbinden Unternehmen derartige Erwartungen. Wie bei realen Märkten treffen auch hier Angebot und Nachfrage zusammen, allerdings mit dem Unterschied, dass eine digitale Infrastruktur zur Abwicklung eines Teils oder der gesamten Transaktion benutzt wird.
„Elektronische Marktplätze sind mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnik realisierte Marktplätze, die eine oder alle Phasen von marktmäßigen Transaktionen unterstützen. Sie bestehen aus einem Hard- und Softwaresystem, auf das die Marktteilnehmer mittels elektronischer Netzwerke zugreifen“, definieren Brenner/Breuer.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung zum Thema
- 1.1 Vom traditionellen Handel zwischen Unternehmen zum elektronischen B2B-Marktplatz
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Gegenwärtige Erscheinungsformen elektronischer B2B-Marktplätze
- 2.1 Ausrichtung: vertikal oder horizontal
- 2.2 Betreiberstruktur: abhängig oder unabhängig
- 2.3 Transaktionsformen
- 2.4 Erlösarten
- 2.5 Chancen und Risken
- 2.5.1 Beschaffungsseite
- 2.5.2 Absatzseite
- 3. Die Nutzerseite elektronischer B2B-Marktplätze
- 3.1 Erwartungen an B2B-Marktplätze
- 3.2 Anforderungen an Nutzer von B2B-Marktplätzen
- 4. Erfolgsfaktoren für elektronische B2B-Marktplätze
- 4.1 Zusatzdienstleistungen
- 4.2 Vernetzungen und Kooperationen
- 4.3 Kritische Masse
- 5. Fallbeispiel: Die Goodex AG
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Marktpotential elektronischer B2B-Marktplätze in Deutschland. Sie analysiert die gegenwärtige Situation, identifiziert Erfolgsfaktoren und bewertet die Chancen und Risiken dieser Technologie für Unternehmen.
- Entwicklung und Erscheinungsformen elektronischer B2B-Marktplätze
- Anforderungen und Erwartungen der Nutzer an B2B-Marktplätze
- Erfolgsfaktoren für elektronische B2B-Marktplätze
- Chancen und Risiken für Anbieter und Nutzer
- Bewertung des Marktpotentials
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hinführung zum Thema: Dieses Kapitel führt in die Thematik elektronischer B2B-Marktplätze ein. Es vergleicht den traditionellen Handel zwischen Unternehmen mit dem Handel über digitale Plattformen, wobei der hohe Aufwand an Personal, Zeit und Transaktionskosten im traditionellen Handel im Vordergrund steht. Der Umstieg auf elektronische Marktplätze wird als Möglichkeit zur Zeit- und Kostenersparnis dargestellt. Die rasante Entwicklung und der anschließende Einbruch des Marktes für B2B-Marktplätze in Deutschland werden als Problemstellung eingeführt und bilden den Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung.
2. Gegenwärtige Erscheinungsformen elektronischer B2B-Marktplätze: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ausprägungen elektronischer B2B-Marktplätze. Es analysiert deren Ausrichtung (vertikal oder horizontal), Betreiberstruktur (abhängig oder unabhängig), Transaktionsformen, Erlösmodelle und Chancen sowie Risiken sowohl für die Beschaffungs- als auch die Absatzseite. Die verschiedenen Klassifizierungsmerkmale werden detailliert erläutert und mit Beispielen illustriert, um ein umfassendes Bild der Marktsituation zu vermitteln.
3. Die Nutzerseite elektronischer B2B-Marktplätze: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Erwartungen und Anforderungen der Nutzer an B2B-Marktplätze. Es werden die Bedürfnisse der Unternehmen im Kontext der Nutzung dieser Plattformen untersucht. Die Kapitel analysiert, welche Faktoren für die Nutzerentscheidung relevant sind und welche Funktionalitäten von den Unternehmen erwartet werden. Die Zusammenfassung der Nutzerperspektive liefert wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung und den Erfolg von B2B-Marktplätzen.
4. Erfolgsfaktoren für elektronische B2B-Marktplätze: Dieses Kapitel befasst sich mit den Schlüsselfaktoren, die den Erfolg elektronischer B2B-Marktplätze beeinflussen. Es untersucht die Rolle von Zusatzdienstleistungen, Vernetzungen und Kooperationen sowie die Bedeutung einer kritischen Masse an Nutzern. Die Analyse dieser Faktoren liefert wertvolle Hinweise für die Strategieentwicklung und das Management von B2B-Marktplätzen.
Schlüsselwörter
Elektronischer B2B-Marktplatz, Marktpotential, Erfolgsfaktoren, Transaktionskosten, Nutzeranforderungen, Chancen und Risiken, Vertikale und horizontale Marktplätze, Betreiberstruktur, Transaktionsformen, Erlösmodelle, Digitale Infrastruktur, Internettechnologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Elektronische B2B-Marktplätze in Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Marktpotential elektronischer B2B-Marktplätze in Deutschland. Sie analysiert die aktuelle Situation, identifiziert Erfolgsfaktoren und bewertet die Chancen und Risiken dieser Technologie für Unternehmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Erscheinungsformen elektronischer B2B-Marktplätze, die Anforderungen und Erwartungen der Nutzer, Erfolgsfaktoren, Chancen und Risiken für Anbieter und Nutzer sowie eine Bewertung des Marktpotentials. Spezifische Aspekte umfassen die Ausrichtung (vertikal/horizontal), Betreiberstruktur (abhängig/unabhängig), Transaktionsformen und Erlösmodelle dieser Marktplätze.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einführung in die Thematik, eine Analyse der gegenwärtigen Erscheinungsformen elektronischer B2B-Marktplätze, eine Betrachtung der Nutzerseite (Erwartungen und Anforderungen), eine Untersuchung der Erfolgsfaktoren, ein Fallbeispiel (Goodex AG) und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Welche Arten von B2B-Marktplätzen werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet B2B-Marktplätze nach verschiedenen Kriterien: Ausrichtung (vertikal oder horizontal), Betreiberstruktur (abhängig oder unabhängig) und Transaktionsformen. Diese verschiedenen Ausprägungen werden detailliert beschrieben und analysiert.
Welche Erfolgsfaktoren für elektronische B2B-Marktplätze werden identifiziert?
Zu den identifizierten Erfolgsfaktoren gehören Zusatzdienstleistungen, Vernetzungen und Kooperationen sowie das Erreichen einer kritischen Masse an Nutzern. Die Bedeutung dieser Faktoren für den Erfolg wird eingehend untersucht.
Welche Chancen und Risiken werden für Anbieter und Nutzer von B2B-Marktplätzen betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet Chancen und Risiken sowohl für die Beschaffungs- als auch die Absatzseite. Diese werden im Kontext der verschiedenen Marktplatz-Ausprägungen und der Nutzeranforderungen analysiert.
Was ist das Fallbeispiel "Goodex AG"?
Das Kapitel zum Fallbeispiel "Goodex AG" dient der Veranschaulichung der theoretischen Konzepte und Erkenntnisse der Arbeit. Es wird ein konkreter Marktplatz vorgestellt und analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Elektronischer B2B-Marktplatz, Marktpotential, Erfolgsfaktoren, Transaktionskosten, Nutzeranforderungen, Chancen und Risiken, Vertikale und horizontale Marktplätze, Betreiberstruktur, Transaktionsformen, Erlösmodelle, Digitale Infrastruktur und Internettechnologie.
Welche Methode wird zur Untersuchung des Marktpotentials verwendet?
Die genaue Methode zur Untersuchung des Marktpotentials wird in der Arbeit detailliert beschrieben. Die Analyse umfasst jedoch die Betrachtung der aktuellen Marktsituation, der identifizierten Erfolgsfaktoren und der Bewertung der Chancen und Risiken für Unternehmen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Thema elektronischer B2B-Marktplätze befassen, einschließlich Unternehmen, die solche Plattformen nutzen oder betreiben, sowie Wissenschaftler und Studenten im Bereich Wirtschaftsinformatik und E-Commerce.
- Quote paper
- Thomas Steffen (Author), 2002, Das Marktpotential elektronischer B2B-Marktplätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20150